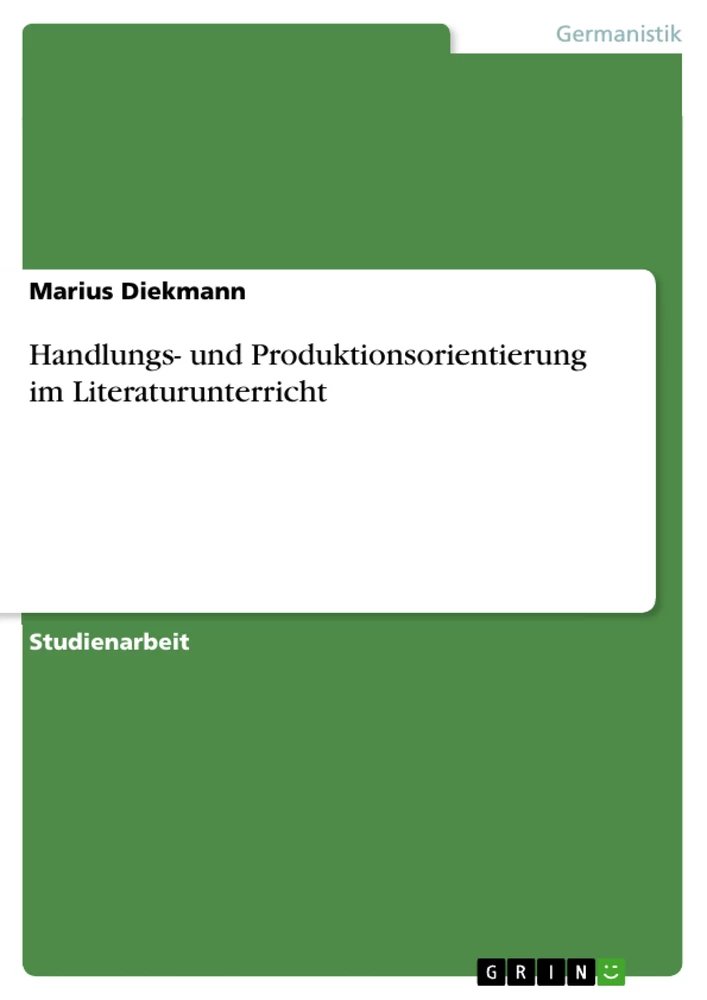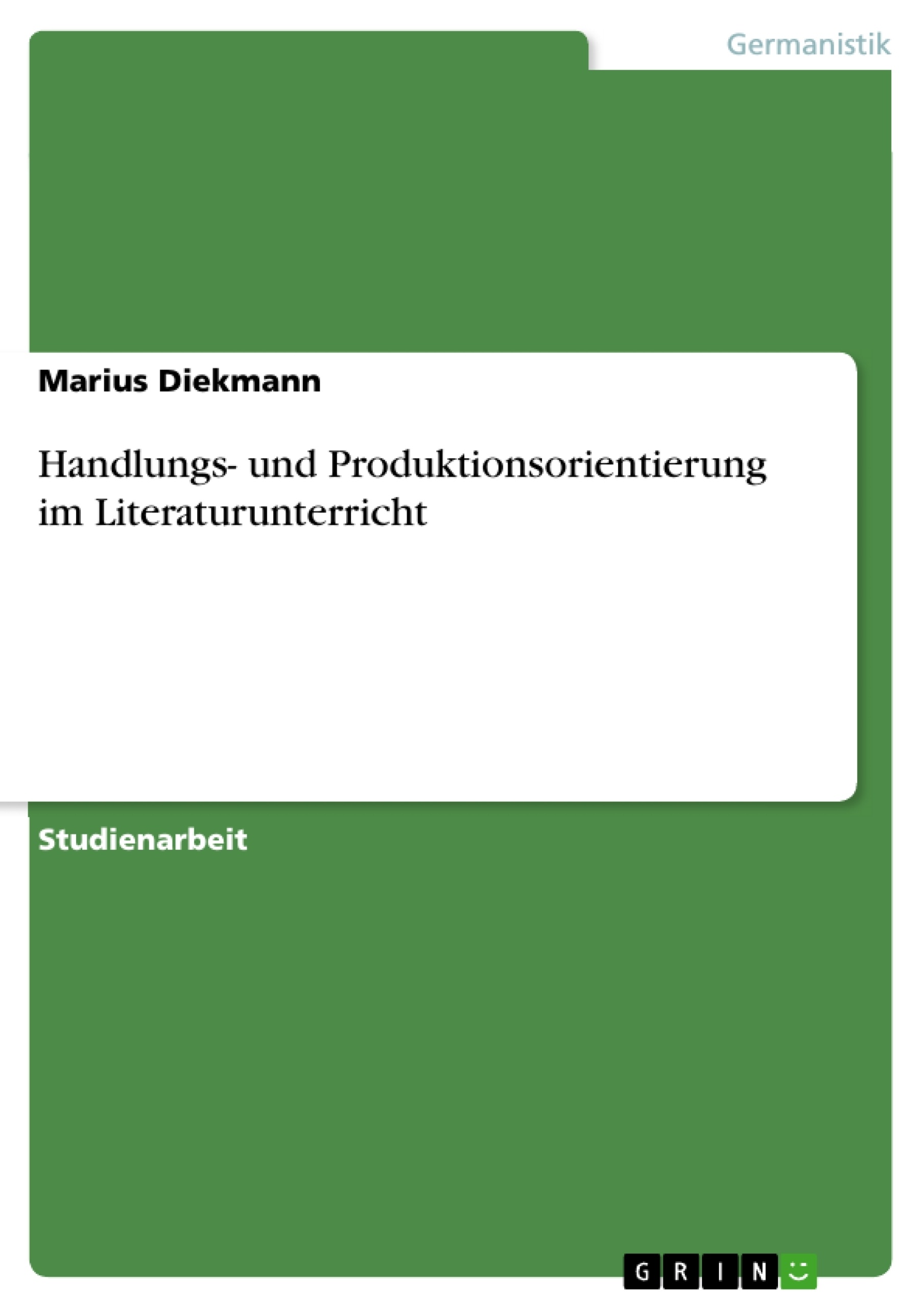Einleitung
„Mit 93 Pullis zum Abitur“ – Warum Handlungs- und Produktionsorientierung?
1.1 Das Langeweile Syndrom
In der Einleitung des von ihm herausgegebenen Bandes „Imaginative und emotionale Lernprozesse im Deutschunterricht“ merkt Spinner an, dass die Kritik an der einseitig kognitven Ausrichtung des Deutschunterrichts fast ebenso alt sei, wie das Fach und seine Zielsetzung den „ganzen Menschen mit seinen Sinneserfahrungen, seinen Gefühlen, seiner Phantasie, seinem Denken anzusprechen“ (Spinner 1995: 7).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- ,,Mit 93 Pullis zum Abitur“ – Warum Handlungs- und Produktionsorientierung?
- Das Langeweile Syndrom
- Schüler - Nebentätigkeiten
- Produktions- und Handlungsorientierung als mögliche Lösung des Nebentätigkeiten - Problems
- Das historische Umfeld
- Eine kranke Ameise und pädagogische Fahrräder
- Verschiedene Konzepte von Handlungs- und Produktionsorientierung
- Gerhard Haas: Handlungs und produktionsorientierter Literaturunterricht
- Die aktuelle Unterrichtssituation
- Warum ein handlungs- und produktionsorientierter Literaturunterricht
- Ziele eines handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts
- Handlungsorientierter Unterricht – mit Texten handelnd umgehen
- Folgen für die Unterrichtsweise
- Günter Waldmann: Produktiver Umgang mit Literatur im Unterricht
- Vorüberlegungen
- Waldmanns,,Grundriss einer produktiven Hermeneutik“
- Texttheoretische Überlegungen
- Der literarische Autor
- Der literarische Leser
- Modellskizze einer produktiven Hermeneutik
- Didaktisches Phasenmodell literarischen Textverstehens
- Vorphase
- 1. Phase: Lesen und Aufnehmen literarischer Texte
- 2. Phase: Konkretisierende subjektive Aneignung literarischer Texte
- 3. Phase: Textuelles Erarbeiten literarischer Texte
- 4. Phase: Textüberschreitende Auseinandersetzung mit Literatur
- Produktive Erfahrungen mit Literatur anstelle von Analyse und Literaturwissenschaftlichem Fachwissen?
- Vergleich
- Kritik
- Eigene Stellungnahme und Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich mit dem Konzept der Handlungs- und Produktionsorientierung im Literaturunterricht auseinander. Sie analysiert und bewertet verschiedene Konzepte und Ansätze, die eine Abkehr von einer einseitigen kognitiven Ausrichtung des Unterrichts und eine Hinwendung zu einem handlungs- und produktionsorientierten Ansatz fordern.
- Das „Langeweile-Syndrom“ im Deutschunterricht und die damit verbundene mangelnde Motivation der Schüler.
- Die Bedeutung von Schüleraktivitäten und Selbsttätigkeit für den Lernerfolg.
- Die verschiedenen Konzepte von Handlungs- und Produktionsorientierung im Literaturunterricht, insbesondere die Ansätze von Gerhard Haas und Günter Waldmann.
- Kritik an Handlungs- und Produktionsorientierung und deren Auswirkungen auf die Unterrichtspraxis.
- Die Rolle von Analyse und Literaturwissenschaftlichem Fachwissen im Kontext eines handlungs- und produktionsorientierten Unterrichts.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Handlungs- und Produktionsorientierung im Literaturunterricht ein und beleuchtet das Problem des „Langeweile-Syndroms“, das durch einen einseitig kognitiven Ansatz im Unterricht entsteht. Die Schüler reagieren darauf mit Nebentätigkeiten, die ihre Motivation und Konzentration beeinträchtigen. Als mögliche Lösung wird die Handlungs- und Produktionsorientierung präsentiert, die den Schülern mehr Raum für Selbsttätigkeit und Kooperation bietet.
- Das historische Umfeld: Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die historische Entwicklung des produktiven Umgangs mit Literatur im Unterricht, der bereits seit der Aufklärung eine wichtige Rolle spielt.
- Verschiedene Konzepte von Handlungs- und Produktionsorientierung: Dieses Kapitel analysiert die Konzepte von Gerhard Haas und Günter Waldmann. Haas plädiert für einen handlungsorientierten Unterricht, der die Schüler aktiv am Lernprozess beteiligt und ihnen die Möglichkeit gibt, mit Texten handelnd umzugehen. Waldmanns Ansatz zielt auf einen produktiven Umgang mit Literatur ab, der die Schüler dazu anregt, eigene Texte und Ideen zu entwickeln.
- Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die Ansätze von Haas und Waldmann und stellt Gemeinsamkeiten und Unterschiede heraus.
- Kritik: Dieses Kapitel präsentiert kritische Stimmen zu Handlungs- und Produktionsorientierung und beleuchtet deren potenzielle Nachteile.
Schlüsselwörter
Handlungs- und Produktionsorientierung, Literaturunterricht, Langeweile-Syndrom, Schülermotivation, Selbsttätigkeit, Kooperation, Gerhard Haas, Günter Waldmann, produktiver Umgang mit Literatur, Analyse, Literaturwissenschaftliches Fachwissen.
- Quote paper
- Marius Diekmann (Author), 2000, Handlungs- und Produktionsorientierung im Literaturunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/3869