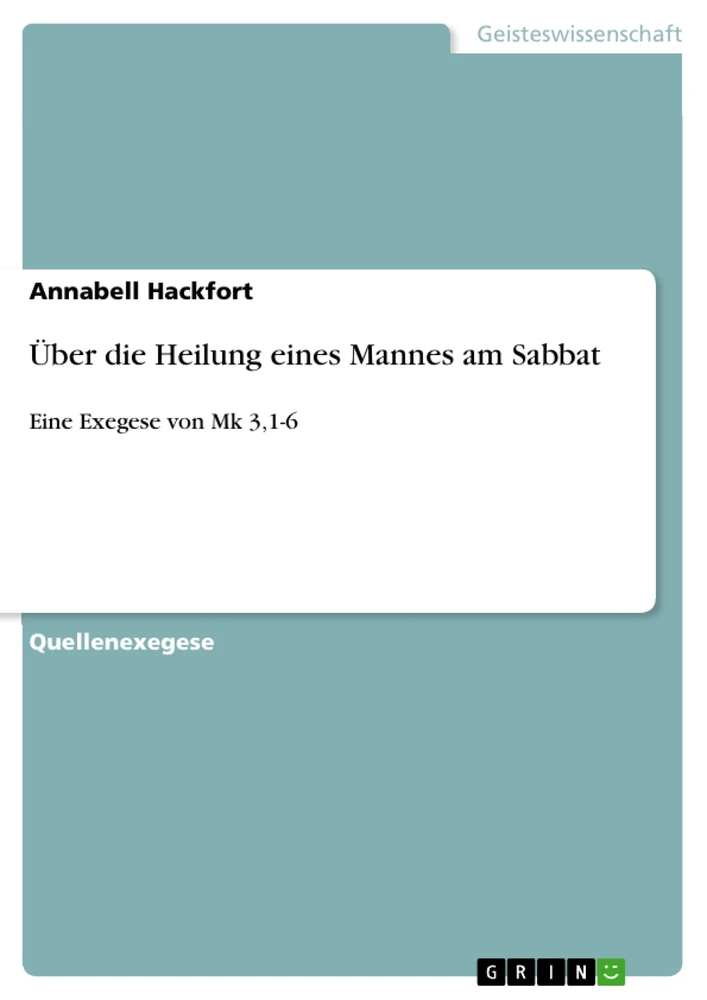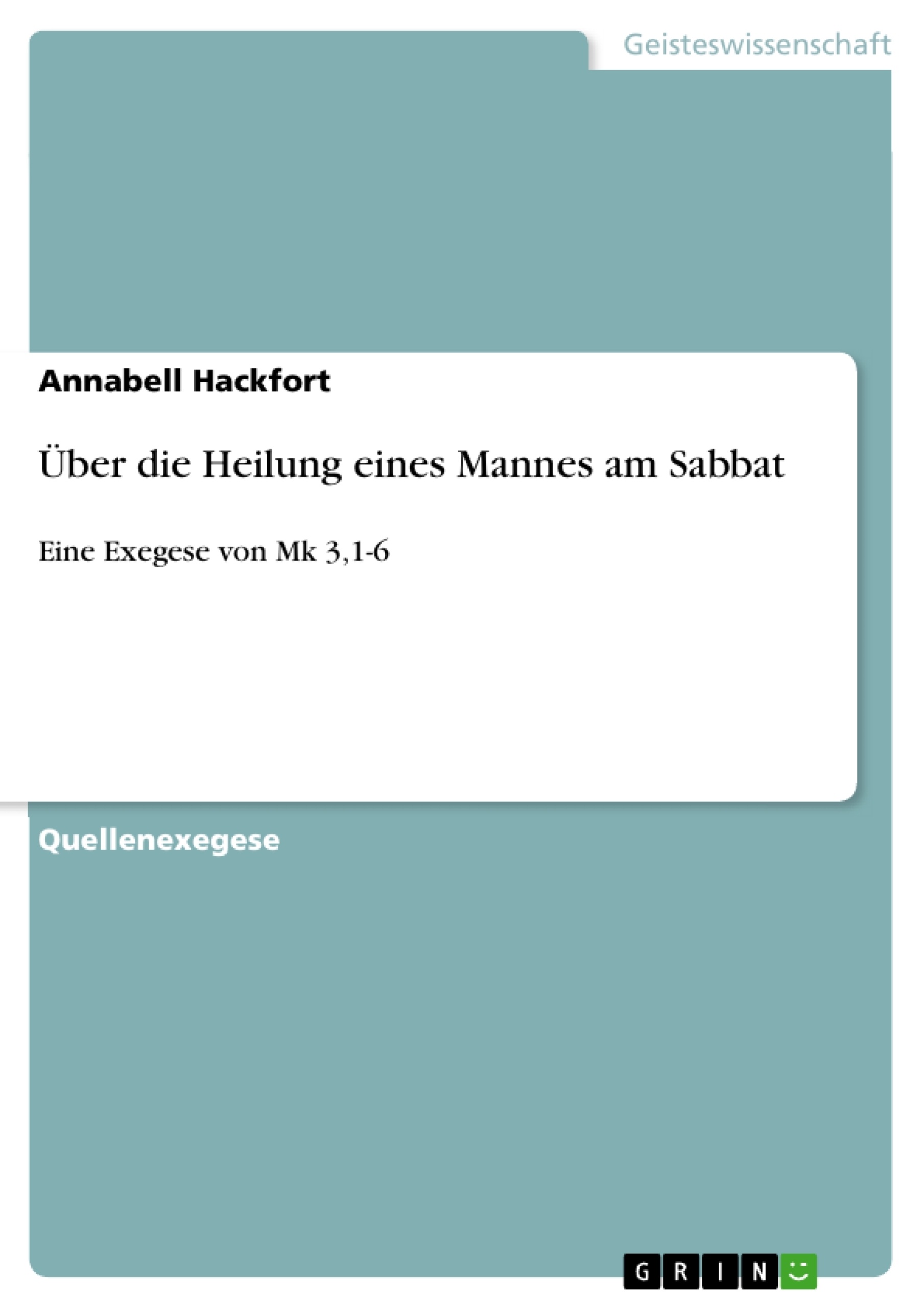Die zentrale Formulierung der Perikope über gute und böse Handlungen am Sabbat scheint bei dem Leser verstärkt im Gedächtnis zu bleiben. Sie wirft nicht nur grundsätzliche Verständnisfragen auf, sondern stellt vielmehr auch entscheidende theologische Deutungen in Frage. Denn wieso gerät Jesus in den Konflikt mit dem Sabbatgesetz? Eine Auflehnung von Jesus gegen das Gesetzt scheint hier die erste Problemlösung zu sein. Würde er sich nicht auflehnen, gäbe es keine Konflikte. Denn scheinbar zu Recht kann die Kritik formuliert werden, dass die Heilung des Kranken noch einen Tag hätte waren können. Ob seine verdorrte Hand am Sabbat oder am darauffolgenden Tag geheilt wird, mag vermutlich keinen essentiellen Unterschied darstellen. Aber warum sollte es nicht möglich sein am Sabbat mit gutem Willen zu handeln und Gutes zu tun? Weshalb schließt der Sabbat die Wunderheilungen aus? Und wieso darf man weder Gutes tun, noch übel handeln? Wie sollte man sich dann überhaupt noch am Sabbat verhalten dürfen? Nicht nur die Beschreibung der Situation und das Vorgehen Jesu sind dabei scheinbar interessant zu betrachten, auch die Auffälligkeit des Schweigens der Gegner Jesu fällt hier besonders ins Auge. Denn warum schweigen sie und geben keine Antwort auf Jesus gegensätzliche Darstellung von gut und böse?
Zur Klärung dieser Fragen und für die vertiefende exegetische Betrachtung der Perikope wird zunächst eine selbst angefertigte Übersetzung des Bibeltextes formuliert. Diesem Vorgehen schließen sich die Abgrenzung und die Kontextanalyse des Textes an. Die anschließende Betrachtung von Syntax und Semantik verspricht eine Vereinfachung des folgenden synoptischen Vergleiches. Durch die Frage nach der Vorgeschichte und dem Überlieferungsgang unter dem Punkt der Überlieferungsgeschichte wird der Prozess der Entstehung des Textes bis zu seiner letztendlichen Form dargestellt. Daraufhin wird in Kapitel 5 der Versuch aufgestellt, die Perikope einer bestimmten Gattung zuzuordnen, parallele Stellen zu finden und den Sitz im Leben zu bestimmen, um die Bedeutung der Perikope zur damaligen Zeit zu analysieren. Abschließend wird die redaktionelle Bearbeitung der Perikope untersucht und herausgestellt, welche Bestandteile der Tradition zuzuordnen sind. Die wichtigsten Motive zur Deutung der Textaussagen werden unter dem Punkt der Traditionsgeschichte erarbeitet. Schlussendlich widmet sich das Kapitel 9 der Hermeneutik, die die Aktualität und die heutige Bedeutung der Perikope klären soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Übersetzung
- Literarkritik
- Abgrenzung der Texteinheit
- Kontextanalyse
- Sprachlich-syntaktische Analyse
- Semantische Analyse
- Synoptischer Vergleich
- Überlieferungsgeschichte
- Formkritik/-geschichte
- Gattungszuordnung
- Gliederung des Textes
- Parallele Texte
- Sitz im Leben
- Redaktionskritik
- Trennung von Tradition und Redaktion
- Intention des Autors
- Traditionsgeschichte / Begriffs- und Motivgeschichte
- Das Herz-Kapdía
- Die Hand-xépɩ
- Das Böse – κακός
- Hermeneutik
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Exegese von Markus 3,1-6, der Heilung eines Mannes am Sabbat, verfolgt das Ziel, den Text in seinen historischen und literarischen Kontext zu stellen, seine sprachlichen und inhaltlichen Besonderheiten zu beleuchten sowie seine Bedeutung in der heutigen Zeit zu erforschen. Dazu werden verschiedene Methoden der Exegese angewendet, um die Intention des Autors und die theologischen Aussagen des Textes zu verstehen.
- Der Konflikt zwischen Jesus und den Schriftgelehrten bezüglich des Sabbatgesetzes
- Die Bedeutung der Heilung als Ausdruck der Macht Jesu
- Das Schweigen der Gegner Jesu als Zeichen ihrer Ohnmacht und Verstocktheit
- Die Frage nach der Bedeutung des Sabbats in der heutigen Zeit
- Die Rolle des Mitleids in Jesu Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die zentrale Bedeutung des Textes und seine Fragestellungen heraus. Die Übersetzung des Textes analysiert die gewählten Vokabeln und deren Bedeutung für das Verständnis des Textes. Im Kapitel über die Literarkritik wird die Abgrenzung der Texteinheit sowie die Kontextanalyse beleuchtet. Die sprachlich-syntaktische Analyse behandelt die grammatischen Besonderheiten des Textes, während die semantische Analyse die Bedeutung der einzelnen Wörter und ihre Rolle im Text untersucht. Der synoptische Vergleich vergleicht den Text mit anderen Evangelien und zeigt Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf. Die Überlieferungsgeschichte stellt die Entwicklung des Textes von seinen Anfängen bis zu seiner endgültigen Form dar. In der Formkritik/-geschichte wird der Text einer bestimmten Gattung zugeordnet, seine Gliederung analysiert und Parallelen zu anderen Texten aufgezeigt. Der Sitz im Leben untersucht die Bedeutung des Textes in seiner historischen und kulturellen Umgebung. Die Redaktionskritik betrachtet die Intention des Autors und die Rolle der Redaktion in der Entstehung des Textes. In der Traditionsgeschichte werden wichtige Motive und Begriffe des Textes behandelt. Abschließend setzt sich die Hermeneutik mit der Aktualität und der heutigen Bedeutung des Textes auseinander.
Schlüsselwörter
Sabbat, Heilung, Wunder, Konflikt, Schriftgelehrte, Jesus, Macht, Mitleid, Verstocktheit, Tradition, Redaktion, Hermeneutik, Kontextanalyse, Semantik, Syntax, Synoptischer Vergleich, Überlieferungsgeschichte, Sitz im Leben, Gattungszuordnung.
- Quote paper
- Annabell Hackfort (Author), 2015, Über die Heilung eines Mannes am Sabbat, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/386007