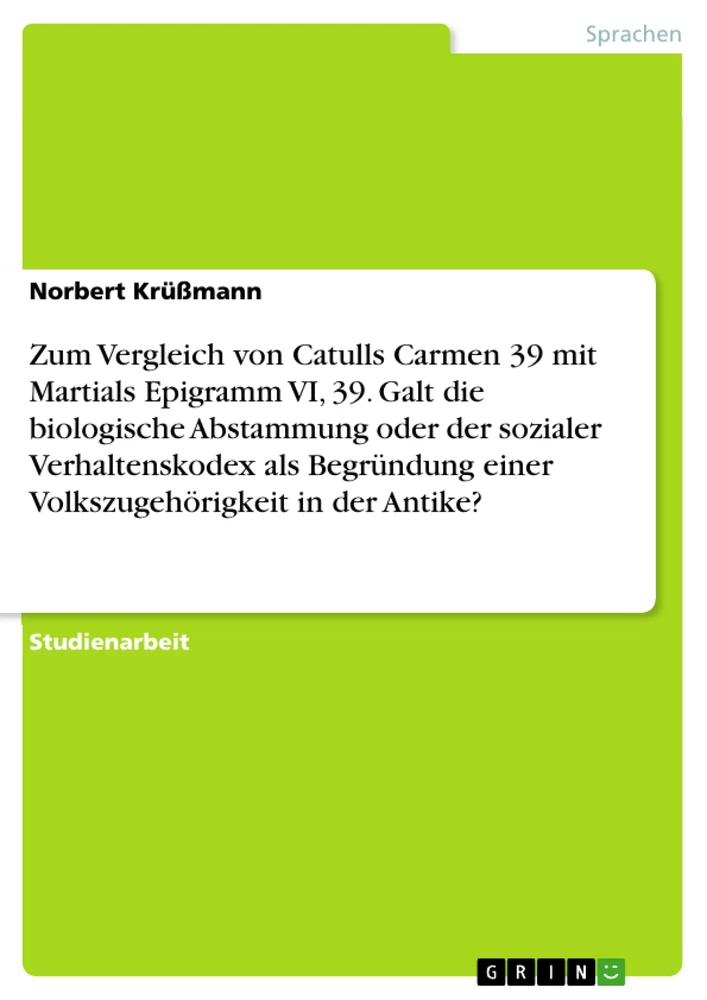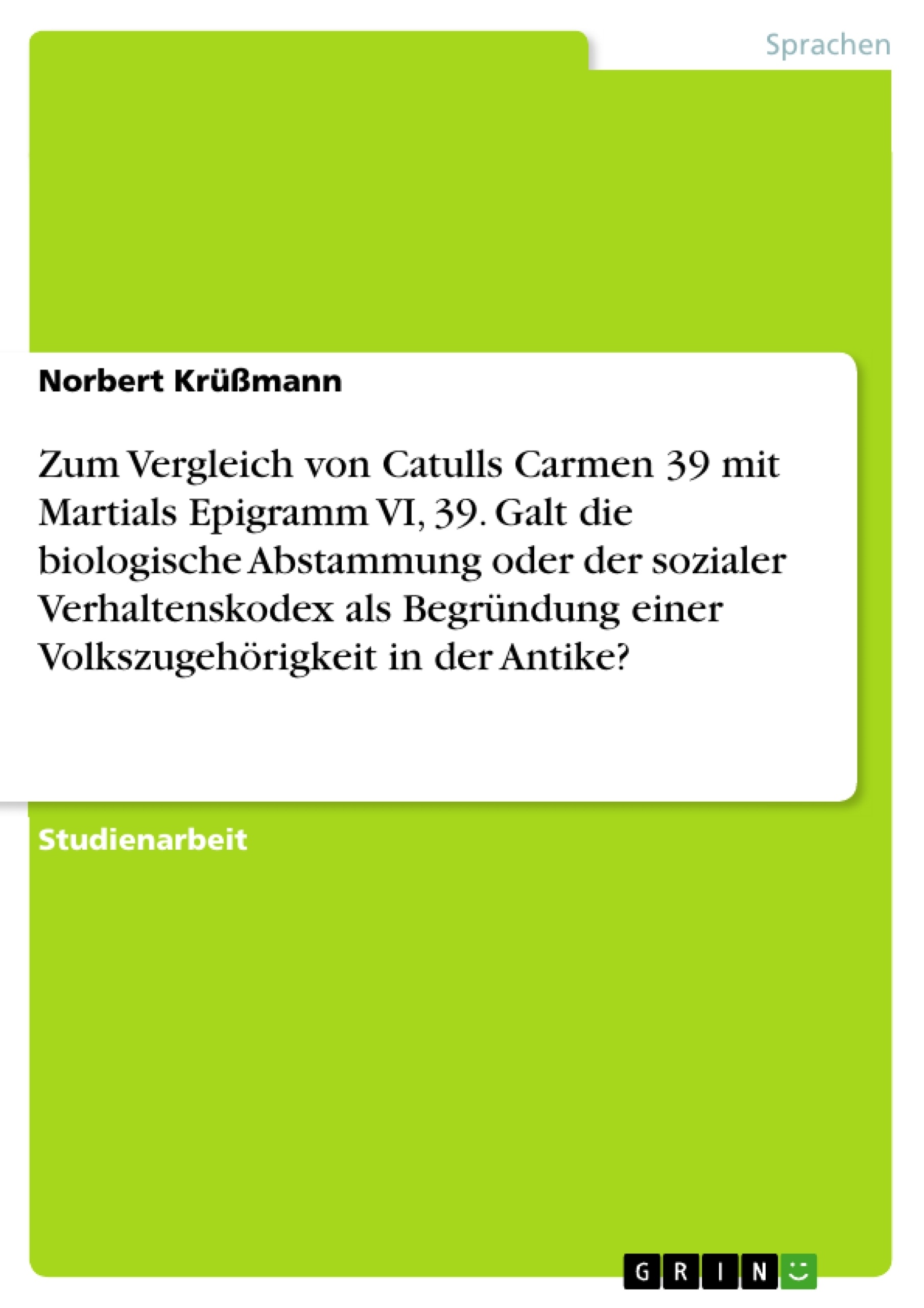Über einen Vergleich zweier Texte einerseits von Catull, andererseits von Martial stammend nähert sich die Arbeit der Fragestellung an, ob biologische Abstammung oder sozialer Verhaltenskodex in der Antike als Begründung einer Volkszugehörigkeit erachtet wurde. Insbesondere wirft die Frage ein neues Licht auf das, was als Rom-Idee in der klassischen Latinität im Raume steht. Eher beiläufig ergibt sich darüber hinaus ein Indiz für die Herausgabe letzter Hand im Falle des Corpus Catullianum.
Augenfälligste Verbindung der beiden Texte und somit in gewisser Weise Voraussetzung für einen solchen Bezug ist die Position innerhalb des Corpus: Ist es Zufall, dass beide Epigramme die Nummer 39 tragen? Implizit ist damit auch die Frage berührt, ob das Corpus Catullianum bereits zu Zeiten Martials die heute vorliegende Ordnung trug, und letztlich, ob es sich bei dem Corpus Catullianum um eine Ausgabe letzter Hand handelt. Die beiden letztgenannten Fragen werden in dieser Arbeit nicht wirklich thematisiert, zumal sich zahllose Berufenere damit bereits beschäftigt haben.
Intensiver befasst sich diese Arbeit mit dem Verständnis der Aussage der beiden Epigramme und dem impliziten Selbstverständnis der Autoren, das aus ihnen spricht. Dass dieses Selbstverständnis dabei gleichzeitig eine Definition einer Romidee beinhaltet – die allerdings ganz und gar verschieden ist von der Romidee eines Vergil – erklärt sich zum einen aus der unterschwelligen Fremdenverachtung, die beiden Texten inhärent ist, zum anderen aber auch gerade aus der hispanischen Herkunft Martials. Insbesondere diese Herkunft ist natürlich von Interesse, wenn man in seinem Werk einen Bezug sehen will auf ein Epigramm, das sich über eine keltiberische Sitte lustig zu machen scheint.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Catulli Carmen 39
- Formale Analyse
- Inhaltliche Interpretation
- War Martial Keltiberer?
- Martialis Epigramma VI,39
- Formale Analyse
- Inhaltliche Interpretation
- Vergleich und Ausdeutung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, Catulls Carmen 39 und Martials Epigramm VI,39 zu vergleichen und die Beziehung zwischen den beiden Texten zu untersuchen. Dabei wird die Frage nach der bewussten Bezugnahme Martials auf den älteren Dichter Catull gestellt, die sich auch auf die Ordnung des Corpus Catullianum bezieht.
- Formale Analyse der beiden Texte
- Inhaltliche Interpretation der beiden Texte
- Vergleich der beiden Texte hinsichtlich Form und Inhalt
- Untersuchung der möglichen Bezugnahme Martials auf Catull
- Analyse des Selbstverständnisses der beiden Autoren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentralen Fragen der Arbeit vor. Kapitel 2 analysiert Catulls Carmen 39 in Bezug auf Form und Inhalt. Kapitel 3 befasst sich mit der Frage nach der möglichen keltiberischen Herkunft Martials. Kapitel 4 analysiert Martials Epigramm VI,39 in Bezug auf Form und Inhalt. Kapitel 5 vergleicht die beiden Texte und diskutiert die möglichen Bezüge zwischen ihnen.
Schlüsselwörter
Hinkjambus, Catull, Martial, Carmen 39, Epigramm VI,39, Vergleich, Bezugnahme, Corpus Catullianum, Romidee, Keltiberer, Formale Analyse, Inhaltliche Interpretation.
- Quote paper
- Magister Artium Norbert Krüßmann (Author), 2017, Zum Vergleich von Catulls Carmen 39 mit Martials Epigramm VI, 39. Galt die biologische Abstammung oder der sozialer Verhaltenskodex als Begründung einer Volkszugehörigkeit in der Antike?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/385704