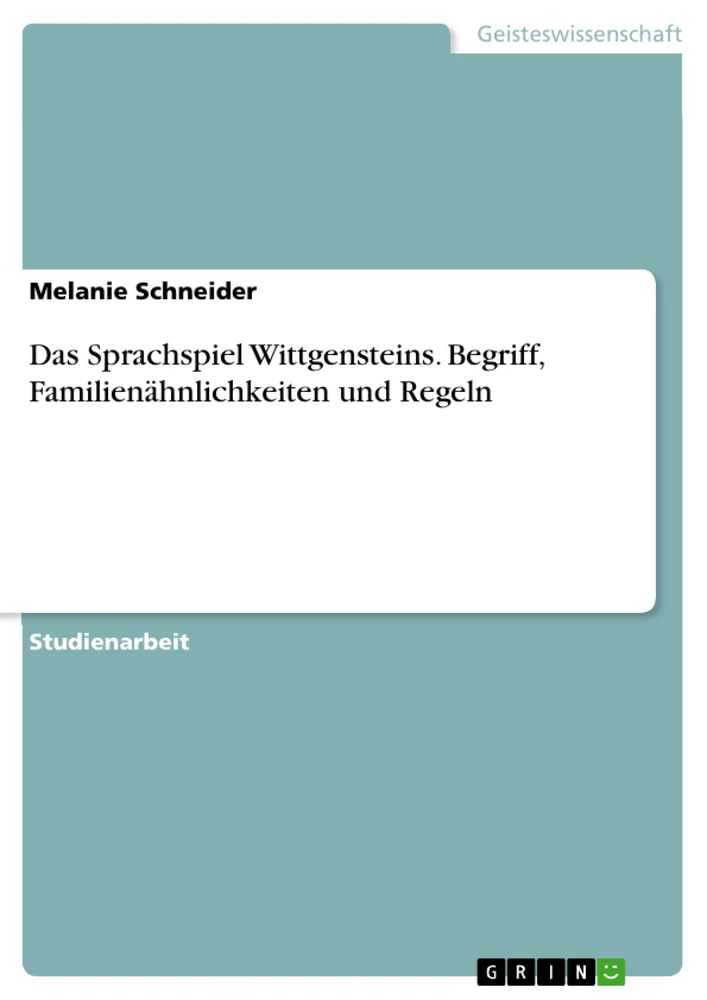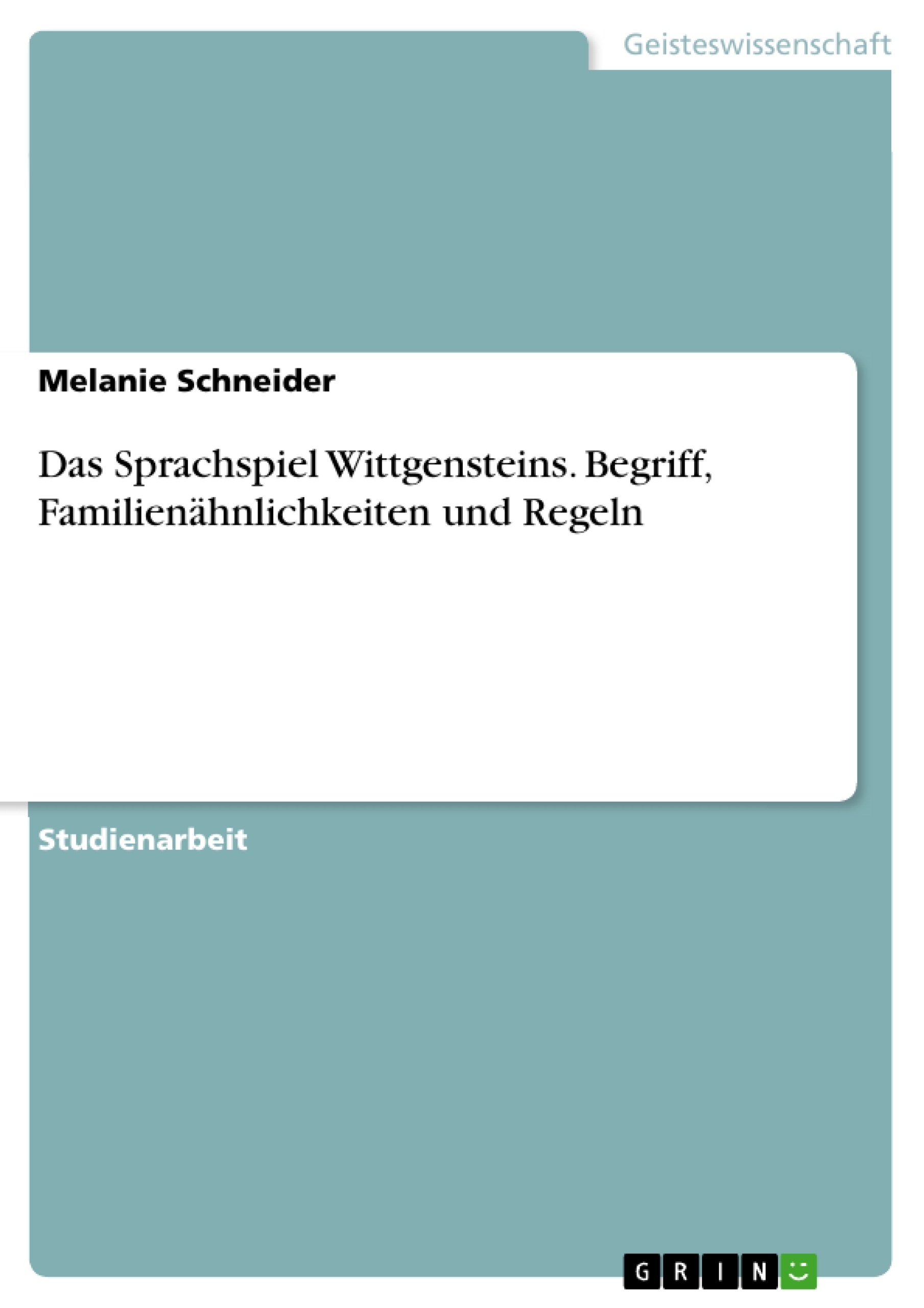Wittgenstein ist ein Philosoph, der sich vor allen Dingen dem Sprachgebrauch zuwandte. Er war der Auffassung, dass wir unsere Sprache falsch gebrauchen. Darin sah er auch das Hauptproblem in seinen philosophischen Untersuchungen. Er hatte den Verdacht, ,,daß viele Probleme der Philosophie im Grunde Verknotungen des Denkens, Selbstfesselung, Verschlingungen und gordische Knoten der Sprache [sind]“ .
Der zentrale Aspekt in eben jenen philosophischen Untersuchungen ist der des ,,Sprachspiels“. Wittgenstein möchte anhand eben jenes, eine gewisse Klarheit in den philosophischen Problemen schaffen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich nun mit eben jenem ,,Sprachspiel“. Dazu ist es unablässig, den Grundgedanken zu verstehen und die Voraussetzungen zu klären, denn eine konkrete Definition will und kann Wittgenstein nicht geben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Begriff des „Sprachspiels“
- 2.1. Der Begriff im „Blauen Buch“
- 2.2. Der Begriff im „Braunen Buch“
- 2.3. Der Begriff in den „Philosophischen Untersuchungen“
- 2.3.1. Merkmale und Definition des Sprachspielbegriffs
- 2.3.2. Gebrauch und Bedeutung
- 2.4. Die primitive Form des Sprachspiels
- 2.5. Das Sprachspiel als Ganzes der Sprache
- 3. Das Sprachspiel und Familienähnlichkeiten
- 4. Das Sprachspiel und die Regeln
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Wittgensteins Konzept des „Sprachspiels“ in seinen „Philosophischen Untersuchungen“. Ziel ist es, den Begriff zu klären und seine Bedeutung für Wittgensteins Philosophie zu verstehen. Eine konkrete Definition wird nicht angestrebt, da Wittgenstein selbst keine liefert. Stattdessen wird der Begriff anhand seiner Entwicklung in verschiedenen Werken analysiert.
- Entwicklung des Sprachspielbegriffs in Wittgensteins Werk
- Merkmale und Definition des Sprachspiels
- Bedeutung des Sprachspiels für die Philosophie
- Zusammenhang zwischen Sprachspiel und Sprachgebrauch
- Der Begriff des Sprachspiels im Kontext von Familienähnlichkeiten und Regeln
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein. Sie beschreibt Wittgensteins Fokus auf den Sprachgebrauch in seinen „Philosophischen Untersuchungen“ und hebt die Mehrdeutigkeit und Vagheit von Wörtern und Sätzen hervor, die zu Missverständnissen führen können. Wittgenstein sah den falschen Sprachgebrauch als Hauptproblem der Philosophie und versuchte, die „Wurzel aller möglichen Missverständnisse“ aufzudecken. Der zentrale Aspekt der Arbeit ist das „Sprachspiel“, das Wittgenstein als Werkzeug zur Klärung philosophischer Probleme einsetzt. Die Arbeit befasst sich mit dem Verständnis des Grundgedankens und der Voraussetzungen des Sprachspiels, da Wittgenstein keine explizite Definition liefert.
2. Der Begriff des „Sprachspiels“: Dieses Kapitel analysiert den Begriff des „Sprachspiels“ in Wittgensteins Werk, beginnend mit den früheren Beschreibungen im „Blauen“ und „Braunen Buch“, bevor es sich den „Philosophischen Untersuchungen“ zuwendet. Es zeigt, wie Wittgenstein das Sprachspiel als vereinfachte Form des Sprachgebrauchs beschreibt, vergleichbar mit der Sprachentwicklung bei Kindern. Der Fokus liegt auf der Analyse der unterschiedlichen Darstellungen des Begriffs in den verschiedenen Werken und der Herausarbeitung der Kernelemente des Konzepts. Die Kapitel unterstreichen die Bedeutung des Sprachspiels als Werkzeug zum Verständnis von Sprach und Denken.
Schlüsselwörter
Sprachspiel, Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Sprachgebrauch, Familienähnlichkeiten, Regeln, Bedeutung, Missverständnisse, Blaues Buch, Braunes Buch, primitive Sprache.
Häufig gestellte Fragen zu Wittgensteins Sprachspiel
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Ludwig Wittgensteins Konzept des „Sprachspiels“, insbesondere wie es in seinen „Philosophischen Untersuchungen“ dargestellt wird. Das Ziel ist es, den Begriff zu klären und seine Bedeutung für Wittgensteins Philosophie zu verstehen, obwohl keine explizite Definition angestrebt wird, da Wittgenstein selbst keine liefert.
Welche Aspekte des Sprachspiels werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung des Sprachspielbegriffs in Wittgensteins Werk, beginnend mit frühen Beschreibungen im „Blauen“ und „Braunen Buch“. Sie analysiert Merkmale und Definitionen des Sprachspiels, seine Bedeutung für die Philosophie, den Zusammenhang mit Sprachgebrauch, sowie den Kontext von Familienähnlichkeiten und Regeln. Die Mehrdeutigkeit und Vagheit von Wörtern und Sätzen und deren Rolle bei Missverständnissen werden ebenfalls thematisiert.
Wie wird der Begriff „Sprachspiel“ in der Arbeit definiert?
Die Arbeit bietet keine konkrete Definition des „Sprachspiels“, da Wittgenstein selbst keine liefert. Stattdessen wird der Begriff anhand seiner Entwicklung in verschiedenen Werken analysiert, wobei seine Darstellung in den „Philosophischen Untersuchungen“ im Mittelpunkt steht. Der Fokus liegt auf der Analyse des Sprachgebrauchs und der Klärung philosophischer Probleme mithilfe des Sprachspiel-Konzepts.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Hauptquelle ist Wittgensteins „Philosophische Untersuchungen“. Zusätzlich werden seine früheren Werke, das „Blaue Buch“ und das „Braune Buch“, herangezogen, um die Entwicklung des Sprachspielbegriffs nachzuvollziehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt Wittgensteins Ansatz. Kapitel 2 analysiert den Begriff des „Sprachspiels“ in verschiedenen Werken Wittgensteins, Kapitel 3 befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen Sprachspiel und Familienähnlichkeiten, Kapitel 4 mit dem Verhältnis von Sprachspiel und Regeln, und Kapitel 5 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachspiel, Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Sprachgebrauch, Familienähnlichkeiten, Regeln, Bedeutung, Missverständnisse, Blaues Buch, Braunes Buch, primitive Sprache.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, Wittgensteins Konzept des „Sprachspiels“ zu verstehen und seine Bedeutung für seine Philosophie zu klären. Die Arbeit soll ein tieferes Verständnis des Sprachgebrauchs und der Entstehung von Missverständnissen vermitteln.
- Quote paper
- Melanie Schneider (Author), 2015, Das Sprachspiel Wittgensteins. Begriff, Familienähnlichkeiten und Regeln, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/381133