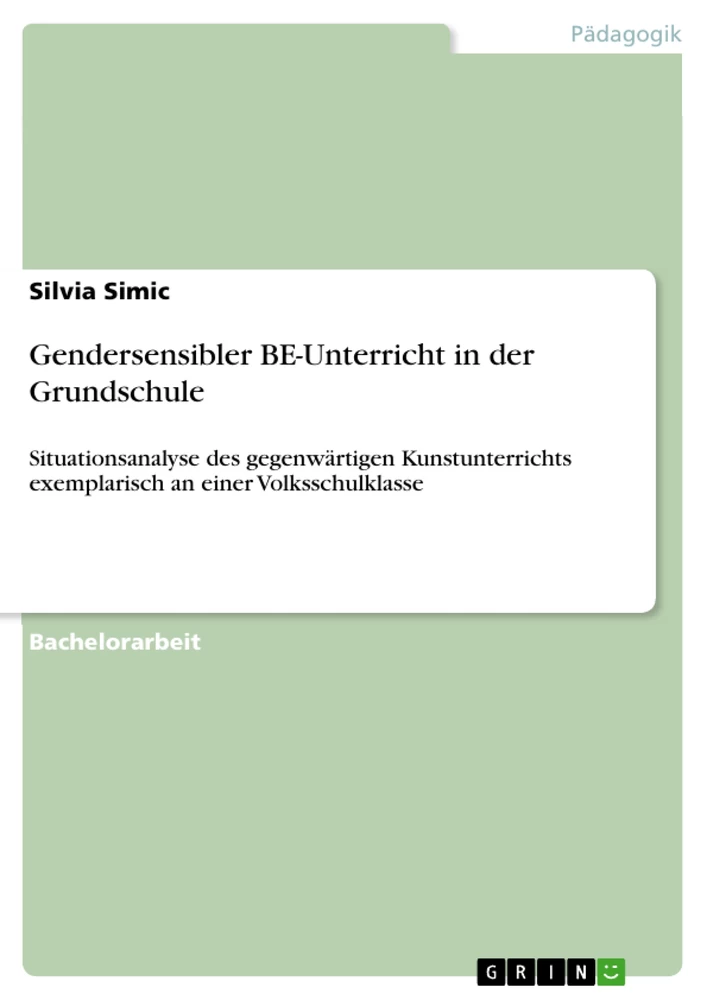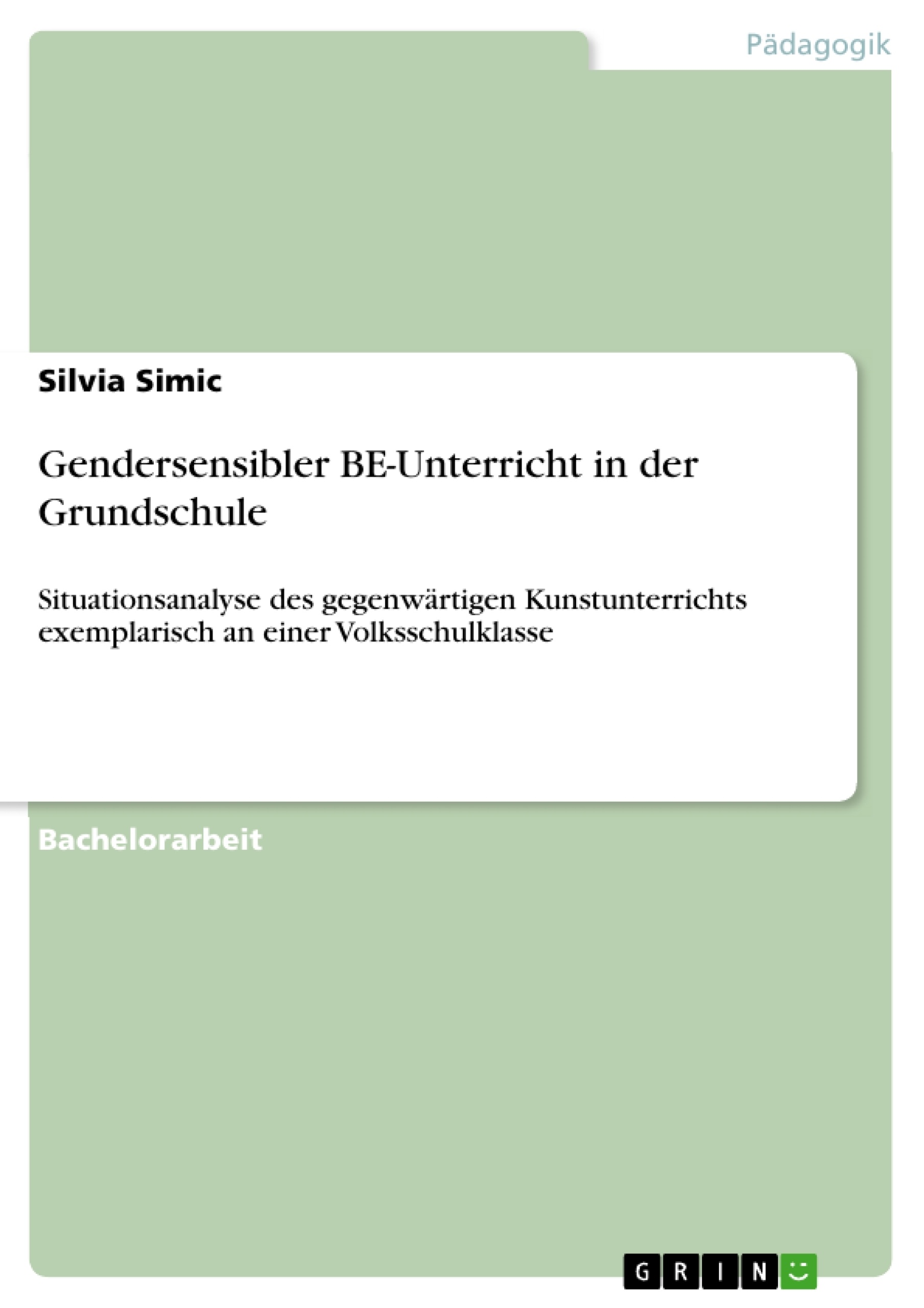Die theoretische Beschäftigung mit dem Thema Gender und Geschlechtsunterschiede in der Schule erfolgt im ersten Teil dieser Arbeit. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Literatur wird die Bedeutung des BE- Unterrichts herausgearbeitet und es soll deutlich gemacht werden, warum sich Lehramtsstudierende bereits während ihrer Ausbildung intensiv mit gendersensiblem Unterricht auseinandersetzen sollten.
Im Rahmen des Forschungsteils beforscht die Autorin mittels Bildanalyse und Interpretationen einiger Schülerinnen- und Schülerarbeiten mit Blick auf die Genderthematik die bildnerische Umsetzung der Themen „Das ist meine Traumwelt“ und „Mein Supervorbild“.
Über die Genderthematik wird in unserer westlichen Gesellschaft in regelmäßigen Abständen diskutiert und argumentiert. Sei es am Arbeitsplatz oder aktuell in Zusammenhang mit den jährlichen PISA Testungen. Angeblich zeigen sich an den Ergebnissen signifikante Leistungsunterschiede zwischen den Geschlechtern. Gegenüber den letzten PISA Erhebungen von 2014 hat die Genderbedeutung allerdings deutlich zugenommen. Beide Geschlechter werden mit allerlei (Vor)urteilen konfrontiert und vor allem die ungleiche Behandlung von Buben und Mädchen wirft Fragen für einen gendersensiblen Unterricht auf. Jungen und Mädchen werden nicht nur unterschiedlich behandelt, sondern man schreibt den Kindern aufgrund ihres Geschlechtes auch unterschiedliche Attribute zu.
Ist dies gerechtfertigt? Beginnt diese vermeintlich ungleiche Behandlung bereits im frühen Kindesalter? Welche Auswirkungen – oder auch nicht –hat dies auf Kinder im Volkschulalter? Welche Erwartungen haben Lehrpersonen an Mädchen und Jungen im Unterricht? Haben Mädchen und Jungen tat-sächlich verschiedene Interessen oder werden ihnen diese aufgezwungen?
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitende Bemerkungen
- 2 Die Bedeutung von Gender
- 2.1 Definition
- 2.2 Aktueller Stand der Geschlechterforschung
- 3 Geschlechtsunterschiede in der Schule
- 3.1 Politische Maßnahmen
- 3.2 Mädchen und Jungenförderung
- 3.2.1 Mädchenförderung
- 3.2.2 Jungenförderung
- 3.3 Koedukation oder Monoedukation
- 3.3.1 Historische Entwicklung
- 3.3.2 Argumentation
- 4 Gendersensibler Unterricht im Kreativfach Bildnerische Erziehung
- 4.1 Der Lehrplan
- 4.2 Unterrichtsbeispiele für einen gelingenden BE Unterricht
- 4.2.1 Die Kunstwerkstatt
- 4.2.2 Vom Stock zum Turm
- 4.2.3 Es klappert und klingt
- 4.2.4 XXL- Totempfähle
- 4.2.5 Weißes Papier
- 5 Empirische Untersuchungen
- 5.1 Untersuchungsmethoden
- 5.1.1 Qualitative Forschung
- 5.1.2 Aktionsforschung
- 5.1.3 Bildanalyse nach Roland Barthes
- 5.2 Forschungsfragen
- 5.3 Durchführung der Untersuchung
- 5.3.1 Untersuchungsrahmen
- 5.4 Ergebnisse und Interpretation
- 5.4.1 Ergebnisse zum Thema „Das ist meine Traumwelt“
- 5.4.2 Ergebnisse „Wer oder was ist dein Supervorbild?“
- 5.1 Untersuchungsmethoden
- 6 Resümee und pädagogische Konsequenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Implementierung gendersensiblen Unterrichts im Fach Bildnerische Erziehung an der Grundschule. Ziel ist es, die Bedeutung von Gender im schulischen Kontext zu beleuchten und praktische Beispiele für einen inklusiven Unterricht zu präsentieren. Die Arbeit analysiert existierende Geschlechterunterschiede im Lernverhalten und in der künstlerischen Umsetzung von Aufgaben. Die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung an Grundschülern werden vorgestellt und interpretiert.
- Gender und Geschlechterrollen im Bildungssystem
- Geschlechtsunterschiede im Lernverhalten und in der künstlerischen Gestaltung
- Gendersensible Didaktik im Fach Bildnerische Erziehung
- Analyse von Schülerarbeiten im Hinblick auf Genderaspekte
- Pädagogische Konsequenzen für einen inklusiven Kunstunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitende Bemerkungen: Die Arbeit beginnt mit einer persönlichen Einleitung der Autorin, die ihre Beobachtungen zu Verhaltensunterschieden zwischen Mädchen und Jungen in ihrem Umfeld beschreibt und die Frage nach der Berücksichtigung dieser Unterschiede im Unterricht aufwirft. Sie kritisiert den oft starren und wenig kreativen Kunstunterricht, der die individuellen Fähigkeiten der Kinder nicht ausreichend fördert und plädiert für einen gendersensiblen Ansatz, der freie Themenwahl und individuelle Gestaltung ermöglicht.
2 Die Bedeutung von Gender: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Gender" im Unterschied zu "Sex" und beleuchtet den aktuellen Stand der Geschlechterforschung. Es werden Thesen vorgestellt, die die Komplexität des Geschlechterverhaltens und die Bedeutung der sozialen Prozesse hervorheben. Die Arbeit betont die Notwendigkeit, geschlechtsspezifische Vorurteile und Benachteiligungen im Bildungssystem zu überwinden.
3 Geschlechtsunterschiede in der Schule: Dieses Kapitel analysiert geschlechtsspezifische Unterschiede in schulischen Leistungen und im Lernverhalten von Mädchen und Jungen, basierend auf Studien wie PISA und Eurydice. Es werden die Ergebnisse zu Lesekompetenz, Mathematik und Naturwissenschaften diskutiert und die Bedeutung der Attributionstheorie für die Interpretation von Erfolg und Misserfolg beleuchtet. Politische Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter in der Schule werden vorgestellt und kritisch bewertet.
4 Gendersensibler Unterricht im Kreativfach Bildnerische Erziehung: Der Lehrplan der Bildnerischen Erziehung wird vorgestellt und Beispiele für einen gelingenden, gendersensiblen Unterricht präsentiert. Die Autorin beschreibt verschiedene Unterrichtskonzepte, die kreative Prozesse fördern und geschlechtsstereotype Themen vermeiden. Die Beispiele umfassen Werkstattmethoden, Arbeiten mit Naturmaterialien, Klangmaschinen, Totempfähle und Arbeiten mit weißem Papier.
5 Empirische Untersuchungen: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung, die sowohl qualitative als auch aktionsforschende Elemente umfasst. Die Autorin erläutert ihre Forschungsfragen und die angewandte Methode der Bildanalyse nach Roland Barthes. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen an zwei vierten Klassen werden präsentiert und interpretiert. Sie analysiert die Schülerarbeiten unter Berücksichtigung von Motivwahl, Farbgestaltung und der Anwendung der "studium" und "punctum"-Konzepte nach Barthes.
Schlüsselwörter
Gendersensibler Unterricht, Bildnerische Erziehung, Grundschule, Geschlechterunterschiede, Koedukation, Schülerarbeiten, Bildanalyse, Qualitative Forschung, Geschlechterrollen, Gleichstellung.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Gendersensibler Unterricht im Fach Bildnerische Erziehung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Implementierung gendersensiblen Unterrichts im Fach Bildnerische Erziehung an der Grundschule. Sie beleuchtet die Bedeutung von Gender im schulischen Kontext und präsentiert praktische Beispiele für einen inklusiven Unterricht. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse existierender Geschlechterunterschiede im Lernverhalten und in der künstlerischen Umsetzung von Aufgaben anhand einer empirischen Untersuchung.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung von Gender im schulischen Kontext aufzuzeigen, praktische Beispiele für gendersensiblen Unterricht im Fach Bildnerische Erziehung zu liefern und die Ergebnisse einer empirischen Untersuchung an Grundschülern zu präsentieren und zu interpretieren. Es geht darum, geschlechtsspezifische Vorurteile und Benachteiligungen im Bildungssystem zu überwinden und einen inklusiveren Kunstunterricht zu fördern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Gender und Geschlechterrollen im Bildungssystem, Geschlechtsunterschiede im Lernverhalten und in der künstlerischen Gestaltung, gendersensible Didaktik im Fach Bildnerische Erziehung, Analyse von Schülerarbeiten im Hinblick auf Genderaspekte und pädagogische Konsequenzen für einen inklusiven Kunstunterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Bedeutung von Gender, Geschlechtsunterschiede in der Schule, gendersensibler Unterricht in der Bildnerischen Erziehung, empirische Untersuchungen und Resümee mit pädagogischen Konsequenzen. Jedes Kapitel beinhaltet detaillierte Unterpunkte, die im Inhaltsverzeichnis ersichtlich sind.
Welche Methoden wurden in der empirischen Untersuchung angewendet?
Die empirische Untersuchung kombiniert qualitative und aktionsforschende Methoden. Die Autorin verwendet die Bildanalyse nach Roland Barthes, um Schülerarbeiten zu analysieren und interpretieren. Die Forschungsfragen konzentrieren sich auf die Analyse von Motivwahl, Farbgestaltung und der Anwendung der "studium" und "punctum"-Konzepte nach Barthes.
Welche Ergebnisse wurden in der empirischen Untersuchung erzielt?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung an zwei vierten Klassen. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Forschungsfragen interpretiert und analysiert, unter anderem zu den Themen "Das ist meine Traumwelt" und "Wer oder was ist dein Supervorbild?". Die detaillierten Ergebnisse sind im Kapitel 5 zu finden.
Welche pädagogischen Konsequenzen werden gezogen?
Die Arbeit zieht pädagogische Konsequenzen für einen inklusiven Kunstunterricht, der gendersensible Aspekte berücksichtigt. Konkrete Vorschläge für die Praxis werden im Resümee-Kapitel formuliert, basierend auf den Ergebnissen der empirischen Untersuchung und der theoretischen Auseinandersetzung mit Gender und Geschlechterrollen im Bildungssystem.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gendersensibler Unterricht, Bildnerische Erziehung, Grundschule, Geschlechterunterschiede, Koedukation, Schülerarbeiten, Bildanalyse, Qualitative Forschung, Geschlechterrollen, Gleichstellung.
- Arbeit zitieren
- Silvia Simic (Autor:in), 2017, Gendersensibler BE-Unterricht in der Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/377614