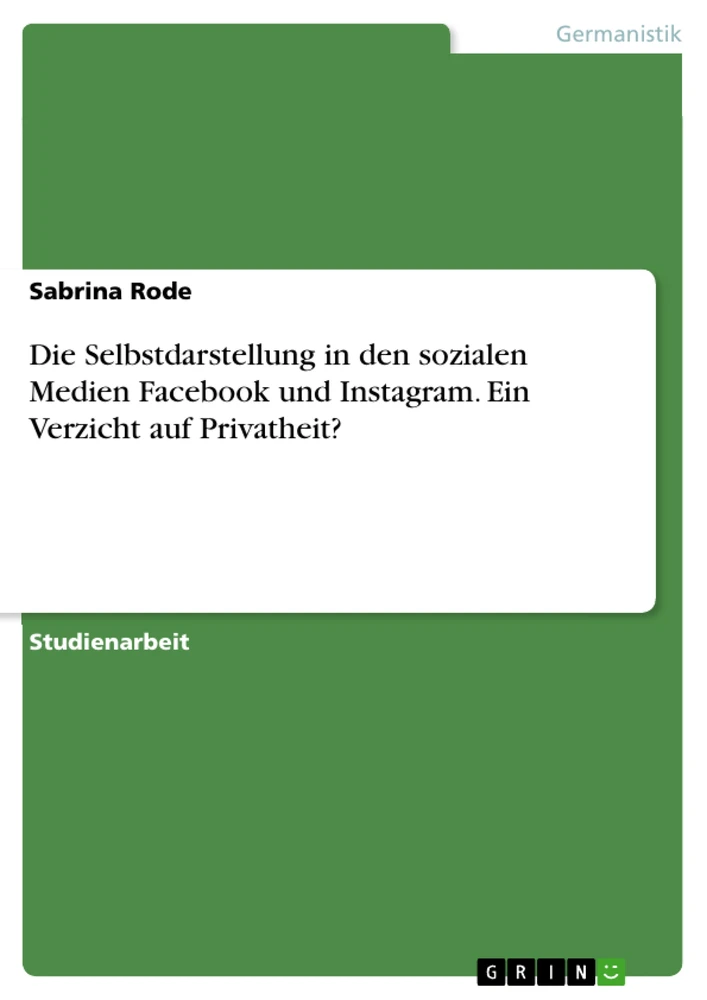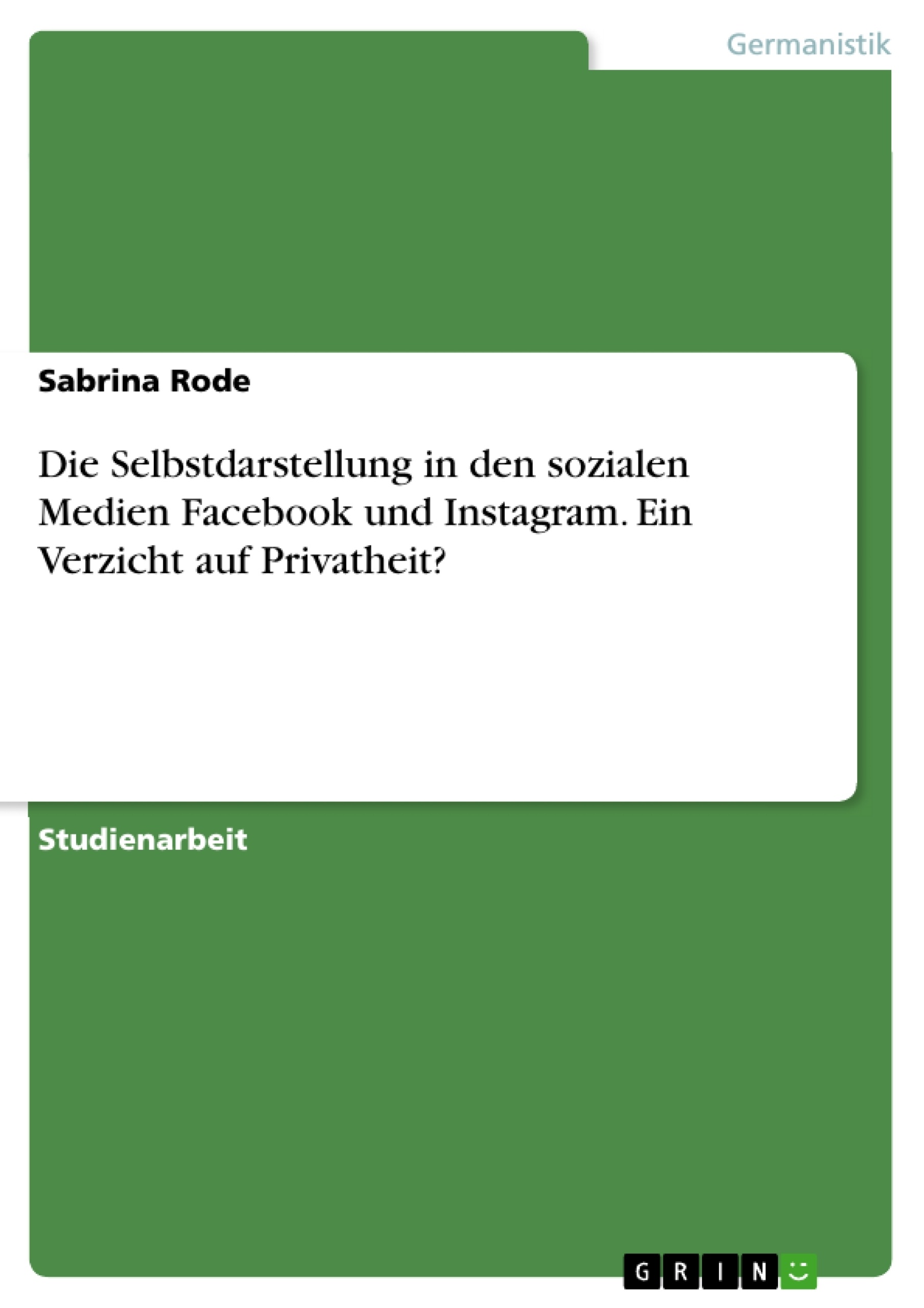Der Fokus der vorliegenden Arbeit wird auf der Selbstdarstellung der Nutzer in den Online-Netzwerken Facebook und Instagram liegen, sodass zunächst einmal die Funktionen, welche diese sowohl zur Selbstdarstellung, als auch zur Privatheitsregulierung anbieten, vorgestellt werden. In einer abschließenden Diskussion wird die im Titel gestellte Eingangsfrage geklärt und weiter erläutert, ob anhand der vorgestellten Theorien und Konzepte tatsächlich beurteilt werden kann, wie sich die Selbstdarstellung in den untersuchten Plattformen auf die Privatheit eines Menschen auswirkt.
Rund 1,23 Milliarden Menschen weltweit nutzten das Social Media-Netzwerk ‚Facebook‘ im Jahr 2016 täglich, die zum Facebook-Konzern gehörende Plattform‚ Instagram‘ verzeichnete 600 Millionen Nutzer. Im Fall von Facebook ist also rund ein Siebtel der Menschheit gewillt, online private Informationen über sich preiszugeben, denn eine erfolgreiche Nutzung dieser Plattformen setzt dies voraus. Die Steuerung der Privatsphäre ist dabei jedoch nicht nur von der Individualität einer Person, sondern auch vom Kulturkreis abhängig, dem diese angehört. Daraus kann man schließen, dass es differierende Bedürfnisse nach Privatheit, als auch unterschiedlich ausgeprägte Bereitschaften zur Selbstdarstellung und Selbstenthüllung geben muss.
Welchen Stellenwert die Privatheit im Zuge der Selbstdarstellung im europäischen Kulturkreis hat und ob die Darstellung auf Online-Profilen einen Verzicht auf Privatheit bedeutet, soll im Laufe dieser Arbeit geklärt werden. Dazu werden zunächst verschiedene Konzepte zur Privatheit vorgestellt werden, um ein grundlegendes Verständnis für die Thematik aufzubauen, im Anschluss werden die Termini ‚Selbstdarstellung‘ und ‚Selbstenthüllung‘ genauer definiert. Im darauffolgenden Kapitel liegt der Fokus auf unterschiedlichen Selbstdarstellungsstrategien im Zuge der Privatheit nach Erving Goffman, da diese eine bestmögliche Verknüpfung der bisherigen Grundlagenkenntnisse zur Privatheit und zur Selbstdarstellung bieten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Konzept der Privatheit
- 2.1 Definition
- 2.2 Funktionen und Dimensionen individueller Privatheit
- 3. Selbstdarstellung: Definition
- 4. Privatheit im Kontext der Selbstdarstellung: Gestaltungsstrategien individueller Privatheit nach Erving Goffmann
- a) Privatheit als Ausgangspunkt von Selbstdarstellung
- b) Privatheit als Bestandteil des Identitätsmanagements
- c) Privatheit als Ziel des Identitätsmanagements
- 5. Selbstdarstellung auf Facebook und Instagram
- 5.1 Funktionen zur Selbstdarstellung
- a) Facebook
- b) Instagram
- 5.2 Funktionen zur Regulierung der Privatheit
- a) Facebook
- b) Instagram
- 5.3 Gründe für die Nutzung sozialer Netzwerke
- 6. Diskussion
- 7. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Stellenwert von Privatheit im Kontext von Selbstdarstellung in sozialen Medien, insbesondere auf Facebook und Instagram. Sie analysiert, ob die Nutzung dieser Plattformen zwangsläufig einen Verzicht auf Privatheit bedeutet. Die Arbeit stützt sich auf bestehende Theorien zur Privatheit und Selbstdarstellung, um die komplexen Zusammenhänge zwischen online geteilten Informationen und dem individuellen Bedürfnis nach Privatsphäre zu beleuchten.
- Das Konzept der Privatheit und seine verschiedenen Definitionen
- Selbstdarstellung als strategischer Prozess im Umgang mit Privatheit
- Funktionen von sozialen Medien für Selbstdarstellung und Privatheitsregulierung
- Differenzierte Betrachtung der Privatheitseinstellungen auf Facebook und Instagram
- Der Einfluss kultureller Faktoren auf das Verständnis von Privatheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem Verhältnis von Privatheit und Selbstdarstellung in sozialen Medien vor dem Hintergrund der hohen Nutzerzahlen von Facebook und Instagram. Sie umreißt den methodischen Ansatz der Arbeit, der auf der Analyse von Konzepten der Privatheit und Selbstdarstellung sowie der Funktionen sozialer Netzwerke basiert. Die Arbeit verfolgt das Ziel, zu klären, ob die Online-Selbstdarstellung einen Verzicht auf Privatheit impliziert und wie sich dies im europäischen Kulturkreis darstellt.
2. Das Konzept der Privatheit: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Verständnis von Privatheit. Es leitet den Begriff etymologisch her und unterscheidet zwischen privatem und öffentlichem Raum. Es beleuchtet Privatheit als gesetzlich verankertes Menschenrecht und diskutiert die verschiedenen Dimensionen und Funktionen individueller Privatheit, wie z.B. Autonomie, emotionales Loslassen, Selbstreflexion und den Schutz von Informationen, basierend auf den Ausführungen von Westin. Die Kapitel erläutert, dass Privatheit dynamisch und individuell ausgelegt ist und die Kontrolle über den persönlichen Lebensraum und den Zugang zu Informationen beinhaltet.
3. Selbstdarstellung: Definition: Dieses Kapitel widmet sich der Definition des Begriffs Selbstdarstellung. Es wird eine klare Abgrenzung zu anderen relevanten Begriffen vorgenommen. Hier wird der theoretische Rahmen geschaffen für das Verständnis der Selbstdarstellung in sozialen Medien. Dieser Abschnitt dient zur Vorbereitung der Analyse der Selbstdarstellung in den sozialen Medien.
4. Privatheit im Kontext der Selbstdarstellung: Gestaltungsstrategien individueller Privatheit nach Erving Goffmann: Dieses Kapitel untersucht die Interaktion von Privatheit und Selbstdarstellung nach Goffmann. Es beleuchtet, wie Privatheit als Ausgangspunkt, Bestandteil und Ziel des Identitätsmanagements in der Selbstdarstellung fungiert. Das Kapitel analysiert verschiedene Strategien, die Individuen zur Regulierung ihrer Privatheit im Kontext der Selbstdarstellung anwenden. Es wird untersucht, inwiefern die Privatheit in den Gestaltungsstrategien eine Rolle spielt und wie diese Strategien die Präsentation des Selbst in der Öffentlichkeit beeinflussen. Die Kapitel versucht, ein Gesamtbild zu schaffen, welches zeigt, wie Individuen durch gezielte Selbstdarstellung ihre Privatsphäre steuern.
5. Selbstdarstellung auf Facebook und Instagram: Dieses Kapitel analysiert die Funktionen von Facebook und Instagram sowohl für Selbstdarstellung als auch für die Regulierung der Privatheit. Es werden die spezifischen Möglichkeiten der Plattformen untersucht, um das eigene Selbst darzustellen und gleichzeitig die Privatsphäre zu kontrollieren. Es werden konkrete Beispiele für die Möglichkeiten der Selbstdarstellung und der Privatheitseinstellungen auf beiden Plattformen genannt. Die Untersuchung beinhaltet auch die Gründe, warum Nutzer soziale Netzwerke für Selbstdarstellung nutzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Privatheit und Selbstdarstellung in sozialen Medien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Privatheit und Selbstdarstellung in sozialen Medien, insbesondere auf Facebook und Instagram. Sie analysiert, ob die Nutzung dieser Plattformen zwangsläufig einen Verzicht auf Privatheit bedeutet und beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen online geteilten Informationen und dem individuellen Bedürfnis nach Privatsphäre.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt das Konzept der Privatheit mit verschiedenen Definitionen, Selbstdarstellung als strategischen Prozess im Umgang mit Privatheit, die Funktionen sozialer Medien für Selbstdarstellung und Privatheitsregulierung, die Privatheitseinstellungen auf Facebook und Instagram, und den Einfluss kultureller Faktoren auf das Verständnis von Privatheit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Das Konzept der Privatheit, Selbstdarstellung: Definition, Privatheit im Kontext der Selbstdarstellung nach Goffmann, Selbstdarstellung auf Facebook und Instagram, Diskussion und Quellenverzeichnis. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit der Einführung des Themas und der Forschungsfrage, über die theoretischen Grundlagen bis hin zur Analyse von Facebook und Instagram und abschließender Diskussion.
Wie wird Privatheit in der Arbeit definiert?
Privatheit wird als dynamischer und individuell ausgelegter Begriff verstanden, der die Kontrolle über den persönlichen Lebensraum und den Zugang zu Informationen beinhaltet. Es wird auf verschiedene Dimensionen und Funktionen individueller Privatheit eingegangen, wie Autonomie, emotionales Loslassen, Selbstreflexion und den Schutz von Informationen.
Welche Rolle spielt Erving Goffmann in der Arbeit?
Goffmanns Theorie wird genutzt, um die Interaktion von Privatheit und Selbstdarstellung zu untersuchen. Die Arbeit analysiert, wie Privatheit als Ausgangspunkt, Bestandteil und Ziel des Identitätsmanagements in der Selbstdarstellung fungiert und welche Strategien Individuen zur Regulierung ihrer Privatheit anwenden.
Wie werden Facebook und Instagram in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Funktionen von Facebook und Instagram für Selbstdarstellung und Privatheitsregulierung. Es werden die spezifischen Möglichkeiten der Plattformen untersucht, das eigene Selbst darzustellen und gleichzeitig die Privatsphäre zu kontrollieren. Konkrete Beispiele für Selbstdarstellung und Privatheitseinstellungen werden genannt, und die Gründe für die Nutzung sozialer Netzwerke zur Selbstdarstellung werden untersucht.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwieweit impliziert Online-Selbstdarstellung einen Verzicht auf Privatheit, insbesondere im europäischen Kulturkreis, und wie gestaltet sich das Verhältnis von Privatheit und Selbstdarstellung in sozialen Medien wie Facebook und Instagram?
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit basiert auf der Analyse von Konzepten der Privatheit und Selbstdarstellung sowie der Funktionen sozialer Netzwerke. Es wird eine theoretische Analyse bestehender Theorien und Konzepte durchgeführt, um die komplexen Zusammenhänge zwischen online geteilten Informationen und dem individuellen Bedürfnis nach Privatsphäre zu beleuchten.
- Quote paper
- Sabrina Rode (Author), 2017, Die Selbstdarstellung in den sozialen Medien Facebook und Instagram. Ein Verzicht auf Privatheit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/374837