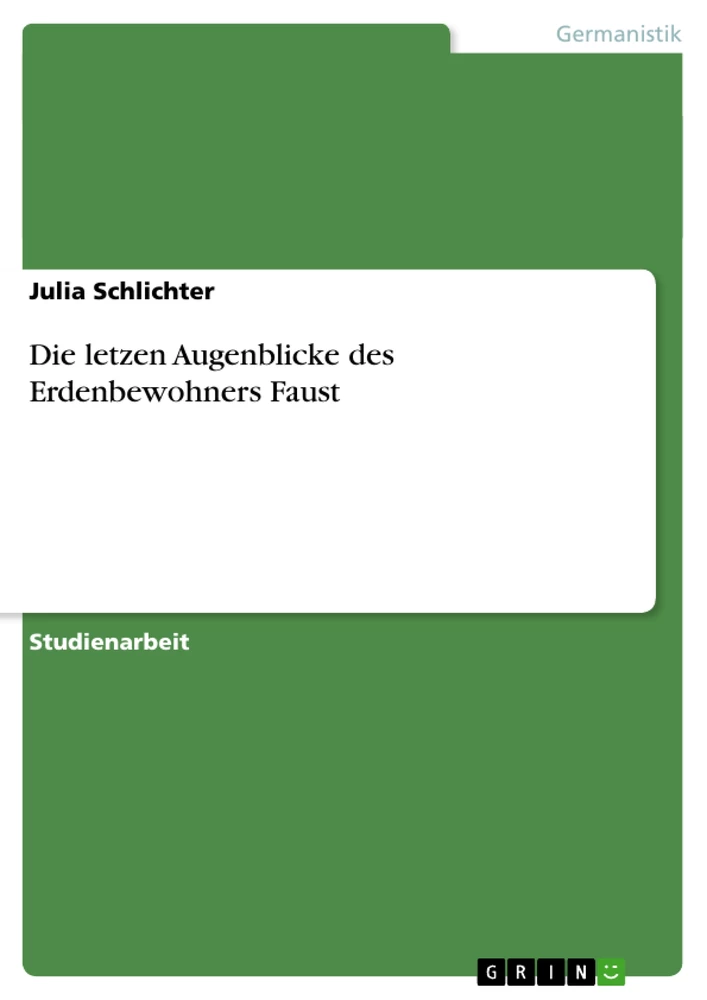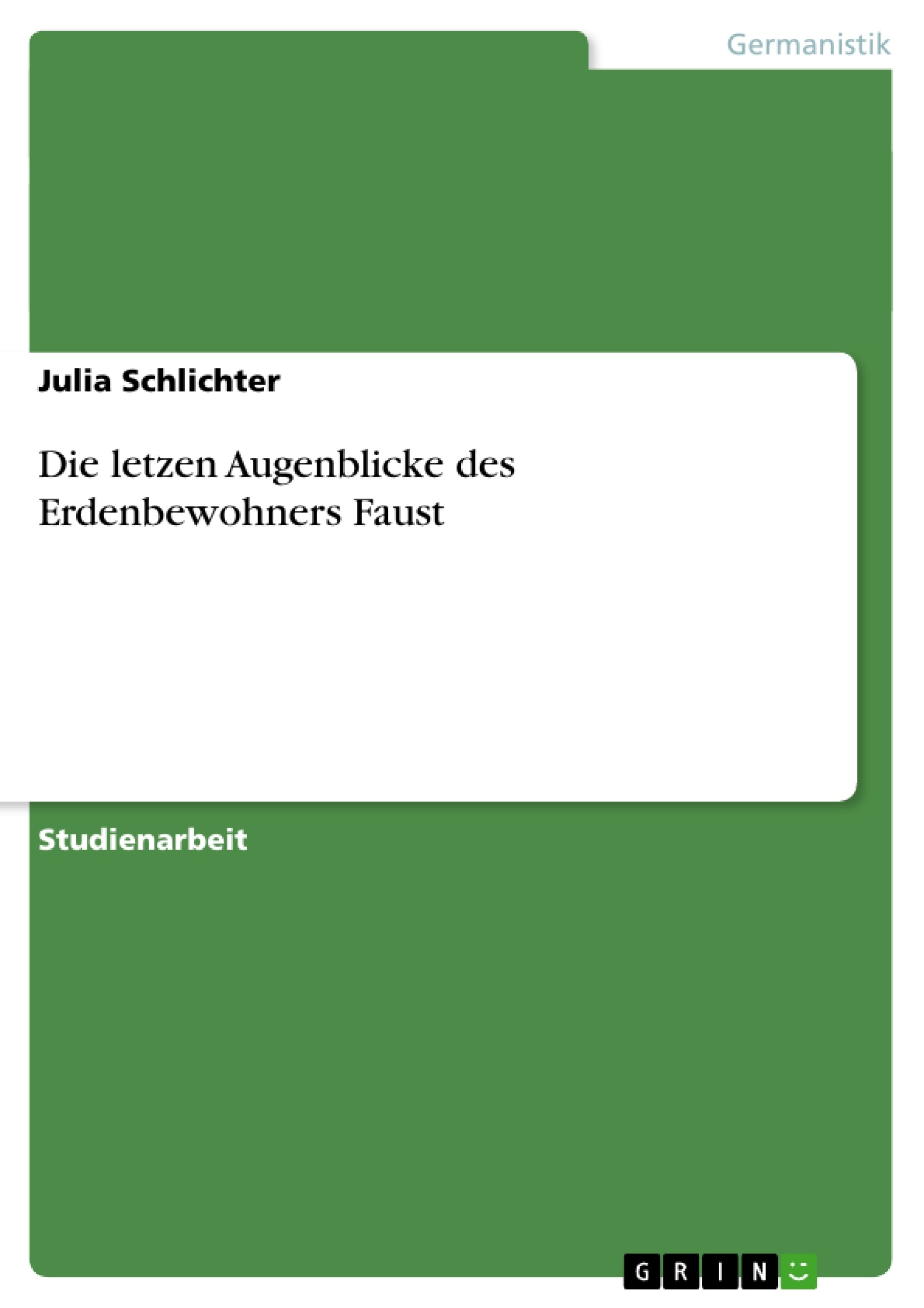Johann Wolfgang von Goethes „Faust“ berichtet von den Erfahrungen und Erlebnissen eines Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen, angefangen von seinen jugendlichen Seinszuständen bis hin zu den Entscheidungen über seine Seele. Als Hintergrund steht hierbei eine Wette zwischen dem „Herrn“ im Himmel und dem Teufel „Mephistopheles“, in der es um das Wesen der Menschen am Beispiel von Faust geht. In der vorliegenden Arbeit soll das Ende des Individuums Faust genauer betrachtet werden. Zur Erörterung der hierbei auftretenden Themen dienen vier wissenschaftliche Texte als Grundlage:
1. Hans Arens „Kommentar zu Goethes Faust II“
2. Günther Mieth „Fausts letzter Monolog – poetische Struktur einer geschichtlichen Vision“
3. Wilhelm Emrich „Die Schichtung des 5. Akts – Schuld, Sorge, Magie und inneres Licht im Aufriß der ersten Szenen und ihre Bedeutung für das Gesamtproblem der Faustischen Rettung“
4. Jochen Schmidt „Die Sorge als Melancholie in der fortschreitenden Zivilisation“
Nach der Untersuchung des „Anfangs vom Ende“, nämlich der Erblindung Fausts, werden hauptsächlich der Schlussmonolog der Hauptfigur und die darin enthaltenen Themen beurteilt. Somit werden die letzten Augenblicke des auf der Erde weilenden Faust analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Inhalt der behandelten Szenen „Mitternacht“ und „Großer Vorhof des Palasts“
- Schuld, Sorge und die Erblindung Fausts
- Faust und die Gemeinschaft
- Das Verhältnis von Faust und Mephistopheles
- Die Naturmetaphorik
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die letzten Augenblicke Fausts in Goethes Werk, fokussiert auf den Schlussmonolog und die damit verbundenen Themen. Dabei werden verschiedene wissenschaftliche Interpretationen herangezogen und verglichen, um ein umfassendes Verständnis des Endes zu entwickeln.
- Fausts Erblindung und deren unterschiedliche Interpretationen
- Das Verhältnis Fausts zur Gemeinschaft und die Frage nach seinem Humanismus
- Die Entwicklung der Beziehung zwischen Faust und Mephistopheles
- Die Rolle der Naturmetaphorik und ihre symbolische Bedeutung
- Die Frage nach Fausts letztendlichem Seelenheil
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Diese Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor: die Analyse der letzten Augenblicke Fausts in Goethes Werk. Sie benennt die vier wissenschaftlichen Texte, die als Grundlage für die Untersuchung dienen und umreißt den methodischen Ansatz der Arbeit.
Inhalt der behandelten Szenen „Mitternacht“ und „Großer Vorhof des Palasts“: Die Zusammenfassung beschreibt die Szenen „Mitternacht“ und „Großer Vorhof des Palasts“. In „Mitternacht“ begegnet Faust der Sorge, die ihn erblinden lässt. In der folgenden Szene glaubt Faust, seine Befehle zur Vollendung seines Werkes würden ausgeführt, tatsächlich bereiten Lemuren unter Mephistos Anweisung sein Grab vor. Faust formuliert seine letzten Worte, bevor er stirbt.
Schuld, Sorge und die Erblindung Fausts: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Schuld und Sorge in Fausts letzten Stunden und die Bedeutung seiner Erblindung. Es werden verschiedene Interpretationen gegenübergestellt: Emrich sieht die Erblindung als positiv, da sie Faust von der destruktiven Realität fernhält und ihm den Weg zum „inneren Licht“ ebnet. Arens und Schmidt sehen die Erblindung eher negativ als Vorzeichen des Todes und als Zeichen von Realitätsblindheit beziehungsweise als Folge von Besessenheit.
Faust und die Gemeinschaft: Dieses Kapitel untersucht Fausts Verhältnis zur Gemeinschaft. Die Interpretationen divergieren: Arens und Mieth sehen einen Wandel hin zu einer gewissen Form von Gemeinschaftsdenken, Schmidt hingegen interpretiert Fausts scheinbares soziales Engagement als letztendliche Selbstbeseligung. Die Analyse beleuchtet die Widersprüchlichkeit zwischen Fausts egoistischen Zielen und seinem scheinbaren Streben nach einem freien Volk.
Das Verhältnis von Faust und Mephistopheles: Hier wird die sich verändernde Beziehung zwischen Faust und Mephistopheles am Ende des Dramas analysiert. Faust erkennt, dass er sein Leben mit Mephisto verschwendet hat und versucht, sein Werk ohne Magie zu vollenden. Trotzdem ist er von Mephisto abhängig. Mephisto zeigt sich schadenfroh und bereitet Fausts Untergang vor.
Die Naturmetaphorik: In diesem Kapitel wird die Verwendung von Naturmetaphorik in den Schlussszenen untersucht. Die Natur wird als metaphysische Kraft interpretiert, die sowohl gesellschaftliche als auch existenzielle Aspekte repräsentiert. Die Deutungen variieren von einem Kampf gegen die Naturgewalten bis hin zu einem symbolischen Kampf zwischen Fausts innerem Licht und den zerstörerischen Kräften der Welt.
Schlüsselwörter
Goethes Faust, Schlussmonolog, Erblindung, Schuld, Sorge, Gemeinschaft, Mephistopheles, Naturmetaphorik, Interpretation, Humanismus, Seelenheil, Ironie, Utopie.
Goethes Faust: Analyse der Schlussszenen - FAQ
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die letzten Augenblicke Fausts in Goethes Werk, insbesondere den Schlussmonolog und die damit verbundenen Themen. Sie vergleicht verschiedene wissenschaftliche Interpretationen, um ein umfassendes Verständnis des Endes zu entwickeln.
Welche Szenen werden im Detail untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Szenen „Mitternacht“ und „Großer Vorhof des Palasts“, in denen Fausts Erblindung, sein Verhältnis zu Mephistopheles und seine letzten Worte im Mittelpunkt stehen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Fausts Erblindung und deren unterschiedliche Interpretationen, sein Verhältnis zur Gemeinschaft und die Frage nach seinem Humanismus, die Entwicklung der Beziehung zwischen Faust und Mephistopheles, die Rolle der Naturmetaphorik und ihre symbolische Bedeutung sowie die Frage nach Fausts letztendlichem Seelenheil.
Wie wird die Erblindung Fausts interpretiert?
Die Interpretation der Erblindung Fausts ist unterschiedlich. Emrich sieht sie positiv als Weg zum „inneren Licht“, während Arens und Schmidt sie negativ als Vorzeichen des Todes oder als Zeichen von Realitätsblindheit interpretieren.
Wie wird Fausts Verhältnis zur Gemeinschaft dargestellt?
Fausts Verhältnis zur Gemeinschaft wird kontrovers diskutiert. Arens und Mieth sehen einen Wandel hin zu Gemeinschaftsdenken, während Schmidt sein soziales Engagement als Selbstbeseligung interpretiert. Die Widersprüchlichkeit zwischen Fausts egoistischen Zielen und seinem scheinbaren Streben nach einem freien Volk wird beleuchtet.
Wie entwickelt sich die Beziehung zwischen Faust und Mephistopheles?
Am Ende des Dramas erkennt Faust seine Abhängigkeit von Mephistopheles und die Verschwendung seines Lebens. Mephistopheles hingegen zeigt sich schadenfroh und bereitet Fausts Untergang vor.
Welche Rolle spielt die Naturmetaphorik?
Die Naturmetaphorik wird als metaphysische Kraft interpretiert, die gesellschaftliche und existenzielle Aspekte repräsentiert. Die Interpretationen reichen von einem Kampf gegen Naturgewalten bis hin zu einem symbolischen Kampf zwischen Fausts innerem Licht und zerstörerischen Kräften.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethes Faust, Schlussmonolog, Erblindung, Schuld, Sorge, Gemeinschaft, Mephistopheles, Naturmetaphorik, Interpretation, Humanismus, Seelenheil, Ironie, Utopie.
Welche wissenschaftlichen Texte dienen als Grundlage?
Die Arbeit benennt vier wissenschaftliche Texte als Grundlage der Untersuchung, jedoch werden diese nicht explizit im HTML-Code genannt.
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen vergleichenden Ansatz, indem verschiedene wissenschaftliche Interpretationen der Schlussszenen herangezogen und analysiert werden.
- Quote paper
- Julia Schlichter (Author), 2004, Die letzen Augenblicke des Erdenbewohners Faust, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/37480