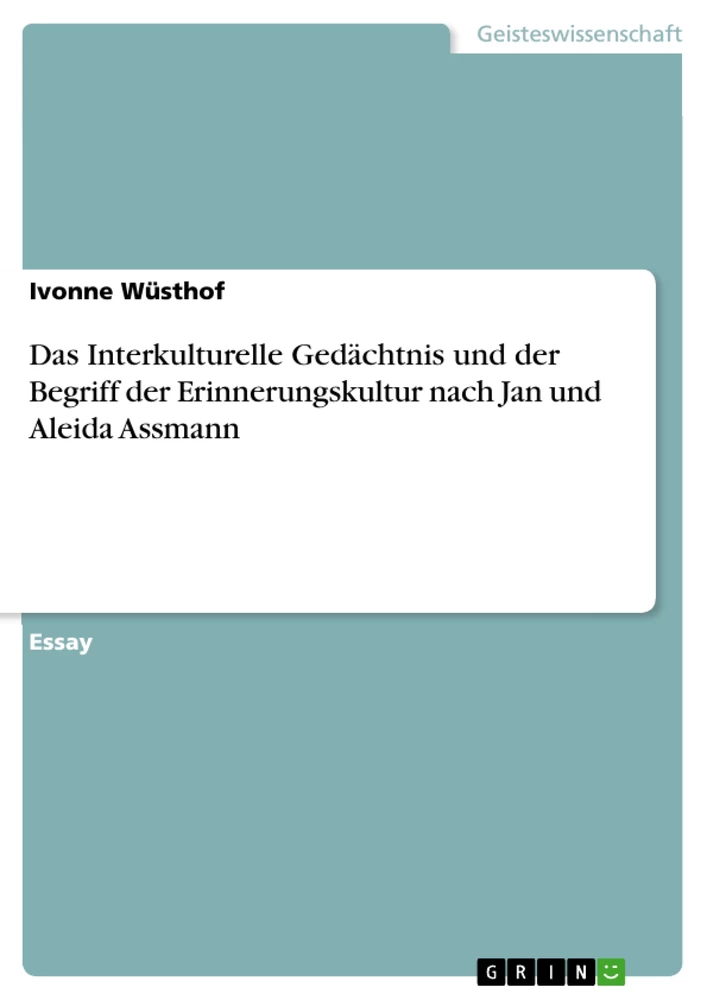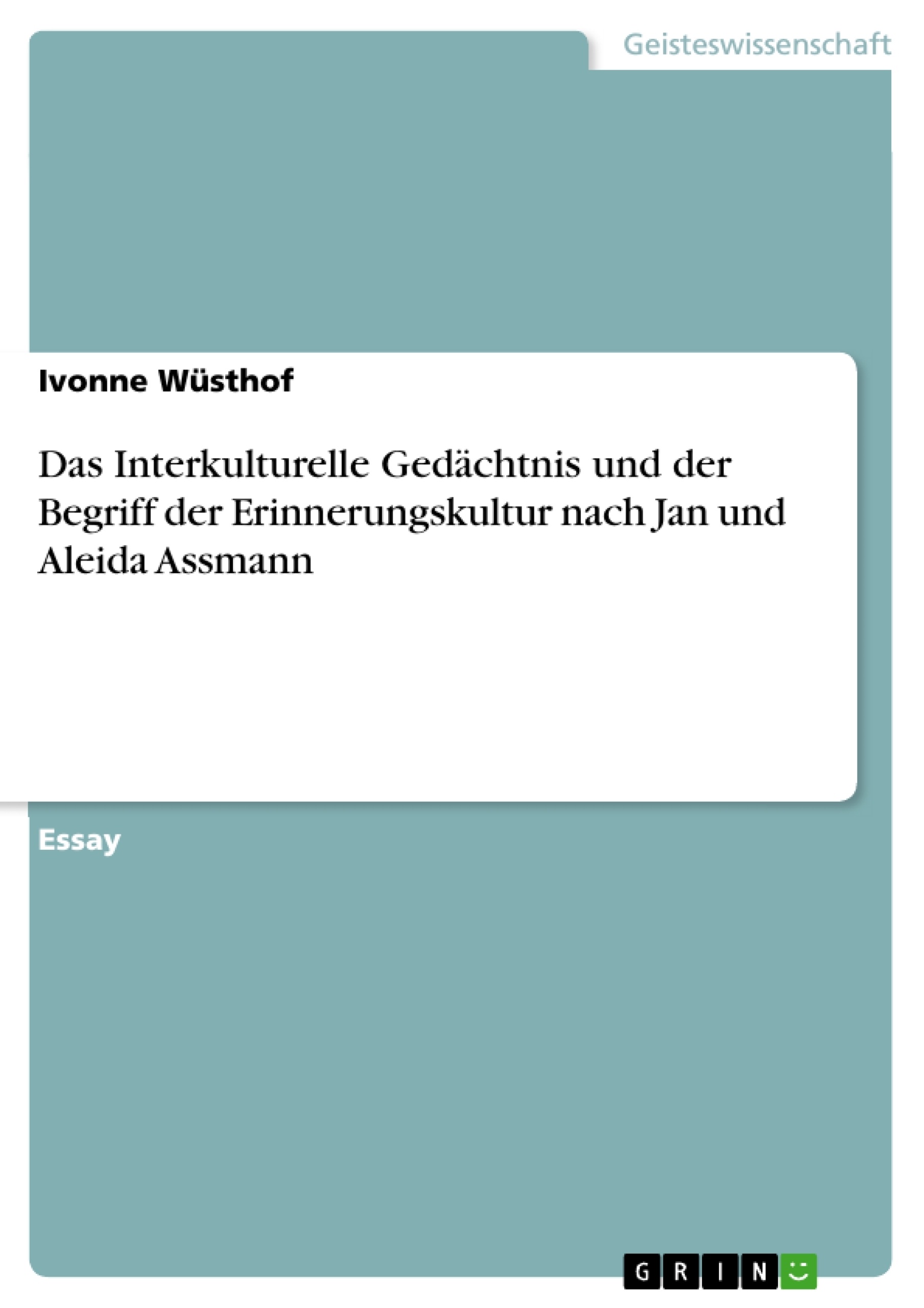Dieser Essay bezieht sich auf die die Kulturwissenschaftler Jan und Aleida Assmann, die in den letzten Jahren den Begriff des Kulturellen Gedächtnisses geprägt haben. Mit einem kurzen Blick auf das kulturelle Gedächtnis, wird der Transfer auf ein interkulturelles Gedächtnis vollzogen.
Hierzu wird ein praktisches und aktuelles Beispiel der deutsch-französischen Beziehungen, die seit Jahrhunderten immer wieder durch Konflikte geprägt ist, hinzugezogen werden. Nach einer kurzen Thematisierung des kulturellen Gedächtnisses im Assmann’schen Sinne soll eine Weiterführung des kulturellen Gedächtnisses auf ein interkulturelles Gedächtnis stattfinden.
Der Begriff „Erinnerungskultur“ nimmt seit einigen Jahren eine stetig größer werdende Rolle innerhalb politischer, historischer und auch gesellschaftlicher Diskurse sein. Besonderen Gebrauch erfährt in den Diskursen der Erinnerungskultur der Begriff des kulturellen Gedächtnisses. .Aleida Assmann nimmt in ihrer „Einführung in die Kulturwissenschaft“ (2011) eine wichtige terminologische Unterscheidung zwischen den Ausdrücken „Erinnerung“ und „Gedächtnis“ vor. Die semantischen Differenzen zeigen sich schon in den dazugehörigen Verben.
Inhaltsverzeichnis
- Der Begriff „Erinnerungskultur“
- Kulturelles Gedächtnis nach Assmann
- Ich-Gedächtnis und Mich-Gedächtnis
- Episodisches, Semantisches und Prozedurales Gedächtnis
- Speichergedächtnis und Funktionsgedächtnis
- Kollektives Gedächtnis
- Interkulturelles Gedächtnis
- Städtepartnerschaft Verden/Aller und Saumur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff des interkulturellen Gedächtnisses, ausgehend von der Konzeption des kulturellen Gedächtnisses nach Jan und Aleida Assmann. Ziel ist es, das Konzept des interkulturellen Gedächtnisses zu definieren und anhand eines praktischen Beispiels – der Städtepartnerschaft Verden/Saumur – zu veranschaulichen. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss von Geschichte und Erinnerung auf die Gestaltung interkultureller Beziehungen.
- Das kulturelle Gedächtnis nach Assmann
- Die Unterscheidung zwischen Erinnerung und Gedächtnis
- Die verschiedenen Formen des Gedächtnisses (Ich-, Mich-, episodisch, semantisch, prozedural)
- Das Konzept des kollektiven Gedächtnisses
- Die Definition und Anwendung des interkulturellen Gedächtnisses
Zusammenfassung der Kapitel
Der Begriff „Erinnerungskultur“: Der Text beginnt mit einer Einführung in den Begriff „Erinnerungskultur“ und seiner Bedeutung in politischen, historischen und gesellschaftlichen Diskursen. Er beschreibt die Auseinandersetzung von Individuen und Kollektiven mit ihrer Vergangenheit und Geschichte, wobei der Begriff des kulturellen Gedächtnisses eine zentrale Rolle spielt.
Kulturelles Gedächtnis nach Assmann: Dieser Abschnitt erläutert die Definition des kulturellen Gedächtnisses nach Jan und Aleida Assmann. Die Arbeit hebt die Unterscheidung zwischen „Erinnerung“ (aktuelle Handlung des Zurückblickens) und „Gedächtnis“ (zeitinvarianter Speicher) hervor und diskutiert die Instabilität von Erinnerungen und deren Rekonstruktion im Kontext der Geschichtswissenschaft. Die Unterscheidung zwischen Ich-Gedächtnis und Mich-Gedächtnis, sowie die verschiedenen Gedächtnisformen (episodisch, semantisch, prozedural) aus psychologischer Perspektive werden ebenfalls vorgestellt. Schließlich wird die Unterscheidung zwischen Speichergedächtnis und Funktionsgedächtnis erläutert. Der Abschnitt legt den Grundstein für die spätere Betrachtung des interkulturellen Gedächtnisses.
Interkulturelles Gedächtnis: Dieser Abschnitt widmet sich der Definition und Erläuterung des interkulturellen Gedächtnisses. Da es keine allgemeingültige Definition gibt, wird der Begriff aus interaktionistischer Sicht betrachtet. Interkulturelles Gedächtnis wird als das Gedächtnis einer Wir-Gruppe mit Angehörigen verschiedener Kulturen definiert, die einen gemeinsamen Wissens- und Geschichtsfundus über Generationen hinweg teilen. Die Komplexität und Vielschichtigkeit des Begriffs werden betont.
Städtepartnerschaft Verden/Aller und Saumur: Das Kapitel verwendet die 50-jährige Städtepartnerschaft zwischen Verden und Saumur als Fallbeispiel für ein interkulturelles Gedächtnis. Die Gemeinsamkeiten beider Städte (Reiterstädte) und die Überwindung der deutsch-französischen „Erbfeindschaft“ nach dem Zweiten Weltkrieg werden analysiert. Der Fokus liegt auf der Rolle von Institutionen (Stadtverwaltung, Vereine, Schulen) beim Aufbau und der Pflege dieses interkulturellen Gedächtnisses. Der Austausch über Generationen hinweg und die Bedeutung von Zeitzeugen und Dokumenten werden betont. Die Auszeichnung des Saumurer Bürgermeisters mit der Verdienstmedaille der Stadt Verden dient als Beispiel für die Bedeutung der gelebten Partnerschaft.
Schlüsselwörter
Kulturelles Gedächtnis, Interkulturelles Gedächtnis, Erinnerung, Gedächtnis, Erinnerungskultur, Aleida Assmann, Jan Assmann, kollektives Gedächtnis, Städtepartnerschaft, deutsch-französische Beziehungen, Verden, Saumur, Identität, Wir-Gruppe, interkulturelle Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Interkulturelles Gedächtnis - am Beispiel der Städtepartnerschaft Verden/Saumur
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Konzept des interkulturellen Gedächtnisses, ausgehend von der Theorie des kulturellen Gedächtnisses nach Jan und Aleida Assmann. Sie veranschaulicht dieses Konzept anhand der Städtepartnerschaft zwischen Verden/Aller und Saumur.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Begriff „Erinnerungskultur“, das kulturelle Gedächtnis nach Assmann (mit Unterscheidung von Ich- und Mich-Gedächtnis sowie episodischem, semantischen und prozeduralem Gedächtnis), kollektives Gedächtnis, und schließlich den zentralen Begriff des interkulturellen Gedächtnisses. Die Rolle von Geschichte und Erinnerung in interkulturellen Beziehungen wird beleuchtet.
Wie wird das interkulturelle Gedächtnis definiert?
Da es keine einheitliche Definition gibt, wird interkulturelles Gedächtnis interaktionistisch als das gemeinsame Gedächtnis einer Wir-Gruppe mit Angehörigen verschiedener Kulturen definiert, die einen gemeinsamen Wissens- und Geschichtsfundus über Generationen hinweg teilen. Die Komplexität des Begriffs wird betont.
Welche Rolle spielt die Städtepartnerschaft Verden/Saumur?
Die 50-jährige Städtepartnerschaft zwischen Verden und Saumur dient als Fallbeispiel. Analysiert werden die Gemeinsamkeiten der Städte (Reiterstädte), die Überwindung der deutsch-französischen „Erbfeindschaft“, die Rolle von Institutionen (Stadtverwaltung, Vereine, Schulen) beim Aufbau und der Pflege des interkulturellen Gedächtnisses, der Austausch über Generationen und die Bedeutung von Zeitzeugen und Dokumenten.
Welche Arten von Gedächtnis werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Ich- und Mich-Gedächtnis, sowie episodischem, semantisch und prozeduralem Gedächtnis (aus psychologischer Perspektive). Zusätzlich wird die Unterscheidung zwischen Speichergedächtnis und Funktionsgedächtnis erläutert. Der Unterschied zwischen Erinnerung (aktuelle Handlung des Zurückblickens) und Gedächtnis (zeitinvarianter Speicher) nach Assmann wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Kulturelles Gedächtnis, Interkulturelles Gedächtnis, Erinnerung, Gedächtnis, Erinnerungskultur, Aleida Assmann, Jan Assmann, kollektives Gedächtnis, Städtepartnerschaft, deutsch-französische Beziehungen, Verden, Saumur, Identität, Wir-Gruppe, interkulturelle Kommunikation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Der Begriff „Erinnerungskultur“, Kulturelles Gedächtnis nach Assmann, Interkulturelles Gedächtnis und die Städtepartnerschaft Verden/Saumur. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detaillierter beschrieben.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Konzept des interkulturellen Gedächtnisses zu definieren und anhand des Beispiels der Städtepartnerschaft Verden/Saumur zu veranschaulichen. Der Einfluss von Geschichte und Erinnerung auf die Gestaltung interkultureller Beziehungen soll beleuchtet werden.
- Quote paper
- Ivonne Wüsthof (Author), 2017, Das Interkulturelle Gedächtnis und der Begriff der Erinnerungskultur nach Jan und Aleida Assmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/374254