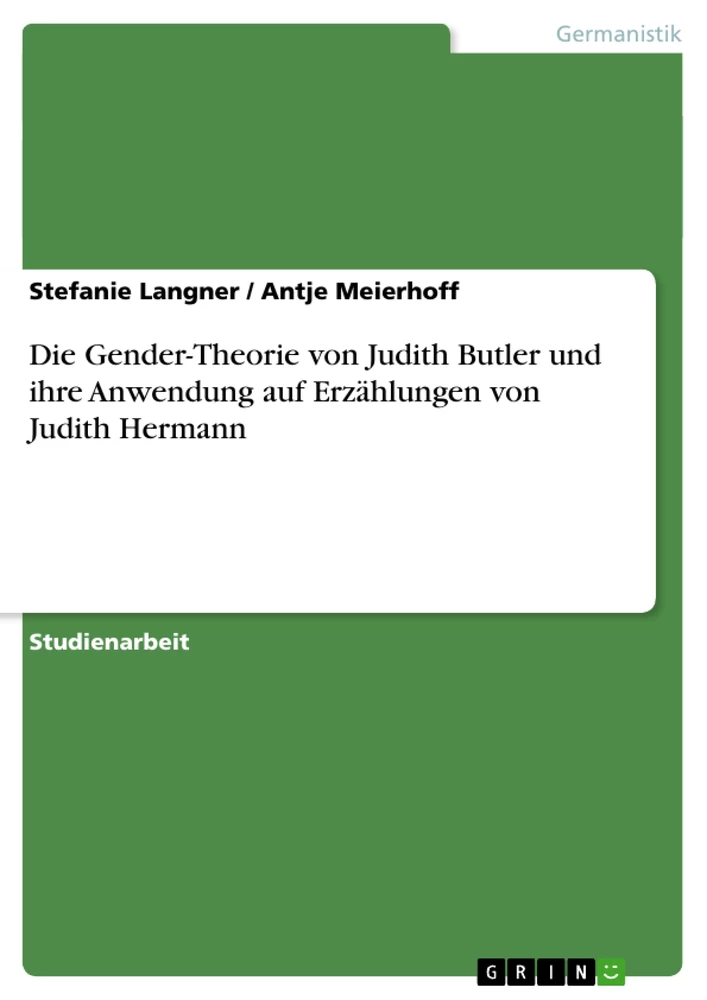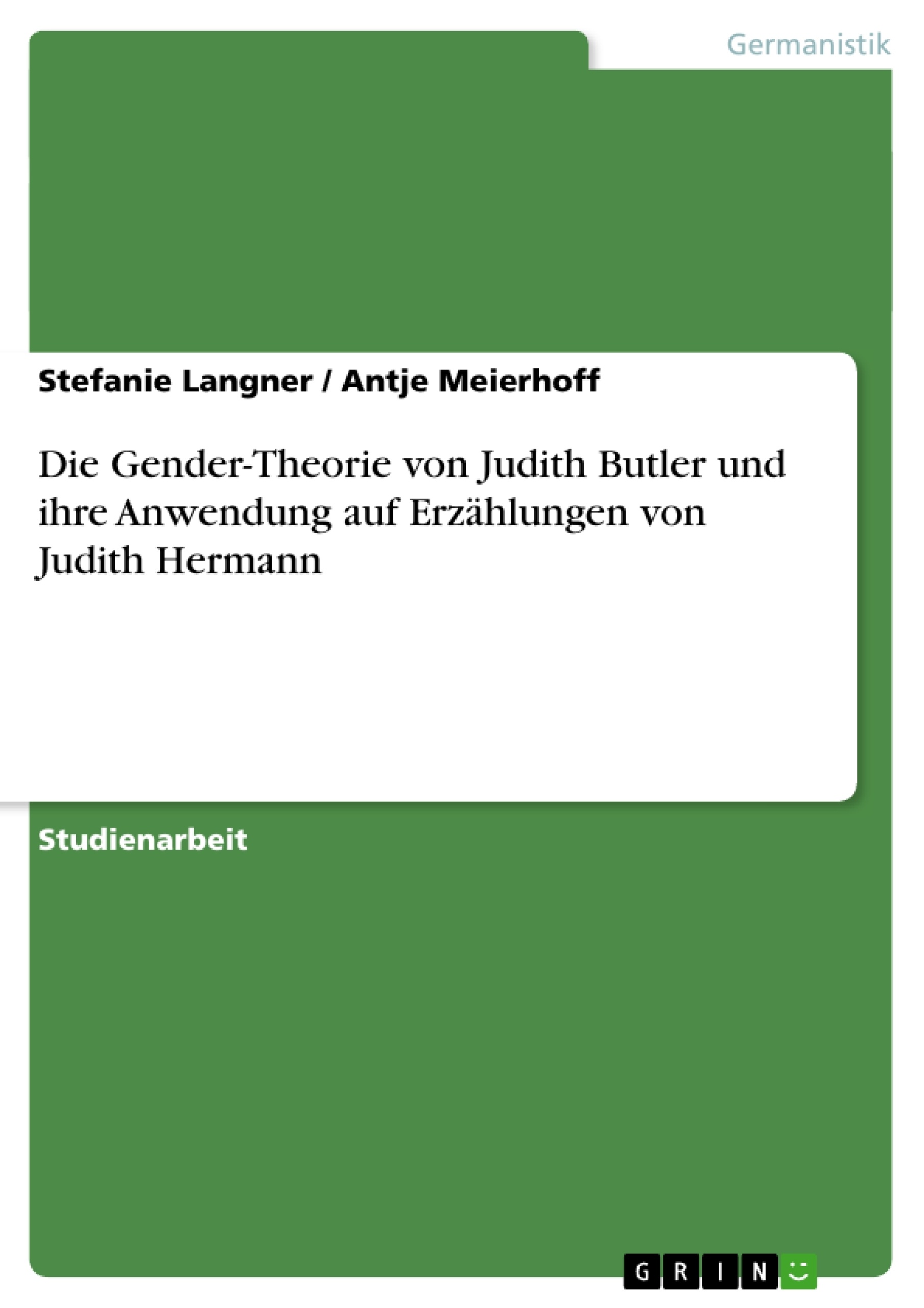Einleitung
„Tatsächlich hatten alle vier einen Riesenhunger, und so tafelten sie binnen kurzem in einer scheußlichen Schwabinger Pizzeria, der wißbegierigen Angela mit vollen Backen die tollen Theoreme Butlers vorkauend. Gerade daß der temperamentvollen Wasserstoffblondine nicht gleich die ganze Lasagne aus dem bepinselten Gesicht fiel: Mein schöner Schwanz, nichts weiter als das Fleisch gewordene Ergebnis politischer Übereinkünfte? Woraufhin sich eine lebhafte Debatte darüber entzündete, ob Fraukes und Angelas Verlobung nun als homo-, hetero- oder gar zwangsheterosexuell zu klassifizieren sei. (…) Angela Guida wollte selbst auf der Autobahn noch nicht einsehen, daß ihre allseits als perfekt empfundene, feminine Gender Impersonation als parodistische Wiederholung diskursiver Bezeichnungspraxen des Geschlechtlichen zu bewerten sei, als subversiver Akt im höheren Auftrag einer revolutionären Multiplikation der Geschlechter, nämlich jenseits des, wie alle im Ford befanden, absolut schrottreifen binären Systems.“1 Diese Textstelle aus Thomas Meineckes „Tomboy“ könnte als Vorführbeispiel für die Anwendung von Literaturtheorie auf literarische Werke angesehen werden. Dabei weist der Roman die Besonderheit auf, dass literaturtheoretische Ansätze, besonders jene, die sich mit Gender-Fragen befassen konkret thematisiert werden – so sind Personen, wie Butler, Weininger, Lacan, Wittig oder Foucault und deren Ansichten, Thesen und Texte wichtiger Bestandteil im Leben der Figuren in Meineckes „bizarren Kabinett der gender troubles“2. Da wären beispielsweise die in ihrer Jugend als Tomboy bezeichnete Vivian Atkinson, die sich im Rahmen ihrer Magisterarbeit mit Judith Butler auseinandersetzt, ihre bisexuelle, schwangere Freundin Korinna, die lesbische Frauke, die mit Angela, welche früher Angelo war, verlobt ist und der feminine Hans, der in Vivian verliebt ist – diese verschiedenen und unterschiedlich geschlechtlich orientierten Charaktere haben alle eines gemeinsam: Sie tauschen Bücher und Schallplatten untereinander, diskutieren darüber und über das aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehen und sie besprechen ihre eigenen alltäglichen Probleme. Dabei zitieren sie immer wieder bekannte Wissenschaftler, Philosophen, Psychologen und Feministinnen und aufgrund dessen kann man sagen, dass im Text ganz offensichtlich Ansätze der Kultur- und Literaturtheorie wieder zu finden sind...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gender-Studien in Bezug auf Literaturwissenschaft
- 3. Ansätze der Gender-Theorie von Judith Butler
- 3.1. Unterscheidung von „sex“ und „gender“
- 3.2. Die Kategorien Mann und Frau - Anmerkungen zu kulturellen Geschlechter-Normen und Zwangsheterosexualität
- 3.3. Der Performanz-Begriff
- 4. Die Anwendung der Butlerschen Theorie auf Erzählungen von Judith Hermann
- 4.1. Frauen- und Männerbilder in Judith Hermanns Erzählungen
- 4.2. Analyse der Erzählung „Sonja“
- 4.3. Analyse der Erzählung „Camera Obscura“
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der Gender-Theorie von Judith Butler auf die Erzählungen von Judith Hermann. Ziel ist es, die in den Erzählungen dargestellten Frauen- und Männerbilder zu analysieren und diese mit Butlers Performanz-Begriff in Verbindung zu bringen. Die Arbeit beleuchtet zunächst den Kontext der Gender-Studies in der Literaturwissenschaft.
- Anwendbarkeit der Butlerschen Gender-Theorie auf literarische Texte
- Analyse von Frauen- und Männerbildern in den Erzählungen Judith Hermanns
- Der Performanz-Begriff nach Butler und seine Relevanz für die Interpretation literarischer Figuren
- Konzept von „sex“ und „gender“ nach Butler
- Kulturelle Geschlechter-Normen und Zwangsheterosexualität
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Ansatz der Arbeit. Sie veranschaulicht die Relevanz der Gender-Theorie für die Literaturinterpretation anhand eines Beispiels aus Thomas Meineckes „Tomboy“, wo literaturtheoretische Ansätze explizit thematisiert werden. Die Arbeit skizziert den weiteren Aufbau, der sich von allgemeinen Gender-Studies über Butlers Theorie zur konkreten Analyse von Judith Hermanns Erzählungen bewegt.
2. Gender-Studien in Bezug auf Literaturwissenschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Gender-Forschung in der Literaturwissenschaft. Es zeigt auf, wie das Geschlecht des Autors/der Autorin lange Zeit als Variable des ästhetischen Diskurses galt, wobei „männlich“ konnotiert war und Frauen oft marginalisiert wurden. Der Abschnitt beschreibt die Entwicklung der feministischen Literaturwissenschaft ab den 1970er Jahren und die damit verbundene Frage nach einer „weiblichen Ästhetik“ und spezifischen „Männer-“ und „Frauenthemen“ in der Literatur.
3. Ansätze der Gender-Theorie von Judith Butler: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Butlers zentrale Thesen. Es wird die Unterscheidung zwischen „sex“ (biologisches Geschlecht) und „gender“ (sozial konstruiertes Geschlecht) erläutert. Die Analyse der kulturellen Geschlechter-Normen und des Konzepts der Zwangsheterosexualität bildet einen weiteren Schwerpunkt. Schließlich wird Butlers Performanz-Begriff detailliert dargelegt, der besagt, dass Geschlecht nicht eine vorgegebene Essenz, sondern ein durch wiederholte Handlungen und Praktiken performativ erzeugtes Konstrukt ist.
Schlüsselwörter
Gender-Theorie, Judith Butler, Judith Hermann, Performativität, Geschlecht, sex, gender, Frauenbilder, Männerbilder, Literaturwissenschaft, Gender Studies, kulturelle Geschlechter-Normen, Zwangsheterosexualität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Anwendung der Gender-Theorie von Judith Butler auf die Erzählungen von Judith Hermann
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Anwendbarkeit der Gender-Theorie von Judith Butler auf die Erzählungen von Judith Hermann. Das Hauptziel ist die Analyse der in den Erzählungen dargestellten Frauen- und Männerbilder und deren Verbindung zu Butlers Performanz-Begriff. Die Arbeit beleuchtet den Kontext der Gender-Studies in der Literaturwissenschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Anwendbarkeit der Butlerschen Gender-Theorie auf literarische Texte, die Analyse von Frauen- und Männerbildern in Judith Hermanns Erzählungen, Butlers Performanz-Begriff und dessen Relevanz für die Interpretation literarischer Figuren, das Konzept von „sex“ und „gender“ nach Butler sowie kulturelle Geschlechter-Normen und Zwangsheterosexualität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) führt in die Thematik ein und beschreibt den Ansatz. Kapitel 2 (Gender-Studien in Bezug auf Literaturwissenschaft) beleuchtet die Geschichte der Gender-Forschung in der Literaturwissenschaft. Kapitel 3 (Ansätze der Gender-Theorie von Judith Butler) konzentriert sich auf Butlers zentrale Thesen, die Unterscheidung von „sex“ und „gender“, kulturelle Geschlechter-Normen, Zwangsheterosexualität und den Performanz-Begriff. Kapitel 4 (Anwendung der Butlerschen Theorie auf Erzählungen von Judith Hermann) analysiert Frauen- und Männerbilder in Hermanns Erzählungen, insbesondere „Sonja“ und „Camera Obscura“. Kapitel 5 (Fazit) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Gender-Theorie, Judith Butler, Judith Hermann, Performativität, Geschlecht, sex, gender, Frauenbilder, Männerbilder, Literaturwissenschaft, Gender Studies, kulturelle Geschlechter-Normen, Zwangsheterosexualität.
Wie wird die Butlersche Theorie angewendet?
Die Arbeit wendet Butlers Theorie an, indem sie die in Judith Hermanns Erzählungen dargestellten Frauen- und Männerbilder analysiert und diese mit Butlers Konzept der Performativität in Beziehung setzt. Das bedeutet, dass Geschlecht nicht als vorgegebene Essenz, sondern als ein durch wiederholte Handlungen und Praktiken konstruiertes Konstrukt verstanden wird.
Welche konkreten Erzählungen von Judith Hermann werden analysiert?
Die Arbeit analysiert explizit die Erzählungen „Sonja“ und „Camera Obscura“ von Judith Hermann.
Welche Rolle spielt der Begriff der Performativität?
Butlers Performanz-Begriff ist zentral. Er besagt, dass Geschlecht kein natürliches, sondern ein sozial konstruiertes und durch wiederholte Handlungen (performative Akte) erzeugtes Konstrukt ist. Diese Theorie wird angewendet, um die Geschlechterrollen und -darstellungen in Hermanns Erzählungen zu interpretieren.
- Quote paper
- Stefanie Langner (Author), Antje Meierhoff (Author), 2004, Die Gender-Theorie von Judith Butler und ihre Anwendung auf Erzählungen von Judith Hermann, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/37422