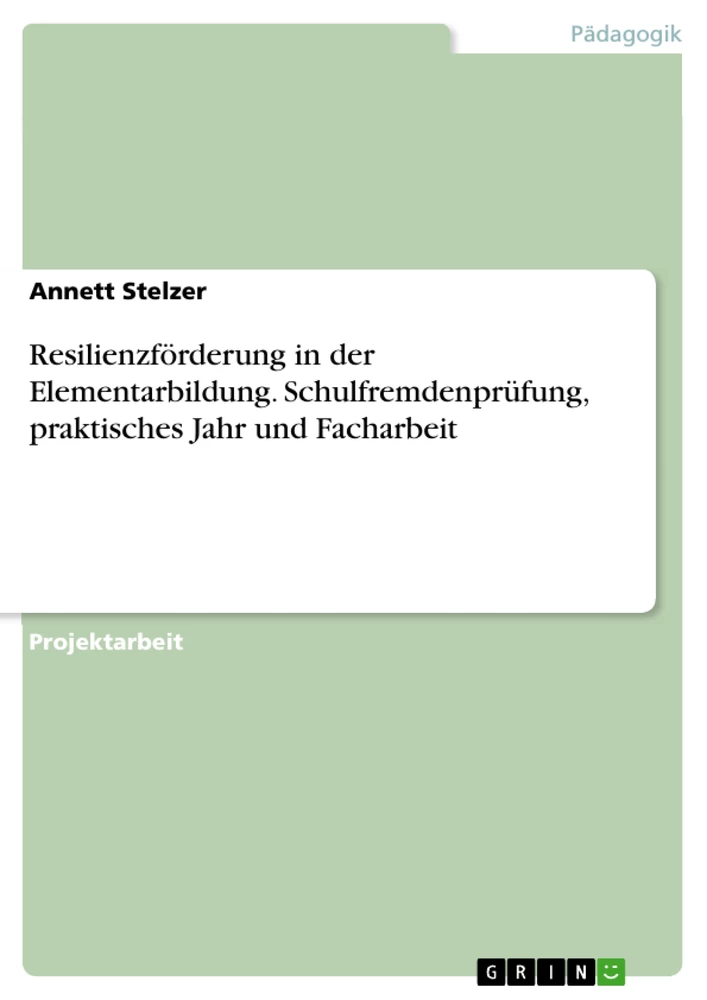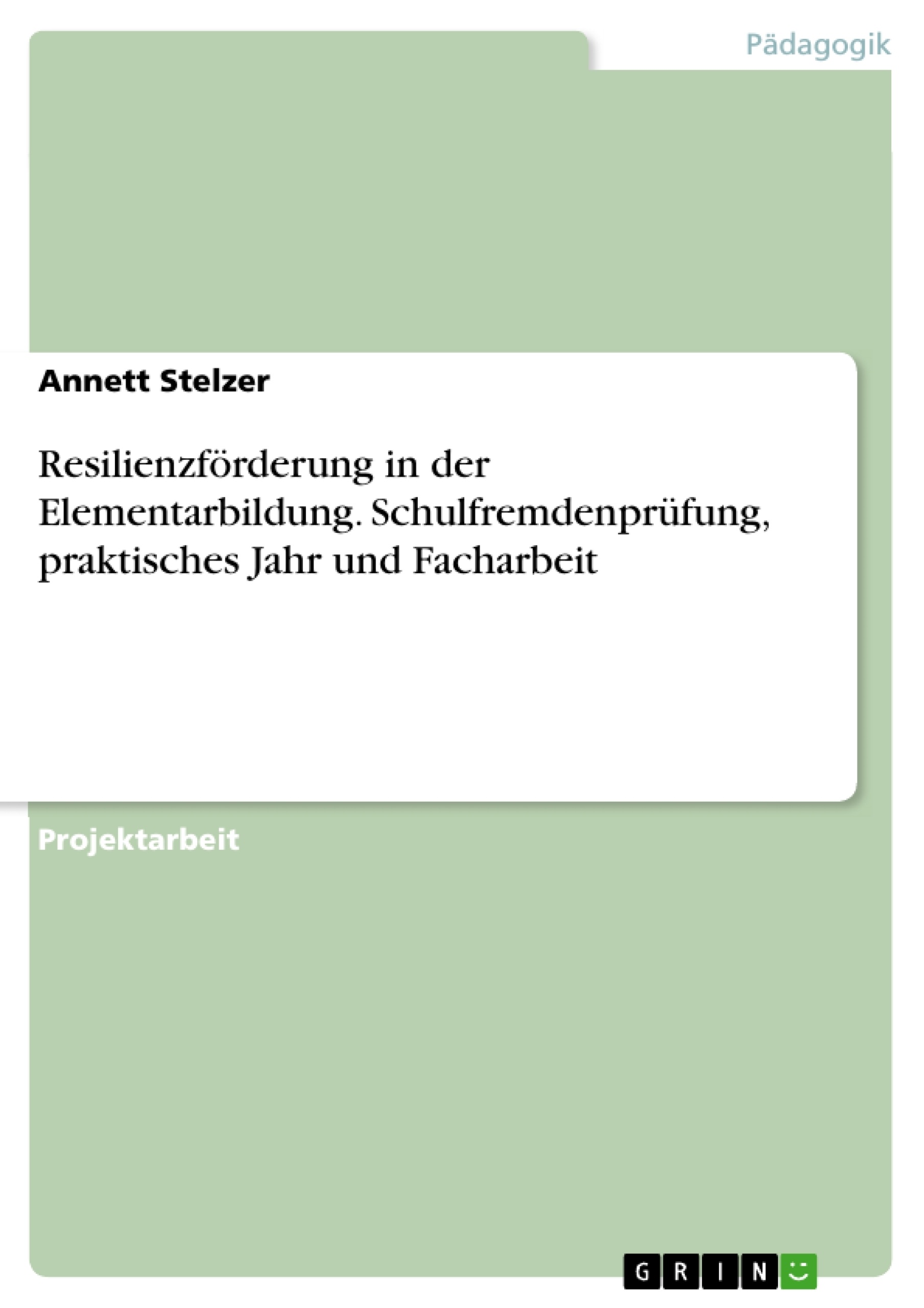Durch die vorliegenden Arbeiten zieht sich als roter Faden Resilienz. Dieser rote Faden ist verknüpft mit verschiedensten elementar-pädagogischen Kernbereichen wie Inklusion, gendergerechtes Arbeiten, Bewusstheit für soziale Ungleichheit, Ganzheitlichkeit und Kompetenzorientierung in der pädagogischen Arbeit, Migration und vieles mehr.
Aber was versteht man unter einem "resilienten Kind"? Resiliente Kinder zeichnen sich laut Bayerischem Bildungsplan z.B. durch folgende personale Ressourcen aus: hohe Problemlöse-fähigkeit, Kreativität, positive Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen, Selbstregulationsfähigkeit, sicheres Bindungsverhalten, Selbstwirksamkeits- und Kontrollüberzeugungen. Hinzu kommen wichtige soziale Ressourcen wie sichere Bindungen und positive Beziehungen zu erwachsenen Bezugspersonen. Der hohe Anteil der Kinder, die täglich den größten Anteil des Alltags in Betreuungseinrichtungen verbringen, erfordert pädagogisches Personal, welches sich der Bedeutung dieser Faktoren für die gesunde Entwicklung der ihnen anvertrauten Kinder bewusst ist und dieses Thema in der praktischen Tätigkeit reflektiert einfließen lässt.
Einige der soeben erwähnten Kompetenzen resilienter Kinder findet man bei näherer Betrachtung auch in den Anforderungen an pädagogische Fachkräfte. Insbesondere Menschen, die erst im zweiten Berufsweg und nach einer eigenen Familiengründung diesen Beruf der ErzieherIn ergreifen wollen, müssen selbst durch Doppelbelastung und externe Wege der Ausbildung zum Erzieher erhöhte Widerstände überwinden.
Diese Arbeit bietet einen Leitfaden zum Bestehen der Schulfremdenprüfung, indem die Ausarbeitungen hier als Beispiele angesehen werden können. Teil I enthält eine Planung des gezielten Bildungsangebotes, welches im Rahmen des berufspraktischen Prüfungsteils einer Schulfremdenprüfung zur Erzieherin ausgearbeitet wurde. Im Teil II befinden sich die einführenden Aufgaben des Berufspraktikums: Situationsanalyse, Reflexionen zur pädagogischen Arbeit, eine Verlaufsplanung zum Freispiel sowie die Planung eines gezielten Angebotes. Bereits in diesem Angebot wird das Theoriewissen zur Resilienz miteingearbeitet. In Teil III wird Planung und Durchführung eines gezielten Angebotes, hier des Projektes "Krankenhaus und Rettungswagen", dokumentiert. Dieses Projekt soll zum Ausprobieren von "Ideal-Rollen" anleiten, zu denen neben denen von Vater und Mutter auch die Berufsrollen gehören.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I Schulfremdenprüfung zur Erzieherin
- II Erziehungspraktische Prüfung
- Berufspraktisches Jahr zur Staatlichen Anerkennung
- 1. Praxisbesuch
- Teil 1 Situationsanalyse
- Teil 2 Reflexionen zur pädagogischen Arbeit
- Teil 3 Verlaufsplanung Freispiel
- Teil 4 Planung eines gezielten Angebotes
- 2. Praxisbesuch
- Projektarbeit
- III Berufspraktisches Jahr zur Staatlichen Anerkennung
- IV Berufspraktisches Jahr zur Staatlichen Anerkennung
- Facharbeit „Resilienzförderung in der Elementarbildung“
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit dokumentiert den Weg der Autorin zur staatlichen Anerkennung als Erzieherin über die Schulfremdenprüfung. Ziel ist es, Einblicke in die Herausforderungen dieses nicht-traditionellen Ausbildungsweges zu geben und anhand der eigenen Erfahrungen die Bedeutung von Resilienz in der Elementarpädagogik zu beleuchten. Die Arbeit dient als Hilfestellung für andere angehende Erzieherinnen und Erzieher, die einen ähnlichen Weg einschlagen möchten.
- Resilienzförderung in der Elementarbildung
- Herausforderungen der Schulfremdenprüfung
- Reflexion der eigenen pädagogischen Praxis
- Vergleich verschiedener pädagogischer Ansätze
- Die Bedeutung von Kompetenzorientierung und Inklusion
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den hohen Anteil von Kindern in Kindertageseinrichtungen und den Zusammenhang zwischen Armut und Entwicklungsrisiken. Sie führt den Begriff der Resilienz ein und betont die Bedeutung von persönlichen und sozialen Ressourcen für die Entwicklung resilienter Kinder. Die Autorin verdeutlicht die Parallelen zwischen den Kompetenzen resilienter Kinder und den Anforderungen an pädagogische Fachkräfte, insbesondere im Kontext der Schulfremdenprüfung, die sie selbst erfolgreich absolvierte. Die hohen Durchfallquoten bei dieser Prüfungsform werden hervorgehoben, und es wird auf die unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Fachschulen in Baden-Württemberg hingewiesen. Schließlich wird der "rote Faden" der Arbeit, die Resilienzförderung, eingeführt und die Struktur der Arbeit skizziert.
I Schulfremdenprüfung zur Erzieherin: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über den Prozess der Schulfremdenprüfung zur Erzieherin, die Autorin beschreibt ihren Weg und die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Es wird der Fokus auf die Notwendigkeit von Resilienz gelegt, um die hohen Hürden der Prüfung zu meistern. Der Abschnitt thematisiert auch die Unterschiede in den Anforderungen verschiedener Fachschulen und die damit verbundenen Schwierigkeiten für "schulfremde" Prüflinge.
II Erziehungspraktische Prüfung: Dieses Kapitel dokumentiert die Erfahrungen der Autorin während ihres Berufspraktikums. Es umfasst eine detaillierte Situationsanalyse, Reflexionen zur pädagogischen Arbeit, eine Verlaufsplanung für das Freispiel und die Planung eines gezielten Angebots. Die Autorin integriert ihr Wissen über Resilienz in ihre pädagogischen Überlegungen und zeigt, wie sie dieses Wissen in der Praxis anwendet. Die Zusammenfassung der einzelnen Teilbereiche zeigt die ganzheitliche Herangehensweise der Autorin an die erzieherische Arbeit.
III Berufspraktisches Jahr zur Staatlichen Anerkennung: In diesem Kapitel wird die Projektarbeit der Autorin "Krankenhaus und Rettungswagen" dokumentiert. Die Planung und Durchführung des Projekts wird detailliert beschrieben, und der Fokus liegt auf der Anwendung der theoretischen Kenntnisse zur Resilienzförderung in der Praxis. Der Abschnitt zeigt, wie die Autorin die Kinder auf spielerische Weise an ein möglicherweise schwieriges Thema heranführt und gleichzeitig ihre Resilienz stärkt. Der Zusammenhang zur vorherigen Theorie wird deutlich herausgestellt.
IV Berufspraktisches Jahr zur Staatlichen Anerkennung, Facharbeit „Resilienzförderung in der Elementarbildung“: Das Kapitel beschreibt die Facharbeit der Autorin zum Thema Resilienzförderung in der Elementarbildung. Es wird die Verknüpfung von Praxisdokumentation und theoretischen Erkenntnissen dargestellt. Die Arbeit dient dazu, den Blick für eine reflexive pädagogische Arbeit zu schärfen und zeigt die Anwendung der gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse aus den vorherigen Kapiteln.
Schlüsselwörter
Resilienzförderung, Elementarbildung, Schulfremdenprüfung, Erzieher*innen-Ausbildung, pädagogische Praxis, Reflexion, Inklusion, Kompetenzorientierung, soziale Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Schulfremdenprüfung zur Erzieherin
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Diese Arbeit dokumentiert den Weg der Autorin zur staatlichen Anerkennung als Erzieherin über die Schulfremdenprüfung und beleuchtet anhand der eigenen Erfahrungen die Bedeutung von Resilienz in der Elementarpädagogik. Sie dient als Hilfestellung für andere angehende Erzieherinnen und Erzieher, die einen ähnlichen Weg einschlagen möchten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Schulfremdenprüfung zur Erzieherin, die erziehungspraktische Prüfung mit Situationsanalyse, Reflexionen zur pädagogischen Arbeit, Verlaufsplanung und gezielten Angeboten, das Berufspraktische Jahr mit Projektarbeit ("Krankenhaus und Rettungswagen") und die Facharbeit "Resilienzförderung in der Elementarbildung". Ein zentrales Thema ist die Bedeutung von Resilienzförderung in der Elementarbildung und die Bewältigung der Herausforderungen der Schulfremdenprüfung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Schulfremdenprüfung, ein Kapitel zur erziehungspraktischen Prüfung, zwei Kapitel zum Berufspraktischen Jahr (inkl. Projektarbeit und Facharbeit) und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel fasst die jeweiligen Erfahrungen und Erkenntnisse der Autorin zusammen.
Welche Herausforderungen werden in der Arbeit beschrieben?
Die Arbeit beschreibt die Herausforderungen der Schulfremdenprüfung, insbesondere die hohen Durchfallquoten und die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Fachschulen in Baden-Württemberg. Weiterhin werden die Herausforderungen der Reflexion der eigenen pädagogischen Praxis und die Anwendung verschiedener pädagogischer Ansätze thematisiert.
Wie wird Resilienz in der Arbeit behandelt?
Resilienzförderung ist ein zentrales Thema der Arbeit. Die Autorin beschreibt, wie sie ihr Wissen über Resilienz in ihrer pädagogischen Praxis anwendet und wie sie die Resilienz der Kinder in ihren Projekten und Angeboten stärkt. Die Arbeit zeigt den Zusammenhang zwischen den Kompetenzen resilienter Kinder und den Anforderungen an pädagogische Fachkräfte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für angehende Erzieherinnen und Erzieher, die den Weg über die Schulfremdenprüfung zur staatlichen Anerkennung einschlagen möchten. Sie bietet Einblicke in die Praxis und die Herausforderungen dieses Ausbildungsweges und liefert wertvolle Hilfestellungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Resilienzförderung, Elementarbildung, Schulfremdenprüfung, Erzieher*innen-Ausbildung, pädagogische Praxis, Reflexion, Inklusion, Kompetenzorientierung, soziale Ungleichheit.
Welche konkreten Beispiele aus der Praxis werden genannt?
Die Arbeit enthält detaillierte Beschreibungen der Planung und Durchführung eines Projektes zum Thema "Krankenhaus und Rettungswagen" sowie Beispiele für Situationsanalysen, Reflexionen zur pädagogischen Arbeit, Verlaufsplanungen für das Freispiel und die Planung gezielter Angebote im Rahmen der erziehungspraktischen Prüfung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist systematisch aufgebaut mit Einleitung, Kapiteln zu den verschiedenen Phasen der Ausbildung, Zusammenfassung der Kapitel und einer Schlussbetrachtung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Liste der Schlüsselwörter erleichtern die Navigation.
Wo liegt der Mehrwert dieser Arbeit?
Der Mehrwert liegt in der detaillierten Darstellung des Weges zur staatlichen Anerkennung als Erzieherin über die Schulfremdenprüfung, der Integration praktischer Erfahrungen und der Fokussierung auf die Bedeutung der Resilienzförderung in der Elementarpädagogik. Sie bietet konkrete Einblicke und Hilfestellungen für angehende Erzieherinnen und Erzieher.
- Quote paper
- Annett Stelzer (Author), 2015, Resilienzförderung in der Elementarbildung. Schulfremdenprüfung, praktisches Jahr und Facharbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/370815