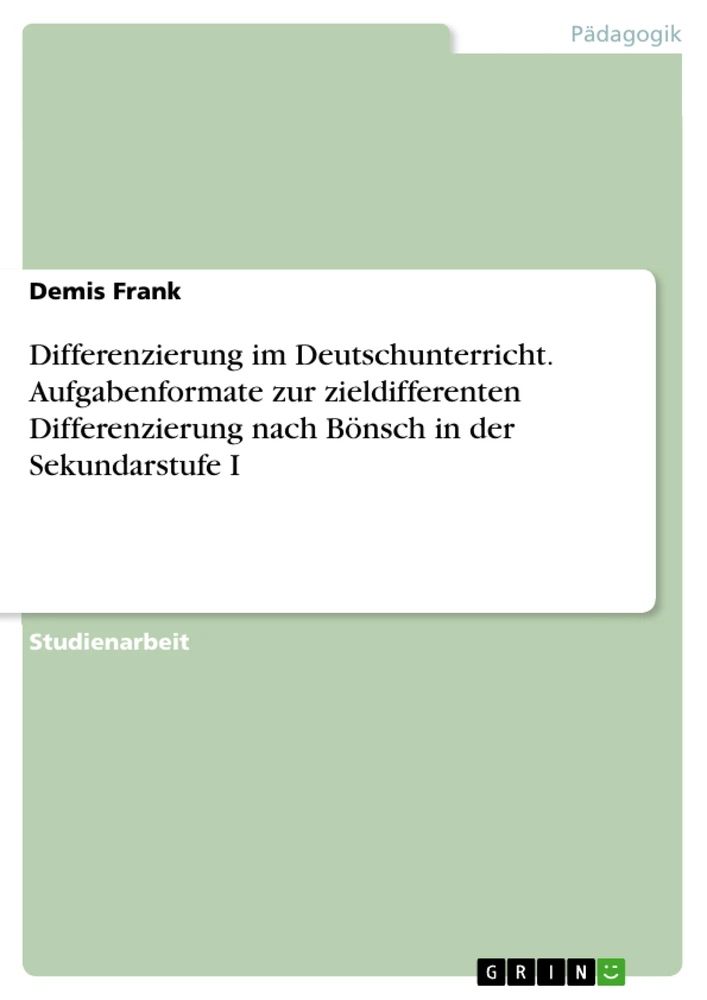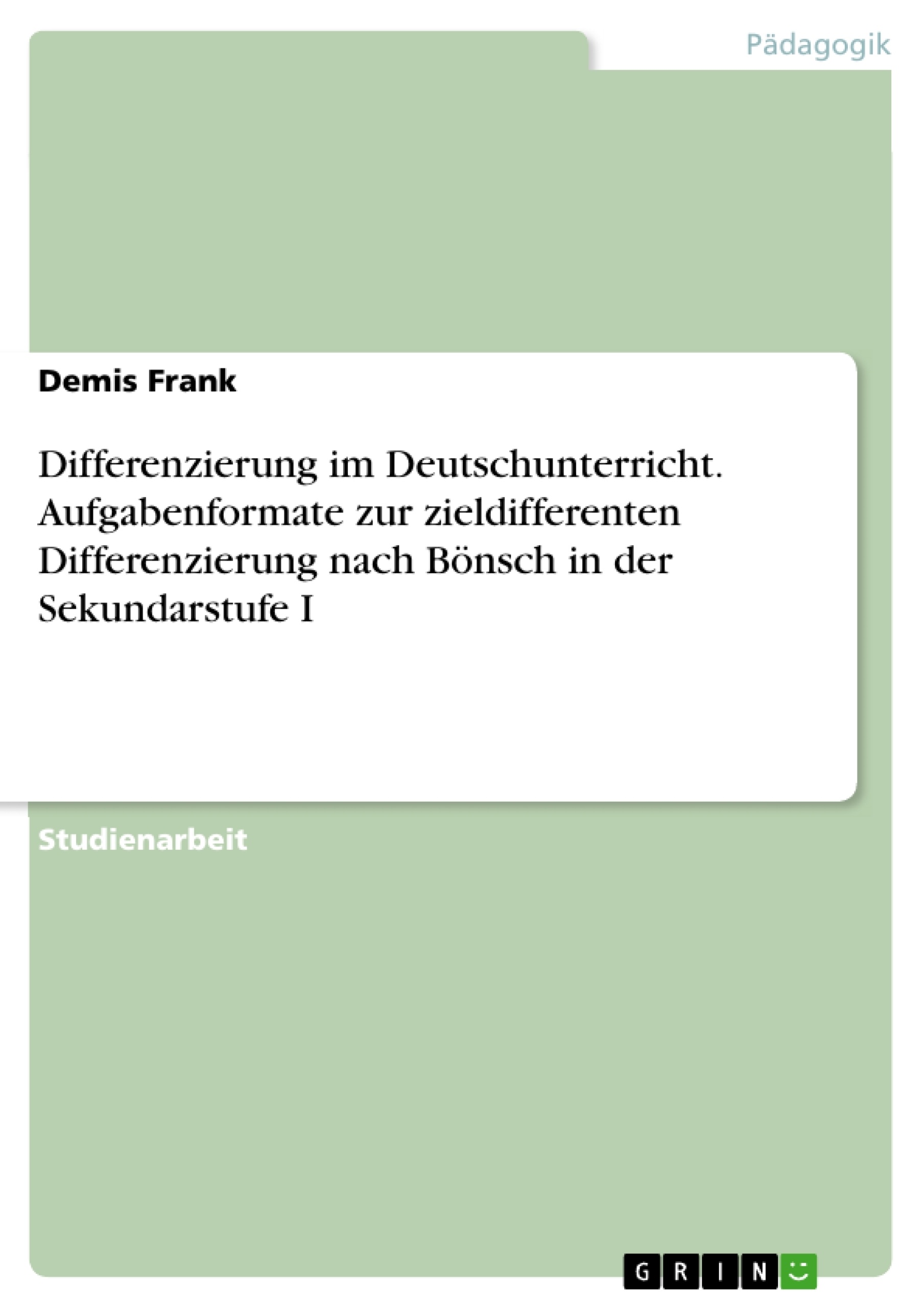In dieser Arbeit wird versucht, Bönschs Konzept der „zieldifferenten Differenzierung“ theoretisch umzusetzen. Nach ihm sei es besonders für stark heterogene Gruppen geeignet, da mit Hilfe verschiedener Niveaustufen im Anforderungsbereich die Verschiedenartigkeit bei Schülern mehr berücksichtigt wird.
Um dieses umzusetzen, werden dazu auf theoretischer Ebene verschiedene Aufgabenformate benutzt. Sie ermöglichen eine Differenzierung auf verschiedenen Niveaustufen. Wie es zu dieser Abstufung kommt, wird theoretisch erwähnt. Ferner werden konkrete Beispiele zu den Aufgaben gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zieldifferente Differenzierung im Deutschunterricht.
- Beschreibung des Ansatzes: Zieldifferente Differenzierung
- Geschlossene Aufgabenformate
- Halboffene und offene Aufgabenformate
- Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Einsatz von zieldifferenter Differenzierung im Deutschunterricht der Sekundarstufe I. Sie soll theoretisch aufzeigen, wie der Ansatz von Manfred Bönsch in einer fiktiven heterogenen Lerngruppe umgesetzt werden kann, um den unterschiedlichen Leistungsniveaus der Schüler gerecht zu werden. Der Fokus liegt dabei auf der Anwendung des Ansatzes anhand von verschiedenen Aufgabenformaten.
- Heterogenität in Lerngruppen
- Kritik am deutschen Schulsystem
- Zieldifferente Differenzierung als Lösungsansatz
- Umsetzung des Ansatzes mit Aufgabenformaten
- Theoretische Veranschaulichung an einem Beispiel
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Problem der Heterogenität in Lerngruppen dar und kritisiert das deutsche Schulsystem, das nur unzureichend auf diese Vielfalt eingeht. Sie führt den Ansatz der zieldifferenten Differenzierung nach Bönsch als möglichen Lösungsansatz ein und erläutert die Notwendigkeit der Berücksichtigung von individuellen Leistungsniveaus im Unterricht.
- Zieldifferente Differenzierung im Deutschunterricht: Dieses Kapitel beschreibt den Ansatz der zieldifferenten Differenzierung, bei dem die Schüler an ihrem individuellen Leistungsstand arbeiten können. Die Arbeit erläutert die verschiedenen Niveaustufen und gibt Beispiele für geschlossene, halboffene und offene Aufgabenformate, die den unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden entsprechen.
- Geschlossene Aufgabenformate: Dieses Kapitel erklärt die Prinzipien geschlossener Aufgabenformate wie Wahr-Falsch-Aufgaben, Multiple-Choice-Aufgaben und Zuordnungsaufgaben. Es verdeutlicht die Vorteile und Nachteile dieses Formats und bietet konkrete Beispielaufgaben.
- Halboffene und offene Aufgabenformate: Das Kapitel beschreibt halboffene und offene Aufgabenformate, die im Vergleich zu geschlossenen Aufgabenformaten einen größeren Entscheidungsspielraum für die Schüler bieten. Es verdeutlicht den Unterschied zwischen diesen Formaten und bietet Beispiele für deren Anwendung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Heterogenität, Differenzierung, zieldifferente Differenzierung, Aufgabenformate, Deutschunterricht, Sekundarstufe I, Bönsch, und die Anwendung des Ansatzes in einer fiktiven Lerngruppe.
- Quote paper
- Demis Frank (Author), 2015, Differenzierung im Deutschunterricht. Aufgabenformate zur zieldifferenten Differenzierung nach Bönsch in der Sekundarstufe I, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/370553