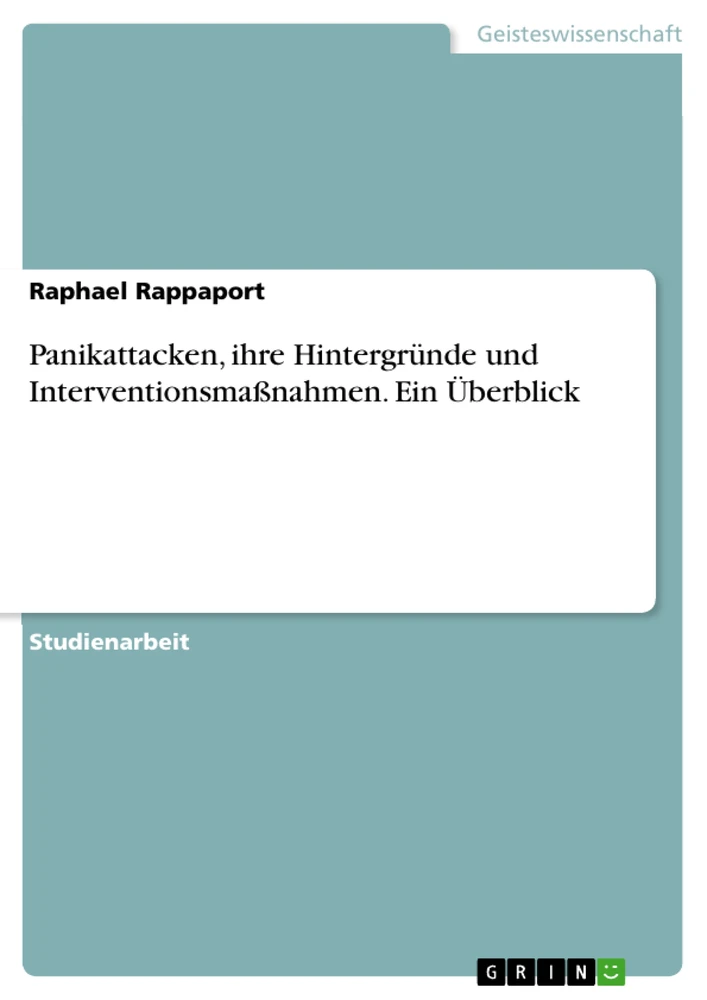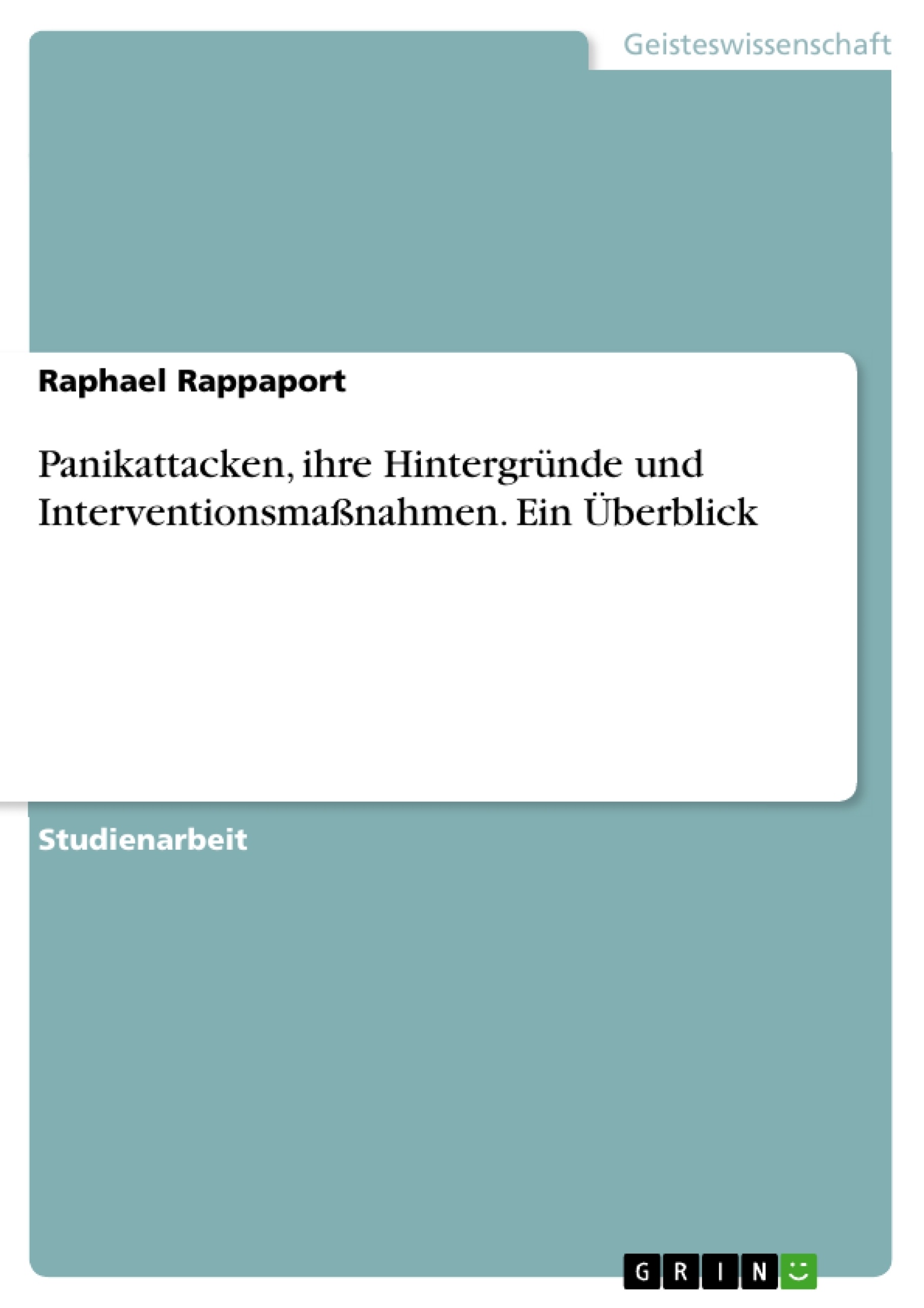Diese Arbeit setzt sich mit Panikstörungen, ihren Hintergründen und potenziellen Interventionsmaßnahmen auseinander.
Beginnend mit der Begriffsdefinition der Angst- und Panikstörung, damit dem Leser die Fragestellung bzw. die Thematik etwas näher gebracht wird, folgt anschließend die Untersuchung der Frage, inwiefern Stress und Panikstörungen zusammenhängen. Im dritten Kapitel wird ein ausführliches Augenmerk auf bestehende Therapiemöglichkeiten gelegt, wobei dort ein besonderer Fokus auf der Selbsttherapie liegt; außerdem wird unter anderem die „TEK-Sequenz“ vorgestellt und das Autogene Training erläutert. Anschließend folgt eine Diskussion über den Zusammenhang von Stress, Angst und Panik und ein Konzept zur Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit dieser Problematik. Abschließend stellen die beiden Autoren ihr persönliches Fazit zu der vorliegenden Arbeit dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2.0 Definition Panikstörungen
- 2.1 Häufigkeit von Panikstörungen
- 3.0 Entstehung von Panikstörungen
- 3.1 Definition Stress
- 3.2 Zusammenhang von Stress und Panikstörung
- 3.3 Lerntheoretischer Hintergrund und weitere Faktoren
- 4.0 Therapie
- 4.1 Selbsttherapie
- 4.2 Entspannung als Therapie
- 4.2.1 Muskelentspannung
- 4.2.2 Atemspannung
- 4.2.3 Zwerchfellatmung
- 4.2.4 Autogenes Training
- 4.3 Natürliche Heilmittel
- 4.4 Fazit Therapiemöglichkeiten
- 5.0 Diskussion
- 5.1 Fazit 1
- 5.2 Fazit 2
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Stress und Panikstörungen. Ziel ist es, die Entstehung von Panikstörungen zu beleuchten und verschiedene Therapiemöglichkeiten aufzuzeigen, mit besonderem Fokus auf Selbsttherapie. Die Rolle der Sozialen Arbeit im Umgang mit dieser Problematik wird ebenfalls betrachtet.
- Definition und Häufigkeit von Panikstörungen
- Der Einfluss von Stress auf die Entstehung von Panikstörungen
- Verschiedene Therapieansätze bei Panikstörungen (inkl. Selbsttherapie)
- Der lerntheoretische Hintergrund der Entstehung von Panikstörungen
- Die Bedeutung der Sozialen Arbeit im Kontext von Stress und Panikstörungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den aktuellen Stand der Zunahme stressbedingter Erkrankungen dar und betont die Relevanz des Themas für die Soziale Arbeit. Sie führt in die Thematik ein und skizziert den Aufbau der Arbeit, beginnend mit der Definition von Panikstörungen, über den Zusammenhang mit Stress bis hin zu Therapiemöglichkeiten und der Rolle der Sozialen Arbeit.
2.0 Definition Panikstörungen: Dieses Kapitel beschreibt Panikattacken als psychophysiologische Zustände mit intensiver Furcht und Unbehagen, die auf körperlichen und psychischen Alarmreaktionen basieren. Es unterscheidet zwischen situationsgebundenen und nicht situationsgebundenen Panikattacken und listet die typischen Symptome auf. Der Unterschied zwischen Panikattacken und der diagnostizierten Panikstörung wird klargestellt, ebenso wie der Zusammenhang mit Agoraphobie und deren Auswirkungen auf den Alltag Betroffener.
2.1 Häufigkeit von Panikstörungen: Dieses Kapitel beleuchtet die hohe Prävalenz von Angststörungen in der Bevölkerung, unterstreicht das gesellschaftliche Stigma im Umgang mit psychischen Erkrankungen und nennt statistische Daten zur Häufigkeit von Panikstörungen und Agoraphobie, sowohl in Deutschland als auch international.
3.0 Entstehung von Panikstörungen: Dieses Kapitel behandelt Stress als Hauptursache für Panikattacken. Es definiert Stress nach Selye und beschreibt das General-Adaptation-Syndrom (GAS) mit seinen drei Phasen (Alarm, Widerstand, Erschöpfung). Die physiologischen Mechanismen der Stressreaktion, die Rolle des vegetativen Nervensystems und des Hypophysen-Nebennierenrinden-Regelkreises werden erläutert. Zusätzlich werden weitere Faktoren benannt, die die Entstehung von Panikattacken begünstigen können.
Schlüsselwörter
Panikstörung, Agoraphobie, Stress, Angst, Selbsttherapie, Entspannungstechniken, vegetatives Nervensystem, Allgemeines Anpassungssyndrom (GAS), Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Zusammenhang zwischen Stress und Panikstörungen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Panikstörungen, ihren Zusammenhang mit Stress und verschiedene Therapieansätze. Es beinhaltet eine Einleitung, eine detaillierte Definition von Panikstörungen und deren Häufigkeit, eine Erörterung der Entstehung von Panikstörungen unter Berücksichtigung von Stress und lerntheoretischen Aspekten, eine Beschreibung verschiedener Therapiemöglichkeiten (einschließlich Selbsttherapie und Entspannungstechniken) und abschließende Diskussionen. Der Fokus liegt auf der Rolle der Selbsttherapie und der Bedeutung der Sozialen Arbeit im Kontext von Stress und Panikstörungen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind: Definition und Häufigkeit von Panikstörungen, der Einfluss von Stress auf die Entstehung von Panikstörungen, verschiedene Therapieansätze (inkl. Selbsttherapie und Entspannungstechniken wie Muskelentspannung, Atemspannung, Zwerchfellatmung und autogenes Training), der lerntheoretische Hintergrund der Entstehung von Panikstörungen, sowie die Bedeutung der Sozialen Arbeit im Umgang mit Stress und Panikstörungen. Das Dokument beleuchtet auch den Unterschied zwischen Panikattacken und Panikstörung sowie den Zusammenhang mit Agoraphobie.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung und einer Definition von Panikstörungen. Es folgt ein Kapitel über die Häufigkeit von Panikstörungen, anschließend wird die Entstehung von Panikstörungen im Detail behandelt, wobei Stress als Hauptursache im Mittelpunkt steht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beschreibung verschiedener Therapieansätze, inklusive Selbsttherapie und Entspannungstechniken. Das Dokument schließt mit einer Diskussion und Fazit ab.
Welche Therapieansätze werden vorgestellt?
Das Dokument präsentiert verschiedene Therapieansätze für Panikstörungen, mit einem besonderen Fokus auf Selbsttherapie. Es werden verschiedene Entspannungstechniken detailliert beschrieben, darunter Muskelentspannung, Atemspannung, Zwerchfellatmung und autogenes Training. Zusätzlich werden natürliche Heilmittel und weitere Therapiemöglichkeiten erwähnt.
Welche Rolle spielt Stress bei der Entstehung von Panikstörungen?
Das Dokument betont die zentrale Rolle von Stress bei der Entstehung von Panikstörungen. Es beschreibt den Zusammenhang anhand des General-Adaptation-Syndroms (GAS) nach Selye und erläutert die physiologischen Mechanismen der Stressreaktion. Neben Stress werden auch weitere Faktoren genannt, die die Entstehung von Panikattacken begünstigen können.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Die Schlüsselwörter sind: Panikstörung, Agoraphobie, Stress, Angst, Selbsttherapie, Entspannungstechniken, vegetatives Nervensystem, Allgemeines Anpassungssyndrom (GAS), Soziale Arbeit.
Für wen ist dieses Dokument geeignet?
Dieses Dokument ist für alle geeignet, die sich umfassend über Panikstörungen, deren Entstehung und Behandlung informieren möchten. Es ist besonders relevant für Personen, die unter Panikstörungen leiden, sowie für Angehörige, Therapeuten und Sozialarbeiter, die mit Betroffenen arbeiten.
Wo finde ich weitere Informationen?
Leider werden in diesem Dokument keine externen Quellen oder weiterführende Literatur genannt. Für weiterführende Informationen empfehlen wir die Suche nach den oben genannten Schlüsselwörtern in wissenschaftlichen Datenbanken und Fachliteratur.
- Quote paper
- Raphael Rappaport (Author), 2017, Panikattacken, ihre Hintergründe und Interventionsmaßnahmen. Ein Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/369615