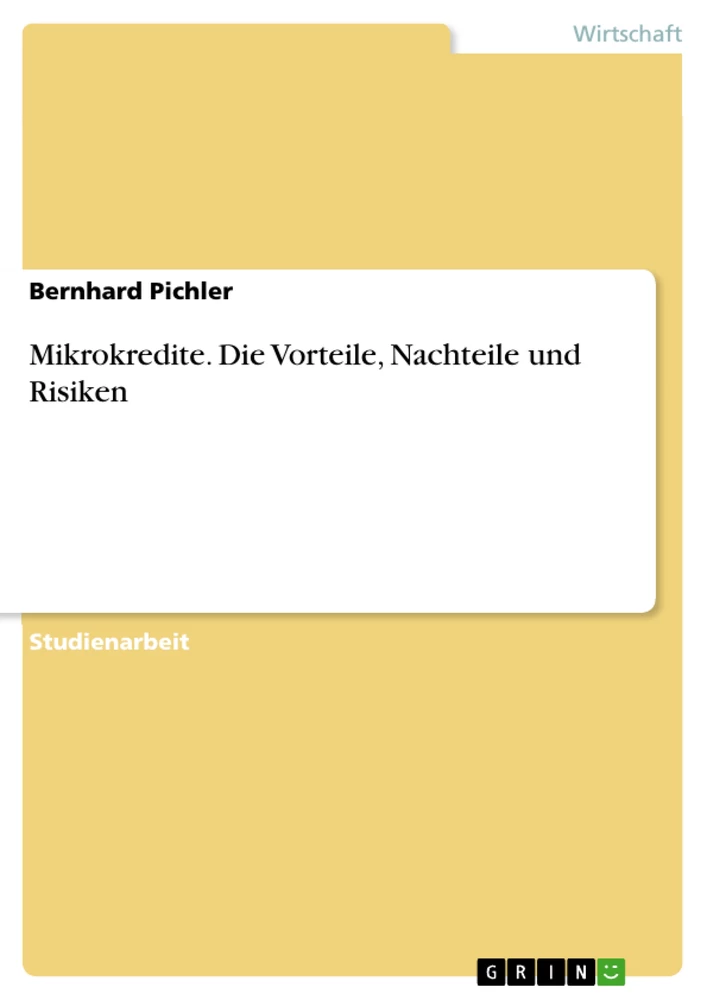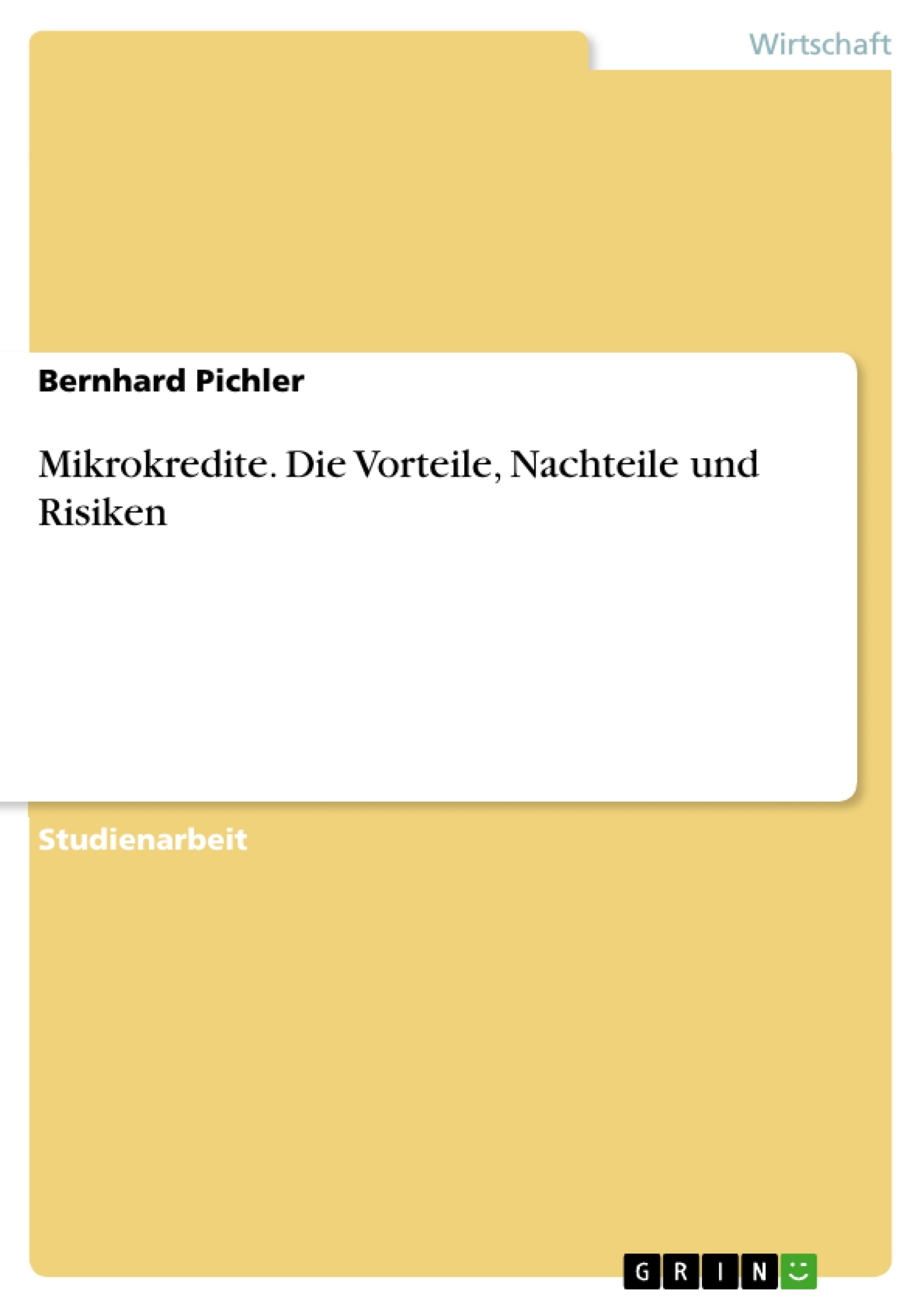Mikrokredite wurden vor etwa 25 Jahren ins Leben gerufen und boomen regelrecht seit 10-15 Jahren. Sie gelten als beliebtes Instrument der Entwicklungshilfe. Ziel ist es arme Menschen finanziell dahingehend zu unterstützen, durch ein Kleingeschäft wirtschaftlich aktiv zu werden und somit ihren Lebensstandard zu verbessern. Tatsächlich birgt das System auch zahlreiche Gefahren, die in der öffentlichen Diskussion oft ausgeblendet werden.
Hier schließt die Frage an, ob es ausreicht Finanzdienstleistungen zu verteilen, oder ob auch zusätzlich eine Unterstützung der geförderten Menschen durch Beratung und Fachwissen im Umgang mit Geld und Investitionen notwendig ist
Inhaltsverzeichnis
- 1. Historische Entwicklung und Relevanz
- 2. Effektivität
- 3. Risiken
- 4. Marktpotenzial
- 5. Kritische Betrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Mikrokredite, ihre historische Entwicklung, Effektivität, Risiken und ihr Marktpotenzial. Sie analysiert kritisch die Vor- und Nachteile dieses Finanzierungsmodells und beleuchtet verschiedene Perspektiven.
- Historische Entwicklung und Bedeutung von Mikrokrediten
- Effektivität von Mikrokrediten bei der Armutsbekämpfung
- Risiken und Herausforderungen im Zusammenhang mit Mikrokrediten
- Das Marktpotenzial von Mikrokrediten und deren Rolle in der Entwicklungszusammenarbeit
- Kritische Betrachtung der Mikrofinanzierung und ethische Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Historische Entwicklung und Relevanz: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung von Mikrokrediten in den letzten 20 Jahren, insbesondere den starken Anstieg seit dem Mikrokredit-Boom. Es erwähnt den Einfluss des Nobelpreises für Mohammed Yunus und die Grameen Bank, sowie die Verbindung zu früheren Modellen nationaler und internationaler Entwicklungshilfe. Der Text hebt die Erfolge von Mikrokrediten im Zugang zu Kapital und Sparmöglichkeiten für arme Menschen hervor, unterscheidet aber auch die Abhängigkeit der Kreditvergabe von Armut und fehlendem Kapitalzugang. Der zunehmende Bedarf an Mikrokrediten wird auch für westliche Gesellschaften beschrieben, mit Fokus auf den eingeschränkten Zugang armer Menschen zu Finanzdienstleistungen. Die Herausforderung, faire Finanzdienstleistungen für marginalisierte Gruppen anzubieten, wird als zentrales Thema hervorgehoben.
2. Effektivität: Das Kapitel diskutiert die Effektivität von Mikrokrediten als Instrument zur Armutsbekämpfung. Es stellt einen Wandel in der Perspektive dar: anfängliche Hoffnungen auf umfassende Armutsbekämpfung stehen im Gegensatz zu neueren Studien, die negative Auswirkungen wie Überschuldung und sogar Selbstmorde in Indien belegen. Gleichzeitig wird der „Double-Bottom-Line“-Effekt hervorgehoben: ein beidseitiger Vorteil für arme Kreditnehmer und Investoren durch höhere Gewinne aus Investitionen in kapitalschwache Unternehmen. Das Kapitel bezieht sich auf ökonomische Prinzipien abnehmender Grenzerlöse und erläutert, wie Mikrokredite durch neue Allianzen zwischen Investoren, Banken und NGOs verbreitet werden. Die Rolle von NGOs in der Erreichung abgelegene Kreditnehmer aufgrund ihrer lokalen Kenntnisse wird ebenfalls betont.
3. Risiken: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Risiken der Mikrofinanzierung. Es hinterfragt, ob Mikrokredite tatsächlich marginalisierte Personen unterstützen oder nur wirtschaftlich aktive Individuen. Die Anpassungsfähigkeit von Mikrokreditinstituten (MFIs) an Umweltbedingungen, Klimawandel und Naturkatastrophen wird thematisiert. Es werden Fragen nach der ökonomischen Rentabilität von MFIs und der ethischen Unbedenklichkeit von Mikrokrediten im Kontext des Kapitalmarktes aufgeworfen. Die Kapitel betont kritische Forschungsergebnisse, die wesentliche Fehleinschätzungen bei Mikrokrediten aufzeigen und den Zusammenhang mit neoliberalen Ansätzen in der Entwicklungszusammenarbeit und daraus resultierenden Verschuldungsproblemen beleuchten.
Schlüsselwörter
Mikrokredite, Mikrofinanzierung, Armutsbekämpfung, Entwicklungszusammenarbeit, Risiken, Effektivität, Marktpotenzial, Double-Bottom-Line, Neoliberalismus, marginalisierte Gruppen, Kapitalzugang, Verschuldung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Mikrokrediten
Was ist der Inhalt dieser Arbeit über Mikrokredite?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über Mikrokredite. Sie beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter. Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung, Effektivität, Risiken und das Marktpotenzial von Mikrokrediten und analysiert kritisch deren Vor- und Nachteile.
Welche Themen werden in den einzelnen Kapiteln behandelt?
Kapitel 1 beleuchtet die historische Entwicklung von Mikrokrediten, ihren Einfluss auf den Zugang zu Kapital und die Herausforderungen bei der Bereitstellung fairer Finanzdienstleistungen für marginalisierte Gruppen. Kapitel 2 diskutiert die Effektivität von Mikrokrediten bei der Armutsbekämpfung, berücksichtigt dabei sowohl positive Aspekte (z.B. Double-Bottom-Line) als auch negative Auswirkungen wie Überschuldung. Kapitel 3 befasst sich mit den Risiken der Mikrofinanzierung, kritischen Forschungsergebnissen und dem Zusammenhang mit neoliberalen Ansätzen. Es hinterfragt, ob Mikrokredite tatsächlich marginalisierte Personen unterstützen und thematisiert die Anpassungsfähigkeit von MFIs an Umweltbedingungen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht Mikrokredite, ihre historische Entwicklung, Effektivität, Risiken und ihr Marktpotenzial. Sie analysiert kritisch die Vor- und Nachteile dieses Finanzierungsmodells und beleuchtet verschiedene Perspektiven, inklusive der ethischen Implikationen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Mikrokredite, Mikrofinanzierung, Armutsbekämpfung, Entwicklungszusammenarbeit, Risiken, Effektivität, Marktpotenzial, Double-Bottom-Line, Neoliberalismus, marginalisierte Gruppen, Kapitalzugang, Verschuldung.
Welche Rolle spielen NGOs bei der Mikrokreditvergabe?
NGOs spielen eine wichtige Rolle, insbesondere bei der Erreichung abgelegener Kreditnehmer aufgrund ihrer lokalen Kenntnisse und ihrer Fähigkeit, die Bedürfnisse dieser Gruppen besser zu verstehen.
Welche kritischen Aspekte werden in der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit beleuchtet kritische Forschungsergebnisse, die negative Auswirkungen von Mikrokrediten wie Überschuldung und Selbstmorde aufzeigen. Sie hinterfragt die tatsächliche Unterstützung marginalisierter Personen durch Mikrokredite und den Zusammenhang mit neoliberalen Ansätzen in der Entwicklungszusammenarbeit. Die ethische Unbedenklichkeit von Mikrokrediten im Kontext des Kapitalmarktes wird ebenfalls kritisch hinterfragt.
Welche positiven Auswirkungen von Mikrokrediten werden genannt?
Die Arbeit hebt den verbesserten Zugang zu Kapital und Sparmöglichkeiten für arme Menschen hervor und beschreibt den „Double-Bottom-Line“-Effekt: einen beidseitigen Vorteil für arme Kreditnehmer und Investoren durch höhere Gewinne aus Investitionen in kapitalschwache Unternehmen.
Wie wird die Effektivität von Mikrokrediten bewertet?
Die Arbeit zeigt einen Wandel in der Perspektive auf die Effektivität von Mikrokrediten. Anfängliche Hoffnungen auf umfassende Armutsbekämpfung stehen im Gegensatz zu neueren Studien, die negative Auswirkungen belegen. Die Bewertung der Effektivität ist differenziert und berücksichtigt sowohl positive als auch negative Aspekte.
- Quote paper
- Bernhard Pichler (Author), 2013, Mikrokredite. Die Vorteile, Nachteile und Risiken, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/367629