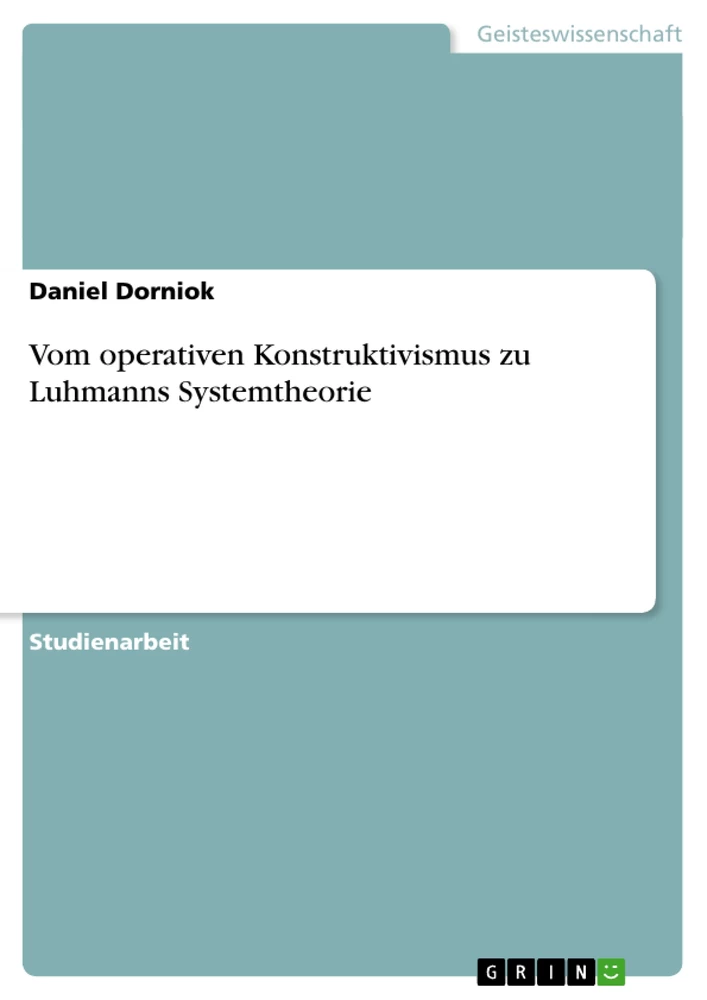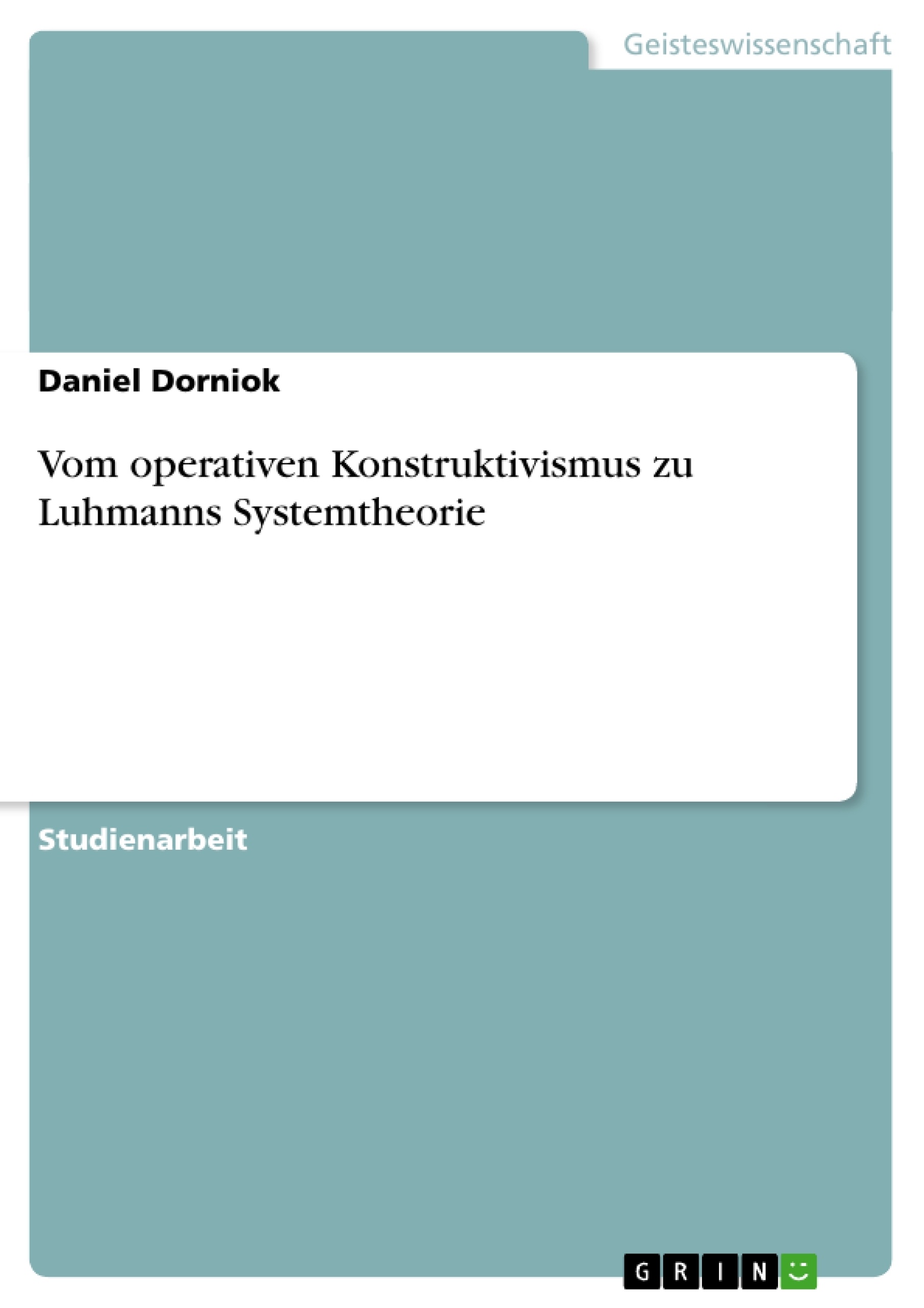Die Systemtheorie will eine Universaltheorie sein. Eine Universaltheorie, die universal anwendbar und selbstreflexiv ist, insofern sie auch sich selbst als Gegenstand ihrer Theorie behandeln können muss. Da eine Universaltheorie ein kohärentes Theoriegebäude zum Ziel hat, kommt sie nicht darum herum, auch ihre eigene Erkenntnistheorie zu stellen. Luhmanns erkenntnistheoretische Position kann als Grundlage und zugleich als formgebend für seine Gesellschaftstheorie gesehen werden. Sie verhilft die Systemtheorie zu einer selbstreferentiellzirkulären Universaltheorie zu machen, die sich also selbst mit einbezieht und damit über das Auseinanderfallen von Erkenntnis und Gegenstand - wie noch in der Erkenntnis klassischer Erkenntnistheorien - hinausgeht. Gesellschaft wird in der Gesellschaft beobachtet, Gesellschaft beobachtet sich somit selbst. Es gibt keine Superposition der Beobachtung mehr, keinen archimedischen Punkt für die Entscheidung für Unterscheidungen, keine beobachtungsunabhängige Beobachtung. Es kann immer nur das beobachtet werden, was beobachtet wird. Die dem zugrundeliegende bzw. vorausgesetzte Unterscheidung kann nicht gesehen werden, sie ist der blinde Fleck der Beobachtung. Dem kann auch die Systemtheorie nicht entgehen, aber sie ist sich dieser Begebenheit bewusst und kann sie reflektieren. Wie sich und ob sich diese theoretische Position halten lässt und was dies schließlich für die Erkenntnis und dann auch Wissen und Wissenschaft bedeutet, soll das Thema dieser Arbeit sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Operativer Konstruktivismus
- 2.1 Beobachtung
- 2.1.1 Unterscheidung
- 2.1.2 Bezeichnung
- 2.1.3 Crossing, Marked state/Unmarked state, Form, Re-entry
- 2.1.4 Beobachtung erster Ordnung
- 2.1.5 Beobachtung zweiter Ordnung
- 2.1.6 Beobachtung dritter Ordnung
- 2.1.7 Paradoxie der Beobachtung
- 3. Paradoxien Allgemein
- 4. Beobachtungsabhängigkeit von Realität und Welt
- 5. Systemtheorie als selbstreferentiell-zirkulären Universaltheorie und die Konsequenzen für Wissen und Wissenschaft
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verbindung zwischen operativem Konstruktivismus und Luhmanns Systemtheorie als selbstreferentiell-zirkuläre Universaltheorie. Das Hauptziel ist es, die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Systemtheorie zu beleuchten und deren Konsequenzen für das Verständnis von Wissen und Wissenschaft aufzuzeigen. Dabei wird der Fokus auf die Rolle der Beobachtung und die daraus resultierenden Paradoxien gelegt.
- Operativer Konstruktivismus und seine zentralen Elemente (Beobachtung, Unterscheidung).
- Paradoxien der Beobachtung und deren Auswirkungen auf die Erkenntnistheorie.
- Luhmanns Systemtheorie als selbstreferentiell-zirkuläre Universaltheorie.
- Konsequenzen der Systemtheorie für das Verständnis von Wissen und Wissenschaft.
- Vergleichende Betrachtung des Konstruktivismus und der Systemtheorie.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt die Systemtheorie als Universaltheorie vor, die sich selbst als Gegenstand ihrer Betrachtung mit einbezieht. Sie erläutert Luhmanns erkenntnistheoretische Position als Grundlage seiner Gesellschaftstheorie und hebt die Bedeutung der Selbstreferenzialität und Zirkularität hervor. Das zentrale Problem der Arbeit ist die Untersuchung der Tragfähigkeit dieser theoretischen Position und deren Auswirkungen auf Erkenntnis, Wissen und Wissenschaft. Der operative Konstruktivismus wird als Ausgangspunkt der Betrachtung gewählt, wobei die explizite Darstellung des Formenkalküls von George Spencer Brown ausgelassen wird. Die Vielfältigkeit des Konstruktivismus wird angesprochen, und es wird auf die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede eingegangen.
2. Operativer Konstruktivismus: Dieses Kapitel beschreibt den operativen oder systemtheoretischen Konstruktivismus, der Unterscheidungen wie Idee/Realität oder Subjekt/Objekt durch Unterscheidungen wie Beobachtung und System ersetzt. Erkenntnis wird als unterscheidungsabhängig beschrieben, wobei nur das wahrgenommen werden kann, was durch die verwendeten Unterscheidungen unterschieden wird. Autopoietische Systeme und ihre kognitive Offenheit durch operative Geschlossenheit werden eingeführt. Die Selbstreferenz als Voraussetzung für weitere Formen der Selbstreferenz und die kognitive Öffnung zur Umwelt werden diskutiert. Der operative Konstruktivismus wird im Kontext der Arbeiten von Foerster und Roth betrachtet, wobei die konstruktivistische Auffassung der Wahrnehmung und Realität hervorgehoben wird. Der radikale Konstruktivismus von Ernst von Glasersfeld wird kurz erwähnt, der das Erkennen einer ontologischen Wirklichkeit ausschließt.
Schlüsselwörter
Operativer Konstruktivismus, Systemtheorie, Luhmann, Selbstreferenz, Zirkularität, Beobachtung, Unterscheidung, Paradoxien, Erkenntnis, Wissen, Wissenschaft, Universaltheorie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Operativer Konstruktivismus und Luhmanns Systemtheorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verbindung zwischen operativem Konstruktivismus und Luhmanns Systemtheorie als selbstreferentiell-zirkuläre Universaltheorie. Das Hauptziel ist die Beleuchtung der erkenntnistheoretischen Grundlagen der Systemtheorie und deren Konsequenzen für Wissen und Wissenschaft, wobei der Fokus auf Beobachtung und Paradoxien liegt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den operativen Konstruktivismus mit seinen zentralen Elementen (Beobachtung, Unterscheidung), Paradoxien der Beobachtung und deren Auswirkungen auf die Erkenntnistheorie, Luhmanns Systemtheorie als selbstreferentiell-zirkuläre Universaltheorie, die Konsequenzen dieser Theorie für Wissen und Wissenschaft und einen Vergleich zwischen Konstruktivismus und Systemtheorie.
Was ist der operative Konstruktivismus?
Der operative Konstruktivismus, der in der Arbeit behandelt wird, ersetzt Unterscheidungen wie Idee/Realität oder Subjekt/Objekt durch Unterscheidungen wie Beobachtung und System. Erkenntnis wird als unterscheidungsabhängig beschrieben; wahrgenommen werden kann nur, was durch die verwendeten Unterscheidungen unterschieden wird. Autopoietische Systeme und ihre kognitive Offenheit durch operative Geschlossenheit werden eingeführt. Die Selbstreferenz und kognitive Öffnung zur Umwelt werden diskutiert.
Welche Rolle spielt die Beobachtung im Kontext der Arbeit?
Die Rolle der Beobachtung ist zentral. Die Arbeit untersucht die Beobachtung erster, zweiter und dritter Ordnung, sowie die Paradoxien der Beobachtung und deren Auswirkungen auf die Erkenntnistheorie. Die Beobachtungsabhängigkeit von Realität und Welt wird analysiert.
Was ist Luhmanns Systemtheorie?
Luhmanns Systemtheorie wird als selbstreferentiell-zirkuläre Universaltheorie beschrieben. Die Arbeit beleuchtet ihre erkenntnistheoretischen Grundlagen und deren Konsequenzen für das Verständnis von Wissen und Wissenschaft. Die Selbstreferenzialität und Zirkularität der Theorie sind entscheidende Aspekte.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Operativer Konstruktivismus, Systemtheorie, Luhmann, Selbstreferenz, Zirkularität, Beobachtung, Unterscheidung, Paradoxien, Erkenntnis, Wissen, Wissenschaft, Universaltheorie.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zum operativen Konstruktivismus (mit Unterkapiteln zur Beobachtung), ein Kapitel zu Paradoxien allgemein, ein Kapitel zur Beobachtungsabhängigkeit von Realität und Welt, ein Kapitel zur Systemtheorie als selbstreferentiell-zirkuläre Universaltheorie und deren Konsequenzen, und ein Fazit. Kapitelzusammenfassungen sind enthalten.
Welche Autoren werden erwähnt?
Die Arbeit erwähnt Foerster, Roth und Ernst von Glasersfeld im Kontext des Konstruktivismus.
Wird der Formenkalkül von George Spencer Brown explizit dargestellt?
Nein, die explizite Darstellung des Formenkalküls von George Spencer Brown wird ausgelassen.
- Quote paper
- Daniel Dorniok (Author), 2004, Vom operativen Konstruktivismus zu Luhmanns Systemtheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/36662