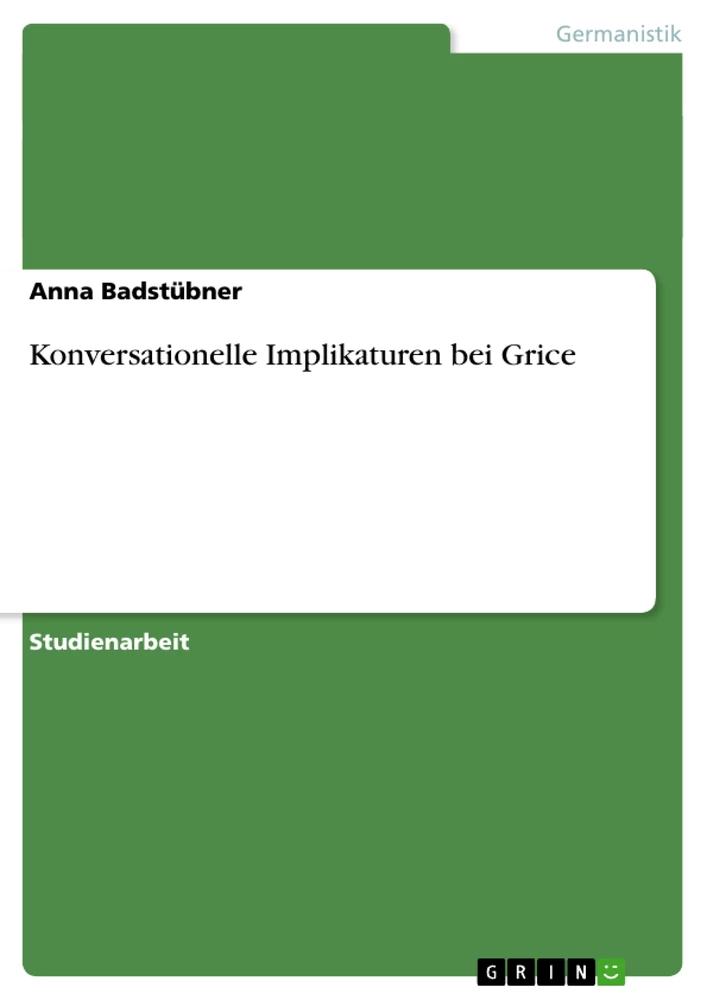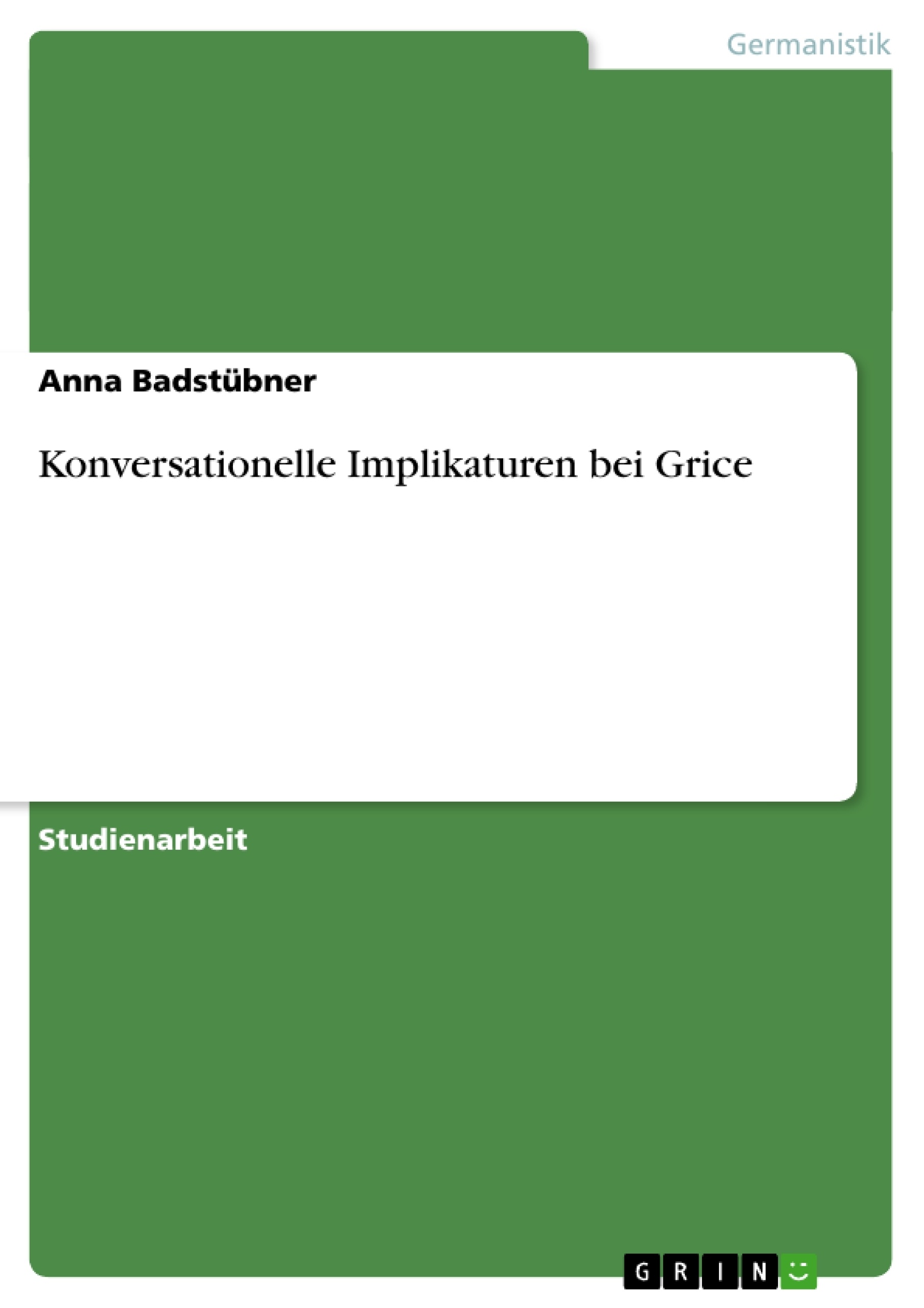Einleitung oder Gesagtes und Gemeintes
Nicht immer geht aus der wörtlichen Bedeutung einer sprachlichen Äußerung hervor, was der Sprecher tatsächlich meint. Stattdessen ist im Gesagten oft nicht enthalten, was gemeint ist. Es wird also mehr ausgedrückt als in der wörtlichen Bedeutung enthalten ist. Wie aber ist es möglich, etwas anderes zu sagen als man meint, und woher nimmt der Sprecher die Sicherheit zu wissen, vom Hörer richtig interpretiert zu werden (vgl. Keller 1995)?
Der Sprachphilosoph Herbert Paul Grice hat mit seiner Theorie der konversationellen Implikaturen versucht, allgemeine Prinzipien des Gebrauchs von Sprache zu formulieren, anhand derer erklärt werden kann, wie der Hörer einer Äußerung das vom Sprecher Gemeinte rekonstruieren und erkennen kann. Grice (nach Thimm 1995) unterscheidet das Gesagte – den logischen Inhalt – und das Implikatierte. Unter Kommunikation versteht Grice kooperatives, rationales Handeln – Interaktion –, bei der es darum geht, Verständigung zu erlangen (vgl. Grice 1975; Linke, Nussbaumer & Portmann 1996; Schneider 2001; Wunderlich 1972). Da die Verständigung zwischen den Gesprächspartnern eine Grundvoraussetzung von Kommunikation ist, kann Kommunikation ohne ein wenigstens minimales gemeinsames Interesse also nicht zustande kommen (vgl. Linke, Nussbaumer & Portmann 1996).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung oder Gesagtes und Gemeintes
- 2. Das Kooperationsprinzip und die Konversationsmaximen
- 3. Die konversationelle Implikatur
- 3.1 Die Begriffe Implikatur und implikatieren
- 3.2 Die konversationelle Implikatur einer Äußerung
- 4. Implikaturentests
- 4.1 Rekonstruierbarkeit
- 4.2 Kontextabhängigkeit
- 4.3 Streichbarkeit
- 5. Typen konversationeller Implikaturen
- 6. Schluss oder Kritik an der Griceschen Theorie
- 6.1 Kritik an den Konversationsmaximen
- 6.2 Kritik an der gesamten Implikaturentheorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Theorie der konversationellen Implikaturen von Herbert Paul Grice. Ziel ist es, Grice's Konzept des Kooperationsprinzips und der Konversationsmaximen zu erläutern und dessen Anwendung auf die Interpretation von Äußerungen zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Arten konversationeller Implikaturen und diskutiert kritische Auseinandersetzungen mit Grice's Theorie.
- Das Kooperationsprinzip und die Konversationsmaximen
- Konversationelle Implikaturen und deren Arten
- Der Unterschied zwischen Gesagtem und Gemeintem
- Tests zur Identifizierung von Implikaturen
- Kritik an Grice's Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung oder Gesagtes und Gemeintes: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Diskrepanz zwischen wörtlicher Bedeutung und Sprecherintention in sprachlichen Äußerungen. Sie führt in die Theorie der konversationellen Implikaturen von Grice ein, die versucht, die Rekonstruktion des Sprechergemeinten durch den Hörer zu erklären. Grice unterscheidet dabei zwischen dem Gesagten (logischem Inhalt) und dem Implikatierten, wobei Kommunikation als kooperatives, rationales Handeln zur Verständigung verstanden wird. Die Einleitung betont die Notwendigkeit eines gemeinsamen Interesses für erfolgreiche Kommunikation.
2. Das Kooperationsprinzip und die Konversationsmaximen: Dieses Kapitel präsentiert Grice's Kooperationsprinzip – die Erwartung, dass Gesprächsteilnehmer ihren Beitrag dem Gesprächsziel entsprechend gestalten. Es wird in vier Maximen entfaltet: Quantität (informativ, aber nicht übermäßig), Qualität (wahrheitsgemäß), Relevanz (relevant) und Modalität (klar und prägnant). Die Maximen werden nicht als moralische Normen, sondern als Regeln rationalen Verhaltens interpretiert, die für das Zustandekommen von Konversation unerlässlich sind, obwohl ihre Beachtung variabel ist.
3. Die konversationelle Implikatur: Dieses Kapitel definiert den Begriff der konversationellen Implikatur und differenziert ihn von der konventionellen Implikatur. Der Fokus liegt auf den konversationellen Implikaturen, die einen wesentlichen Teil des Verstehensprozesses bilden, da sie den Unterschied zwischen dem Gesagten und dem Gemeinten erklären. Die Unterkapitel befassen sich mit der Begriffsklärung und der genaueren Beschreibung der konversationellen Implikatur einer Äußerung im Kontext von Grice's Theorie.
4. Implikaturentests: Hier werden verschiedene Tests zur Identifizierung konversationeller Implikaturen vorgestellt: Rekonstruierbarkeit (ob das Gemeinte aus dem Kontext erschlossen werden kann), Kontextabhängigkeit (Abhängigkeit des Gemeinten vom Kontext) und Streichbarkeit (ob das Gemeinte weggelassen werden kann, ohne den Aussagegehalt zu verändern). Diese Tests helfen, die Implikaturen von der wörtlichen Bedeutung zu trennen und deren Bedeutung im Kommunikationsprozess zu verstehen.
5. Typen konversationeller Implikaturen: Dieses Kapitel (dessen Inhalt nicht explizit im Text erläutert wird) würde vermutlich verschiedene Arten von konversationellen Implikaturen nach Grice's Theorie behandeln und klassifizieren, basierend auf den Verletzungen oder Ausnutzungen der Konversationsmaximen.
Schlüsselwörter
Konversationelle Implikaturen, Kooperationsprinzip, Konversationsmaximen, Herbert Paul Grice, Gesagtes und Gemeintes, Implikatur, Implikation, Kommunikation, Verständigung, Sprachphilosophie, Sprechakte.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Konversationelle Implikaturen nach Grice
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich mit der Theorie der konversationellen Implikaturen von Herbert Paul Grice. Sie untersucht das Kooperationsprinzip und die Konversationsmaximen, erläutert deren Anwendung auf die Interpretation von Äußerungen und analysiert verschiedene Arten konversationeller Implikaturen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der kritischen Auseinandersetzung mit Grice's Theorie.
Was sind die zentralen Themen der Hausarbeit?
Die zentralen Themen sind das Kooperationsprinzip und die Konversationsmaximen, konversationelle Implikaturen und deren Arten, der Unterschied zwischen Gesagtem und Gemeintem, Tests zur Identifizierung von Implikaturen und die Kritik an Grice's Theorie.
Was ist das Kooperationsprinzip nach Grice?
Das Kooperationsprinzip besagt, dass Gesprächsteilnehmer ihren Beitrag dem Gesprächsziel entsprechend gestalten. Es wird in vier Maximen entfaltet: Quantität (informativ, aber nicht übermäßig), Qualität (wahrheitsgemäß), Relevanz (relevant) und Modalität (klar und prägnant). Diese Maximen sind Regeln rationalen Verhaltens, nicht moralische Normen.
Was sind konversationelle Implikaturen?
Konversationelle Implikaturen sind Schlussfolgerungen, die ein Hörer aus einer Äußerung zieht, die über die wörtliche Bedeutung hinausgehen. Sie erklären den Unterschied zwischen dem Gesagten (logischem Inhalt) und dem Gemeinten. Sie entstehen durch die (offensichtliche oder verdeckte) Verletzung oder Ausnutzung der Konversationsmaximen.
Wie unterscheidet sich das Gesagte vom Gemeinten?
Das "Gesagte" bezieht sich auf die wörtliche Bedeutung einer Äußerung, während das "Gemeinte" die vom Sprecher tatsächlich intendierte Bedeutung umfasst. Konversationelle Implikaturen überbrücken die Lücke zwischen Gesagtem und Gemeintem.
Welche Tests gibt es zur Identifizierung von Implikaturen?
Die Hausarbeit beschreibt drei Tests: Rekonstruierbarkeit (ob das Gemeinte aus dem Kontext erschlossen werden kann), Kontextabhängigkeit (Abhängigkeit des Gemeinten vom Kontext) und Streichbarkeit (ob das Gemeinte weggelassen werden kann, ohne den Aussagegehalt zu verändern).
Welche Arten von konversationellen Implikaturen werden behandelt?
Die Hausarbeit erwähnt verschiedene Arten von konversationellen Implikaturen, die detailliert in Kapitel 5 beschrieben werden (jedoch fehlt der explizite Inhalt im vorliegenden Auszug). Diese Klassifizierung basiert wahrscheinlich auf den Verletzungen oder Ausnutzungen der Konversationsmaximen.
Welche Kritikpunkte an Grice's Theorie werden diskutiert?
Kapitel 6 befasst sich mit Kritikpunkten an den Konversationsmaximen und der gesamten Implikaturentheorie. Der konkrete Inhalt dieser Kritik ist im vorliegenden Textfragment nicht detailliert aufgeführt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter umfassen: Konversationelle Implikaturen, Kooperationsprinzip, Konversationsmaximen, Herbert Paul Grice, Gesagtes und Gemeintes, Implikatur, Implikation, Kommunikation, Verständigung, Sprachphilosophie, Sprechakte.
- Quote paper
- Anna Badstübner (Author), 2002, Konversationelle Implikaturen bei Grice, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/36326