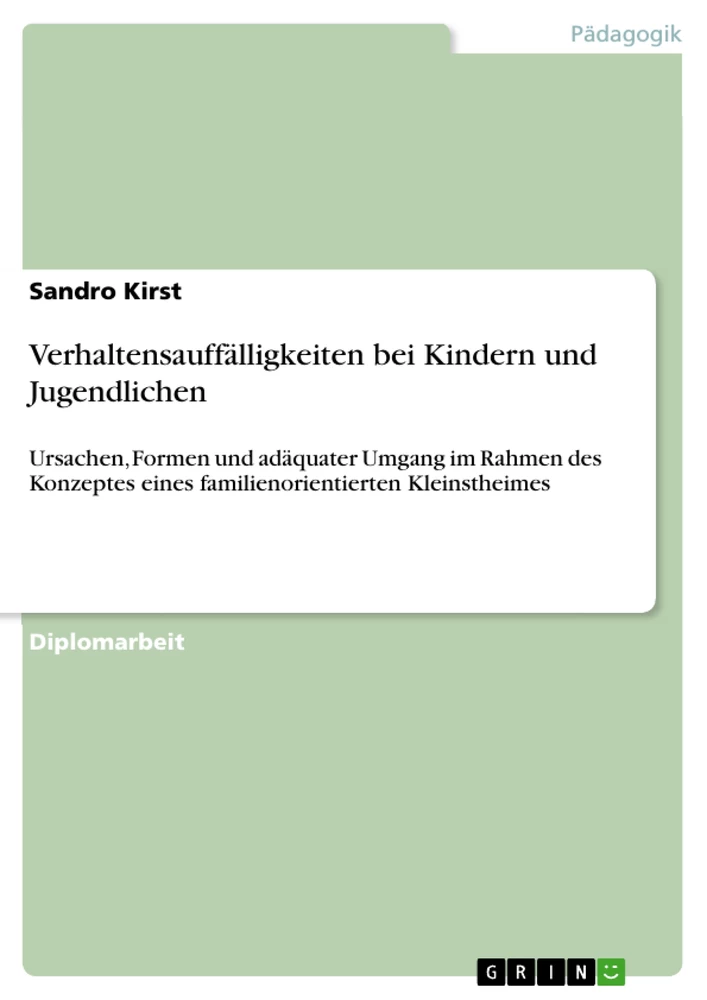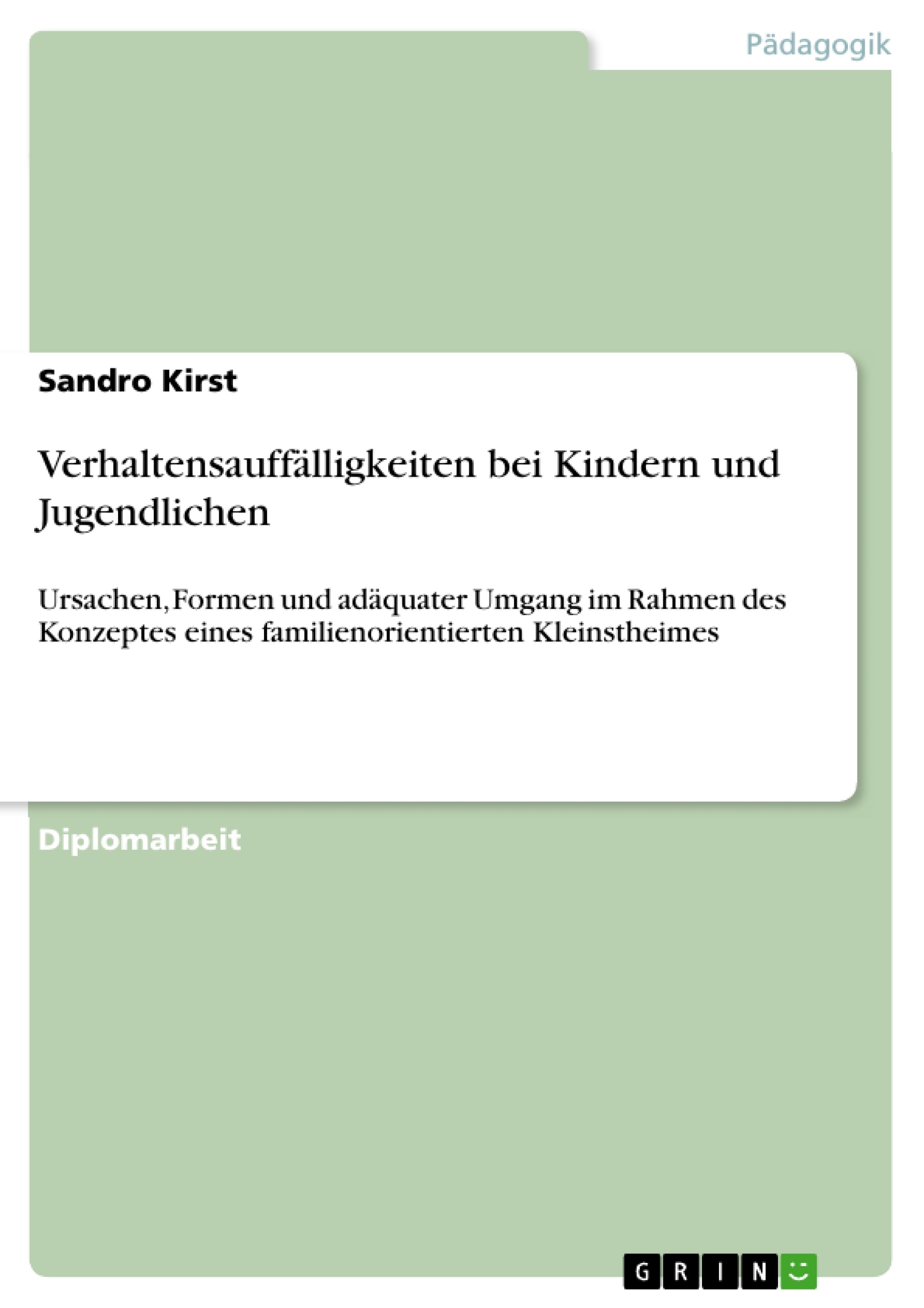Der Titel der Arbeit spricht von Ursachen und adäquatem Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen.
Um Einsicht in diese Problematik zu erlangen und Kenntnisse über pädagogische Möglichkeiten sowie Kompetenzen zu erwerben, beschäftigte sich der Autor dieser Arbeit mit der bereits genannten Problemstellung. Weiterhin soll diese Arbeit eine Orientierungshilfe für Pädagogen und ihre praktische Arbeit im Umgang mit verhaltensauffälligen Kinder und Jugendlichen sein.
So beinhaltet der theoretische Teil die Darstellung des Phasenmodells von Erikson. Im Anschluss daran ist eine nähere Bestimmung des Begriffes Verhaltensauffälligkeiten nötig, um eine Grundlage für die folgenden theoretischen Aussagen zu schaffen.
An die Beschreibung spezieller Auffälligkeiten schließt sich im nächsten Punkt die Ursachenklärung an. Am Ende vom praktischen Teil der Arbeit werden einführende Gedanken zur Heimerziehung vorgestellt, die unter anderem rechtliche Voraussetzungen sowie Ziele und Grenzen beinhalten.
Im praktischen Teil der Arbeit wird die gegenwärtigen Situation eines Kinderhauses in St. Gangloff beschrieben. Es folgen gezielte Interventionsmöglichkeiten, die bei verhaltensauffälligen Kindern erfolgreich eingesetzt werden können. Mit einem Fallbeispiel schließt der praktische Teil.
Als Ergebnisse dieser Arbeit stellt der Autor fest, dass Kinder und Jugendliche bringen mit ihrem Verhalten zum Ausdruck, dass ihre Entwicklung, ihr Leben durch innere und/oder äußere Bedingungen, beeinträchtigt oder sogar bedroht sind.
Weiterhin können verschiedene Ursachen zu gleichen Erscheinungsformen führen und gleiche Ursachen können sehr unterschiedliche Erscheinungsformen hervorbringen.
Wichtig für den Sozialpädagogen ist, dass Interventionen bei Verhaltensauffälligkeiten sollten, um den Bedürfnissen und Möglichkeiten der Kinder zu entsprechen, angepasst an Person, Situation und Setting sein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Phasenmodell der kindlichen Entwicklung nach Erikson
- Oral-Sensorische Phase
- Muskulär-anale Phase
- Lokomotorisch-genitale Phase
- Latenzphase
- Pubertät und Adoleszenz
- Zusammenfassung
- Verhaltensauffälligkeiten
- Begriffsbestimmung
- Ausgewählte Erscheinungsformen
- Minderwertigkeit
- Vermeidungsverhalten
- Angst
- Depressivität
- Aggressivität
- Ursachen und Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten
- Theoretische Ansätze
- Der psychoanalytische Ansatz
- Der lerntheoretische Ansatz
- Der medizinische Ansatz
- Die Sozialisationstheorie
- Das soziale Umfeld als Ursache für Verhaltensauffälligkeiten
- Die Familie als primäre Sozialisationsinstanz
- Die Schule als sekundäre Sozialisationsinstanz
- Auswirkungen von Peer-Gruppen
- Körperliche Konstitution als Ursache für Verhaltensauffälligkeiten
- Körperbehinderungen
- Frühkindliche Hirnschädigungen
- Krankheiten
- Zusammenfassung
- Theoretische Ansätze
- Adäquater Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern
- Erfassen des Ist-Zustandes des Kindes
- Die pädagogisch-therapeutische Arbeit
- Das Prinzip der Subjektzentrierung
- Individualbasale Betreuung und Förderung
- Partizipierende Betreuung und Förderung
- Die gruppenbasale Betreuung und Förderung
- Das Prinzip der Beziehungsstiftung
- Heimerziehung im Kontext des KJHG
- Rechtsgrundlagen
- Kennzeichnen der Heimpädagogik
- Aktuelle Tendenzen
- Ziele und Grenzen
- Phasenmodell der kindlichen Entwicklung nach Erikson
- Praktischer Teil
- Das Kinderhaus „Am Wald“
- Institutionelle Bedingungen
- Klientel
- Interdisziplinäre Arbeit
- Elternarbeit
- Teamarbeit
- Kooperation mit Behörden
- Pädagogische Fachkräfte
- Pädagogische Regelleistungen
- Supervision und Fortbildung
- Supervision
- Fortbildung
- Neue pädagogische Konzeption
- Mitarbeiter
- Therapeutische Ressourcen
- Pädagogische Interventionen im Freizeitbereich
- Gezielte Interventionsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag
- Pädagogische Grundgedanken
- Stimulusorientierte Interventionen
- Signale geben
- Autoritäre Verbote
- Umleiten
- Festhalten
- Aufklärung über Folgen
- Positive Aufforderung
- Ich-Botschaften senden
- Organismusorientierte Maßnahmen
- Verständnis zeigen
- Interesse demonstrieren
- Verbalisieren von Gefühlen und Erlebnisinhalten des Kindes
- Rationale Konfliktlösungen
- Konsequenzorientierte Maßnahmen
- Ignorieren
- Humorvolles Reagieren
- Erlaubnisse Erteilen
- Provozieren des Fehlverhaltens
- Zusammenfassung
- Fallbeispiel
- Anamnese
- Diagnose
- Schulbesuch
- Heimunterbringung
- Analyse
- Prognose
- Das Kinderhaus „Am Wald“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen im Kontext eines familienorientierten Kleinstheimes. Ziel ist es, Ursachen und Erscheinungsformen dieser Verhaltensweisen zu beleuchten und adäquate Umgangsweisen im pädagogischen Alltag zu beschreiben.
- Phasen der kindlichen Entwicklung und deren Einfluss auf Verhalten
- Ursachen und Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten (psychoanalytisch, lerntheoretisch, medizinisch, sozialisationstheoretisch)
- Adäquate pädagogisch-therapeutische Interventionen
- Heimerziehung im Kontext des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG)
- Praxisbeispiel aus einem familienorientierten Kleinstheim
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen ein und beschreibt den Kontext der Arbeit innerhalb eines familienorientierten Kleinstheimes. Sie skizziert die Ziele und den Aufbau der Arbeit.
Phasenmodell der kindlichen Entwicklung nach Erikson: Dieses Kapitel beschreibt Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung. Es werden die einzelnen Phasen (oral-sensorisch, muskulär-anal, lokomotorisch-genital, Latenz, Pubertät/Adoleszenz) detailliert erläutert und ihre Bedeutung für die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten im späteren Leben herausgearbeitet. Die Zusammenfassung fasst die zentralen Aspekte der Theorie und ihre Relevanz für das Verständnis von Verhaltensstörungen zusammen.
Verhaltensauffälligkeiten: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Verhaltensauffälligkeit“ und beschreibt ausgewählte Erscheinungsformen wie Minderwertigkeit, Vermeidungsverhalten, Angst, Depressivität und Aggressivität. Es werden verschiedene theoretische Ansätze (psychoanalytisch, lerntheoretisch, medizinisch, sozialisationstheoretisch) zur Erklärung der Ursachen und Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten vorgestellt, sowie der Einfluss des sozialen Umfeldes (Familie, Schule, Peer-Gruppen) und körperlicher Konstitution (Körperbehinderungen, Hirnschädigungen, Krankheiten) diskutiert. Die Zusammenfassung integriert die verschiedenen Erklärungsansätze und hebt die Komplexität der Ursachen hervor.
Adäquater Umgang mit verhaltensauffälligen Kindern: Dieses Kapitel beschreibt die notwendigen Schritte zur Analyse der Situation eines Kindes mit Verhaltensauffälligkeiten und stellt verschiedene pädagogisch-therapeutische Arbeitsweisen vor. Es betont die Wichtigkeit der Subjektzentrierung, individual- und partizipationsorientierter Förderung sowie der Beziehungsstiftung. Die Zusammenfassung betont die Bedeutung eines ganzheitlichen und individuellen Ansatzes.
Heimerziehung im Kontext des KJHG: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der Heimerziehung im Kontext des KJHG, beschreibt die Kennzeichen der Heimpädagogik, aktuelle Tendenzen und die Ziele und Grenzen dieser Form der Erziehung. Die Zusammenfassung betont den gesetzlichen Rahmen und die Herausforderungen der Heimerziehung.
Das Kinderhaus „Am Wald“: Dieses Kapitel präsentiert einen Fallbeispiel des Kinderhauses „Am Wald“, beschreibt die institutionellen Bedingungen, das Klientel, die interdisziplinäre Zusammenarbeit (Eltern, Team, Behörden), die pädagogischen Fachkräfte, die pädagogischen Leistungen und die Supervisions- und Fortbildungsmöglichkeiten. Die Zusammenfassung gibt einen Überblick über die Struktur und die Praxis des Kinderhauses.
Neue pädagogische Konzeption: Dieses Kapitel beschreibt die neue pädagogische Konzeption des Kinderhauses, einschließlich der Mitarbeiter, therapeutischen Ressourcen und pädagogischen Interventionen im Freizeitbereich. Die Zusammenfassung fasst die zentralen Elemente der neuen Konzeption zusammen.
Gezielte Interventionsmöglichkeiten im pädagogischen Alltag: Dieses Kapitel detailliert verschiedene Interventionsmöglichkeiten, gegliedert nach stimulusorientierten, organismusorientierten und konsequenzorientierten Maßnahmen. Es werden konkrete Beispiele für Interventionen wie Signale geben, autoritäre Verbote, Umleiten, Festhalten, Aufklärung über Folgen, positive Aufforderung, Ich-Botschaften senden, Verständnis zeigen, Interesse demonstrieren, Verbalisieren von Gefühlen, rationale Konfliktlösungen, Ignorieren, humorvolles Reagieren, Erlaubnisse erteilen und das Provozieren von Fehlverhalten gegeben und analysiert. Die Zusammenfassung integriert die verschiedenen Interventionstypen und betont die Notwendigkeit eines flexiblen und situationsangepassten Vorgehens.
Schlüsselwörter
Verhaltensauffälligkeiten, Kinder, Jugendliche, Familienorientierte Kleinstheime, Heimerziehung, KJHG, Pädagogische Interventionen, Psychoanalyse, Lerntheorie, Sozialisationstheorie, Entwicklungsphasen, Therapie, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen in einem familienorientierten Kleinstheim
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen im Kontext eines familienorientierten Kleinstheimes. Sie beleuchtet Ursachen und Erscheinungsformen dieser Verhaltensweisen und beschreibt adäquate Umgangsweisen im pädagogischen Alltag.
Welche Entwicklungsphasen werden betrachtet?
Die Arbeit bezieht sich auf Eriksons Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung. Die einzelnen Phasen (oral-sensorisch, muskulär-anal, lokomotorisch-genital, Latenz, Pubertät/Adoleszenz) werden detailliert erläutert und ihr Einfluss auf die Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten im späteren Leben herausgearbeitet.
Welche Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert verschiedene theoretische Ansätze (psychoanalytisch, lerntheoretisch, medizinisch, sozialisationstheoretisch) zur Erklärung der Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten. Zusätzlich wird der Einfluss des sozialen Umfelds (Familie, Schule, Peer-Gruppen) und körperlicher Konstitution (Körperbehinderungen, Hirnschädigungen, Krankheiten) untersucht.
Welche pädagogisch-therapeutischen Interventionen werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene pädagogisch-therapeutische Arbeitsweisen, die auf Subjektzentrierung, individual- und partizipationsorientierter Förderung sowie Beziehungsstiftung basieren. Konkrete Interventionsmöglichkeiten werden nach stimulusorientierten, organismusorientierten und konsequenzorientierten Maßnahmen gegliedert und mit Beispielen illustriert (z.B. Signale geben, Ich-Botschaften senden, Verständnis zeigen, rationale Konfliktlösungen, Ignorieren).
Welche Rolle spielt das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)?
Die Arbeit beleuchtet die rechtlichen Grundlagen der Heimerziehung im Kontext des KJHG, beschreibt die Kennzeichen der Heimpädagogik, aktuelle Tendenzen und die Ziele und Grenzen dieser Form der Erziehung.
Wie wird das Kinderhaus „Am Wald“ in die Arbeit eingebunden?
Das Kinderhaus „Am Wald“ dient als Fallbeispiel. Die Arbeit beschreibt die institutionellen Bedingungen, das Klientel, die interdisziplinäre Zusammenarbeit (Eltern, Team, Behörden), die pädagogischen Fachkräfte, die pädagogischen Leistungen und die Supervisions- und Fortbildungsmöglichkeiten. Eine neue pädagogische Konzeption wird ebenfalls vorgestellt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Verhaltensauffälligkeiten, Kinder, Jugendliche, Familienorientierte Kleinstheime, Heimerziehung, KJHG, Pädagogische Interventionen, Psychoanalyse, Lerntheorie, Sozialisationstheorie, Entwicklungsphasen, Therapie, Prävention.
Gibt es ein Fallbeispiel?
Ja, die Arbeit enthält ein detailliertes Fallbeispiel eines Kindes aus dem Kinderhaus „Am Wald“, inklusive Anamnese, Diagnose, Schulbesuch, Heimunterbringung, Analyse und Prognose.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird gegeben?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, welche die wichtigsten Punkte jedes Kapitels kurz und prägnant zusammenfassen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Ursachen und Erscheinungsformen von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen zu beleuchten und adäquate Umgangsweisen im pädagogischen Alltag zu beschreiben, insbesondere im Kontext eines familienorientierten Kleinstheimes.
- Quote paper
- Sandro Kirst (Author), 2004, Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/36093