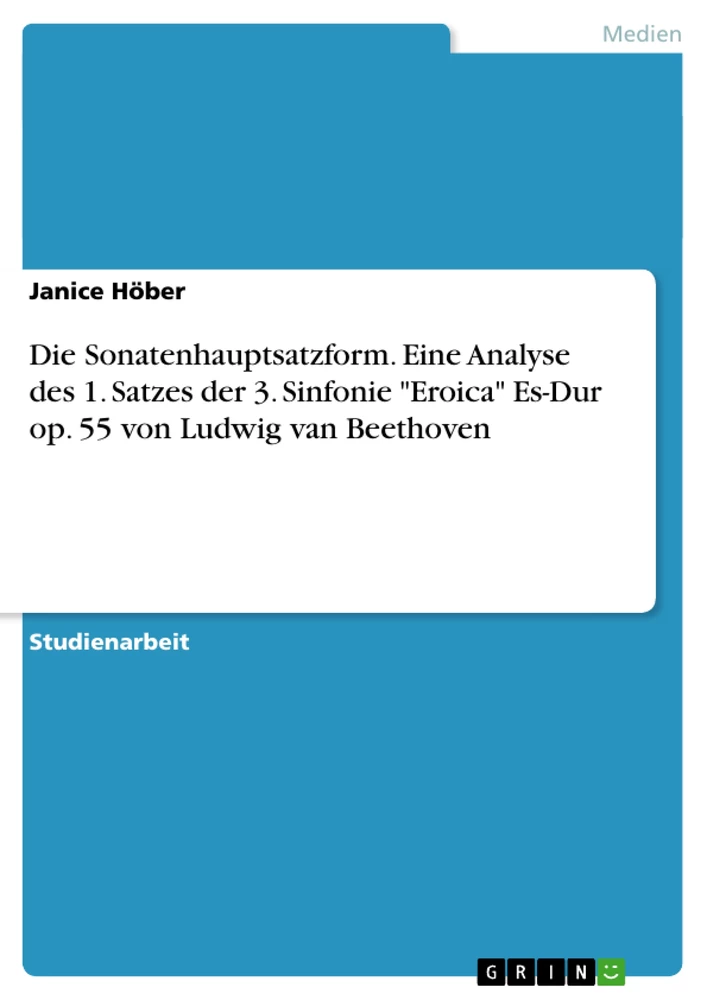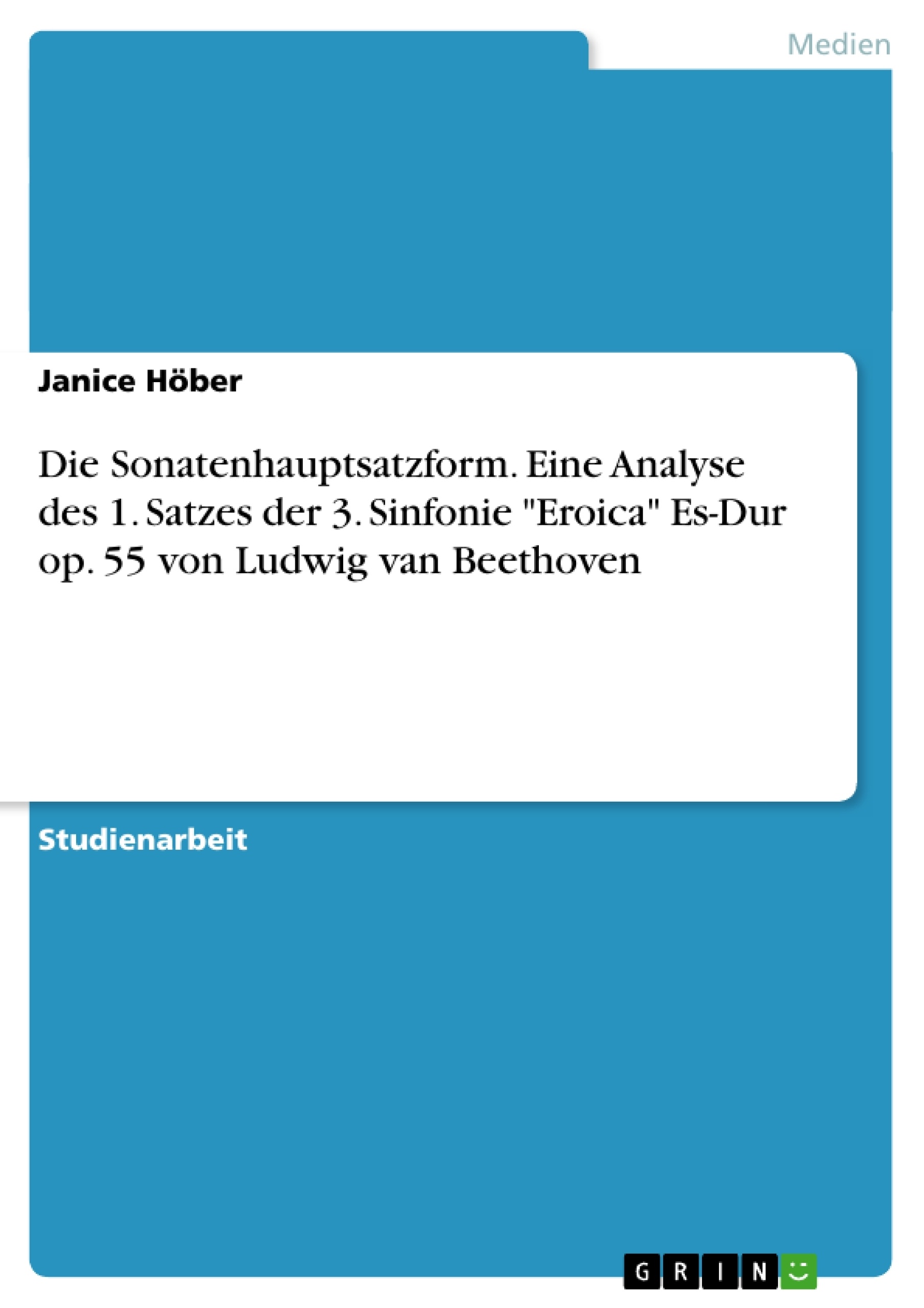Die Zeit der Wiener Klassik wird stets mit den drei großen Komponisten Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart sowie Ludwig van Beethoven und ihren Werken in Verbindung gebracht. Die Instrumentalmusik mit ihren führenden Gattungen Sinfonie, Klaviersonate und Streichquartett rückt während dieser Epoche besonders in den Mittelpunkt des kompositorischen Schaffens. Da sie sich vor allem durch ihre innermusikalischen Gesetzlichkeiten auszeichnet, erklärt sich die besondere Bedeutung, die der formalen Gestaltung zukommt.
Die Sonatenhauptsatzform ist das zentrale Gestaltungsmittel der Instrumentalmusik der Wiener Klassik. Ihre Wurzeln liegen in dem barocken Suitensatz, der sich durch seine zweiteilige Form sowie eine einfache Aufteilung der Tonarten auszeichnet. An der Ausformung des klassischen Sonatenhauptsatzes waren die drei großen Wiener Klassiker mit ihren Kompositionen maßgeblich beteiligt.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit soll sowohl die Entwicklung als auch der Aufbau des klassischen Sonatenhauptsatzes stehen. Dabei wird Beethovens 3. Sinfonie „Eroica" Es-Dur op. 55 als analytisches Beispiel herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Hinführung zum Thema
- 1.2. Abgrenzung des Themas
- 2. Die Sonatenhauptsatzform
- 2.1. Zur Terminologie
- 2.2. Die Entwicklung der Sonatenhauptsatzform
- 2.3. Zum Aufbau des klassischen Sonatenhauptsatzes
- 2.4. Kritische Anmerkungen zum Formbegriff
- 3. Ludwig van Beethovens 3. Sinfonie „Eroica” Es-Dur op. 55 als analytisches Beispiel
- 3.1. Zur Entstehungsgeschichte des Werkes
- 3.2. Der 1. Satz als analytisches Beispiel
- 4. Schlussbetrachtung
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sonatenhauptsatzform, ein zentrales Gestaltungsprinzip der Wiener Klassik. Ziel ist es, die Entwicklung dieser Form von ihren barocken Wurzeln bis hin zu Beethovens „Eroica“ nachzuvollziehen und ihren Aufbau zu erläutern. Die Analyse des ersten Satzes der „Eroica“ dient als praktisches Beispiel für die Anwendung der Sonatenhauptsatzform.
- Entwicklung der Sonatenhauptsatzform vom barocken Suitensatz bis zur Wiener Klassik
- Aufbau des klassischen Sonatenhauptsatzes (Exposition, Durchführung, Reprise)
- Terminologie und begriffliche Präzisierung der Sonatenhauptsatzform
- Analyse des ersten Satzes von Beethovens 3. Sinfonie „Eroica“
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Formbegriff in der Musikwissenschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Sonatenhauptsatzform ein, positioniert sie im Kontext der Wiener Klassik und ihrer zentralen Instrumentalgattungen (Sinfonie, Klaviersonate, Streichquartett). Sie hebt die Bedeutung der formalen Gestaltung in der Musik dieser Epoche hervor und kündigt den Fokus der Arbeit auf die Entwicklung und den Aufbau der Sonatenhauptsatzform an, wobei Beethovens „Eroica“ als analytisches Beispiel dient. Die Abgrenzung des Themas skizziert den Aufbau der Arbeit, mit einem theoretischen Teil (Terminologie, Entwicklung, Aufbau, kritische Anmerkungen) und einem praktischen Teil (Entstehungsgeschichte der „Eroica“, Analyse des ersten Satzes).
2. Die Sonatenhauptsatzform: Dieses Kapitel befasst sich umfassend mit der Sonatenhauptsatzform. Zunächst klärt es die Terminologie und die verschiedenen Bezeichnungen (Sonatenform, Sonatensatzform, Sonatenhauptsatzform). Es beschreibt die historische Entwicklung, beginnend mit dem zweiteiligen barocken Suitensatz und der schrittweisen Erweiterung zu einer dreiteiligen Form unter dem Einfluss von Da-capo-Arie, Instrumentalkonzert und italienischer Opernsinfonie. Die Beiträge von Haydn und Mozart zur Ausgestaltung der Form werden detailliert dargestellt, mit Fokus auf die zunehmende thematische Arbeit und den Kontrast zwischen den Themen. Haydns Entwicklung der Durchführung als zentralen Teil des Satzes und Mozarts ausgewogenere Struktur und thematische Selbstständigkeit der Überleitungen werden besonders hervorgehoben. Das Kapitel endet mit der Darstellung Beethovens als Vollender der Sonatenhauptsatzform.
3. Ludwig van Beethovens 3. Sinfonie „Eroica” Es-Dur op. 55 als analytisches Beispiel: Dieses Kapitel widmet sich Beethovens „Eroica“. Der Abschnitt zur Entstehungsgeschichte des Werkes wird behandelt, wobei die Legende um Napoleon und Beethoven erwähnt, jedoch nicht im Detail untersucht wird. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse des ersten Satzes der Sinfonie, um zu zeigen, wie das formale Prinzip der Sonatenhauptsatzform in diesem Kopfsatz angewendet wird. Die Analyse der übrigen Sätze wird aufgrund des thematischen Schwerpunkts der Arbeit ausgelassen.
Schlüsselwörter
Sonatenhauptsatzform, Sonatenform, Sonatensatzform, Wiener Klassik, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, 3. Sinfonie „Eroica”, barocker Suitensatz, Exposition, Durchführung, Reprise, Formbegriff, Musikgeschichte, Musikalische Formenlehre.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Analyse der Sonatenhauptsatzform anhand Beethovens Eroica
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Sonatenhauptsatzform, ein zentrales Gestaltungsprinzip der Wiener Klassik. Sie verfolgt die Entwicklung dieser Form von ihren barocken Ursprüngen bis zu Beethovens "Eroica" und erläutert ihren Aufbau. Die Analyse des ersten Satzes der "Eroica" dient als praktisches Beispiel.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Sonatenhauptsatzform vom barocken Suitensatz bis zur Wiener Klassik, den Aufbau des klassischen Sonatenhauptsatzes (Exposition, Durchführung, Reprise), die Terminologie und begriffliche Präzisierung der Sonatenhauptsatzform, eine Analyse des ersten Satzes von Beethovens 3. Sinfonie "Eroica" und eine kritische Auseinandersetzung mit dem Formbegriff in der Musikwissenschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Sonatenhauptsatzform, ein Kapitel zur Analyse von Beethovens "Eroica" (speziell der 1. Satz), eine Schlussbetrachtung und ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Aufbau der Arbeit. Das Kapitel zur Sonatenhauptsatzform behandelt die Terminologie, historische Entwicklung und den Aufbau der Form. Das Kapitel zur "Eroica" beinhaltet eine kurze Entstehungsgeschichte und die detaillierte Analyse des ersten Satzes.
Welche Komponisten werden erwähnt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung der Sonatenhauptsatzform und erwähnt insbesondere Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven als zentrale Figuren in diesem Kontext. Haydns Entwicklung der Durchführung und Mozarts ausgewogene Struktur werden besonders hervorgehoben, während Beethoven als Vollender der Form dargestellt wird.
Welche Aspekte der Sonatenhauptsatzform werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Entwicklung der Form von ihren barocken Wurzeln bis zur Wiener Klassik, die verschiedenen Bezeichnungen (Sonatenform, Sonatensatzform, Sonatenhauptsatzform), den Aufbau der klassischen Form mit Exposition, Durchführung und Reprise, sowie eine kritische Betrachtung des Formbegriffs selbst. Die Analyse des ersten Satzes der "Eroica" dient als Fallbeispiel zur praktischen Anwendung der theoretischen Überlegungen.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die Entwicklung und den Aufbau der Sonatenhauptsatzform nachzuvollziehen und zu erläutern, wobei Beethovens "Eroica" als herausragendes Beispiel dient. Die Arbeit soll ein umfassendes Verständnis der Sonatenhauptsatzform vermitteln und die Bedeutung dieser Form in der Wiener Klassik hervorheben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sonatenhauptsatzform, Sonatenform, Sonatensatzform, Wiener Klassik, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, 3. Sinfonie „Eroica”, barocker Suitensatz, Exposition, Durchführung, Reprise, Formbegriff, Musikgeschichte, Musikalische Formenlehre.
- Quote paper
- Janice Höber (Author), 2004, Die Sonatenhauptsatzform. Eine Analyse des 1. Satzes der 3. Sinfonie "Eroica" Es-Dur op. 55 von Ludwig van Beethoven, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/35977