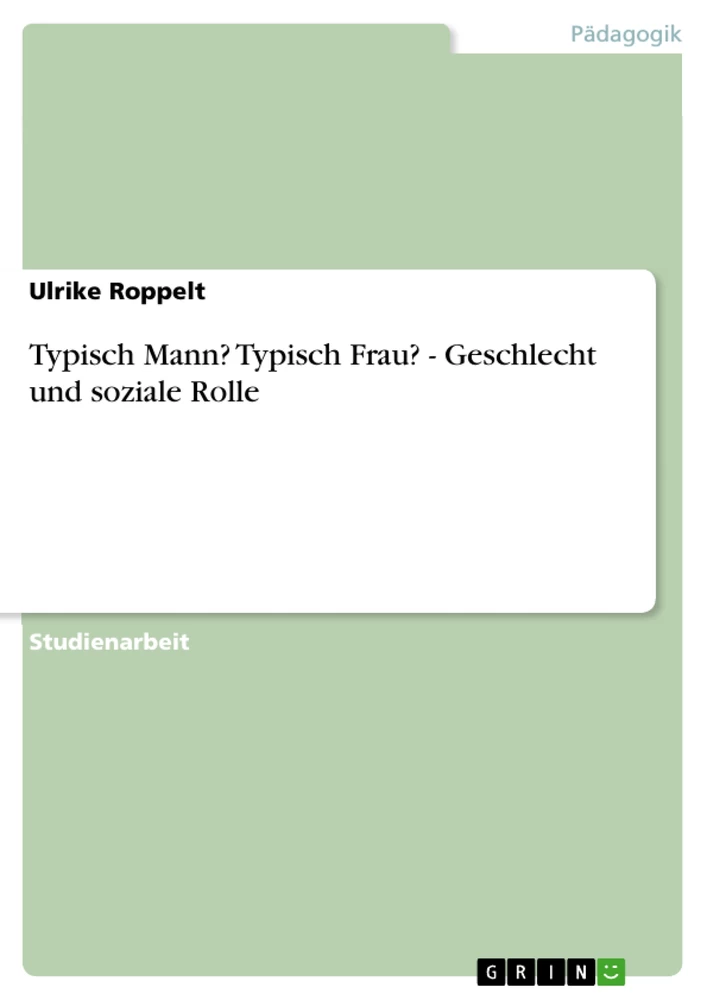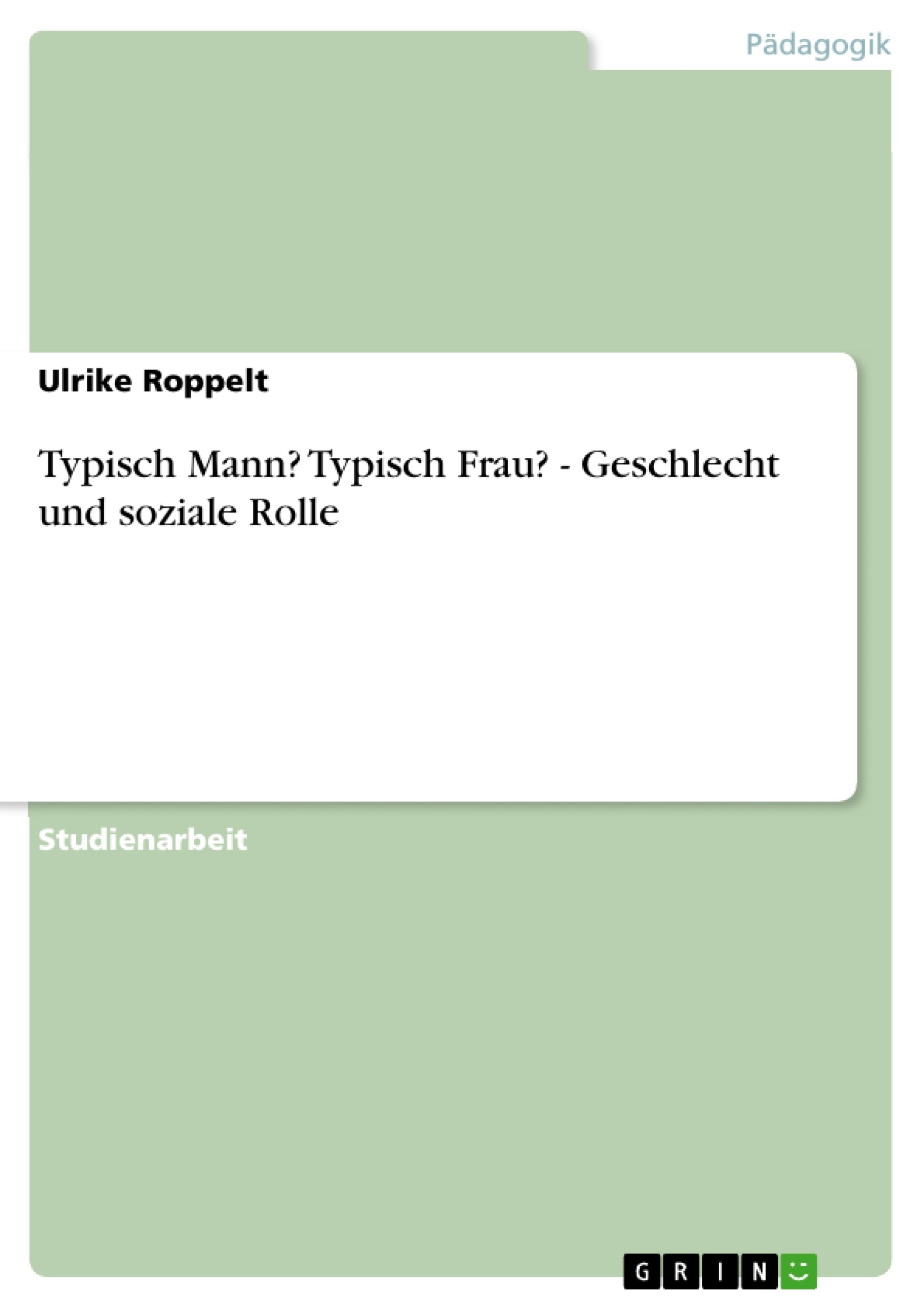DIE SOZIALEN ROLLEN VON MANN UND FRAU
'Gefesselt an sein evolutionäres Erbe, gesteuert vom Diktat der Gene und Hormone, irrt der Mensch in seinem Triebleben umher' , so zeichnet DER SPIEGEL in seiner Ausgabe vom Mai 1995 provokativ das Bild eines von biologischen Zwängen in seiner Entwicklung gefangenen Menschen. Ein biologischer Fundamentalismus, der aus den Ergebnissen neuerer Genforschung erneut Nahrung zu erhalten scheint, dessen Wurzeln jedoch weiter zurückreichen.
Bereits im 18. Jahrhundert wurde ein biologistisch geprägtes Denkmodell, das bestimmte Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen von Menschen auf eine genetische Determination desselben zurückführt, im Bürgertum aufgegriffen. Damals diente es zur Generierung eines neuen bürgerlichen Familien- und Rollenverständnisses und rückte sog. 'geschlechtsspezifische Wesensmerkmale' von Mann und Frau in den Mittelpunkt des Interesses.
Die Zuweisung komplementärer Eigenschaften führte nach Hausen (1976) zu einer 'Polarisierung der Geschlechtscharaktere', die bis in die Gegenwart hinein zur Prägung geschlechtsspezifischen Rollenverhaltens führt. Gerade die Selbverständlichkeit, mit der dieses Rollenverständnis über Generationen weitergegeben wurde, macht neugierig auf seine Entstehung, Funktion und die Konsequenzen für die sich an diesem Modell orientierenden Menschen einer Gesellschaft. Diesen Fragen soll in den folgenden Ausführungen nachgegangen werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1.0. Geschlecht und Geschlechtsrolle
- 2.0. Grundlagen und Entstehungsbedingungen von Geschlechtsrollen
- 2.1. Soziale Rolle und Schöpfungsgedanke
- 2.2. Soziale Rolle und Religion
- Die Stellung der Frau im frühen Christentum (1. Jh. n. Chr.)
- Weiblicher Status im frühen Mittelalter (4./5. Jh.)
- Hexenverfolgung (15. bis 18. Jh.)
- 3.0. Generierung eines sozialen Geschlechtsrollenkonzeptes ab dem 18. Jh.
- 3.1. Legitimationszwang: Entstehung eines neuen Orientierungsmusters
- 3.2. Herausbildung eines bürgerlichen Ideals für Mann und Frau
- 3.3. Mann und Frau als Gegenpole
- 3.3. Spezifsische Wesenszuschreibungen im neuen Geschlechterverhältnis
- 3.4. Konstruktion der sexuellen Geschlechtsrolle
- 3.5. 'Bem-Sex-Role-Inventory'
- 4.0. Reproduktion von Geschlechtsrollen
- 4.1. Geschlechtsspezifische Erziehung
- 4.2. Ausgrenzung der Frau von Bildung und Wissenschaft
- 5.0. Gegenentwicklungen - organisierte Frauenbewegung in Deutschland
- 5.1. Der Beginn des Feminismus in Europa
- 5.2. Frauenbewegung in Deutschland
- 5.2.1. Die bürgerliche Frauenbewegung
- 5.2.2. Die proletarische Frauenbewegung
- 5.2.3. Rückschritt und Wiederbeginn
- 5.2.4. Die 'neue' Frauenbewegung
- 5.2.5. Männer in Bewegung?
- 6.0. Soziale Rollen von Mann und Frau: Eine kritische Betrachtung
- 6.1. Konstruktive Aspekte
- 6.2. Destruktive Aspekte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entstehung und Entwicklung sozialer Geschlechtsrollen von Mann und Frau, beginnend mit historischen Kontexten und reichend bis in die Herausbildung der modernen Frauenbewegung. Das Ziel ist es, die gesellschaftlichen Konstruktionen von Geschlechterrollen zu analysieren und deren Auswirkungen auf die individuelle Identität und das gesellschaftliche Zusammenleben aufzuzeigen.
- Historische Entwicklung von Geschlechterrollen
- Einfluss von Religion und gesellschaftlichen Normen
- Konstruktion von Geschlechtsrollen im 18. Jahrhundert und danach
- Reproduktion von Geschlechtsrollen durch Erziehung und Bildung
- Die Rolle der Frauenbewegung in der Veränderung von Geschlechterrollen
Zusammenfassung der Kapitel
1.0. Geschlecht und Geschlechtsrolle: Dieses Kapitel legt die Grundlagen der Arbeit, indem es den Begriff "Rolle" im soziologischen Kontext definiert und die frühe Verinnerlichung von Geschlechtsrollen bei Kindern beschreibt. Es wird der Zusammenhang zwischen Geschlechtsrolle, sozialer Rolle und Sexualität beleuchtet, wobei die Geschlechtsrolle als sozial geprägter Bestandteil der Sexualität eines Menschen verstanden wird.
2.0. Grundlagen und Entstehungsbedingungen von Geschlechtsrollen: Dieses Kapitel erforscht die Wurzeln von Geschlechtsrollen. Es analysiert den Einfluss des Schöpfungsgedankens und religiöser Dogmen auf die Konstruktion traditioneller Geschlechterrollen. Durch die Betrachtung historischer Beispiele wie der Stellung der Frau im frühen Christentum, im Mittelalter und während der Hexenverfolgung, wird die Entwicklung und Veränderung von Geschlechterrollen über die Jahrhunderte veranschaulicht. Die unterschiedlichen Rollenverständnisse in verschiedenen Epochen werden miteinander verglichen und ihre Bedeutung für die Entwicklung heutiger Geschlechterrollen herausgestellt.
3.0. Generierung eines sozialen Geschlechtsrollenkonzeptes ab dem 18. Jh.: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Geschlechterrollen im 18. Jahrhundert. Es analysiert den Legitimationszwang, der zur Entstehung eines neuen Orientierungsmusters führte, und beleuchtet die Herausbildung eines bürgerlichen Ideals für Mann und Frau. Die Konstruktion der sexuellen Geschlechtsrolle wird detailliert betrachtet, und das "Bem-Sex-Role-Inventory" wird als relevantes Messinstrument eingeführt. Der Fokus liegt auf dem Wandel der Geschlechterverhältnisse und der Entstehung von komplementären, oft polarisierenden, Geschlechtsrollen im bürgerlichen Kontext.
4.0. Reproduktion von Geschlechtsrollen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Mechanismen der Weitergabe und Festigung von Geschlechterrollen über Generationen. Im Mittelpunkt stehen geschlechtsspezifische Erziehung und die historische Ausgrenzung der Frau aus Bildung und Wissenschaft. Es werden die Strategien untersucht, durch die die bestehenden Rollenbilder reproduziert und aufrechterhalten wurden und welche Langzeitfolgen diese Mechanismen für Frauen hatten.
5.0. Gegenentwicklungen - organisierte Frauenbewegung in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Frauenbewegung in Deutschland, angefangen vom frühen Feminismus bis zur "neuen" Frauenbewegung. Es werden unterschiedliche Strömungen wie die bürgerliche und die proletarische Frauenbewegung unterschieden und deren Erfolge und Rückschläge analysiert. Der Fokus liegt auf dem Kampf um Gleichberechtigung und die Herausforderungen, die die Frauenbewegung im Laufe der Geschichte meistern musste.
6.0. Soziale Rollen von Mann und Frau: Eine kritische Betrachtung: Dieses Kapitel bietet eine kritische Auseinandersetzung mit den konstruktiven und destruktiven Aspekten traditioneller Geschlechterrollen. Es beleuchtet die Auswirkungen von geschlechtsspezifischer Erziehung und Bildung, Sexismus und die Herausforderungen für die individuelle Identität, die mit stark ausgeprägten Geschlechterrollen verbunden sind.
Schlüsselwörter
Geschlechtsrollen, soziale Rollen, Geschlechterverhältnis, Frauenbewegung, Feminismus, Religion, Geschichte, Erziehung, Bildung, bürgerliches Ideal, Sexismus, Identität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Entstehung und Entwicklung sozialer Geschlechtsrollen
Was ist der Inhalt dieses Textes?
Der Text bietet eine umfassende Übersicht über die Entstehung und Entwicklung sozialer Geschlechtsrollen von Männern und Frauen. Er beginnt mit historischen Kontexten und reicht bis zur modernen Frauenbewegung. Analysiert werden die gesellschaftlichen Konstruktionen von Geschlechterrollen und deren Auswirkungen auf individuelle Identität und gesellschaftliches Zusammenleben.
Welche Themen werden behandelt?
Der Text behandelt die historische Entwicklung von Geschlechterrollen, den Einfluss von Religion und gesellschaftlichen Normen, die Konstruktion von Geschlechtsrollen ab dem 18. Jahrhundert, die Reproduktion von Geschlechtsrollen durch Erziehung und Bildung, und die Rolle der Frauenbewegung in der Veränderung von Geschlechterrollen. Es werden außerdem konstruktive und destruktive Aspekte traditioneller Geschlechterrollen kritisch beleuchtet.
Welche historischen Epochen werden betrachtet?
Der Text betrachtet verschiedene Epochen, darunter das frühe Christentum (1. Jh. n. Chr.), das frühe Mittelalter (4./5. Jh.), die Hexenverfolgung (15. bis 18. Jh.) und die Entwicklung im 18. Jahrhundert und danach. Die Analyse erstreckt sich bis zur modernen Frauenbewegung in Deutschland.
Welche Rolle spielt die Religion?
Der Text untersucht den Einfluss religiöser Dogmen und des Schöpfungsgedankens auf die Konstruktion traditioneller Geschlechterrollen, insbesondere die Stellung der Frau im frühen Christentum und Mittelalter.
Wie werden Geschlechtsrollen reproduziert?
Die Reproduktion von Geschlechtsrollen wird durch geschlechtsspezifische Erziehung und die historische Ausgrenzung der Frau aus Bildung und Wissenschaft erklärt. Der Text untersucht die Strategien zur Aufrechterhaltung bestehender Rollenbilder und deren Langzeitfolgen.
Welche Bedeutung hat die Frauenbewegung?
Der Text beschreibt die Entstehung und Entwicklung der Frauenbewegung in Deutschland, von frühen feministischen Strömungen bis zur "neuen" Frauenbewegung. Verschiedene Strömungen wie die bürgerliche und proletarische Frauenbewegung werden unterschieden und ihre Erfolge und Rückschläge analysiert.
Welche konkreten Beispiele werden genannt?
Konkrete Beispiele umfassen die Stellung der Frau im frühen Christentum, im Mittelalter, während der Hexenverfolgung, die Herausbildung eines bürgerlichen Ideals für Mann und Frau im 18. Jahrhundert und die verschiedenen Phasen der deutschen Frauenbewegung (bürgerliche, proletarische, "neue" Frauenbewegung).
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text ist in sechs Kapitel gegliedert: 1. Geschlecht und Geschlechtsrolle; 2. Grundlagen und Entstehungsbedingungen von Geschlechtsrollen; 3. Generierung eines sozialen Geschlechtsrollenkonzeptes ab dem 18. Jh.; 4. Reproduktion von Geschlechtsrollen; 5. Gegenentwicklungen - organisierte Frauenbewegung in Deutschland; 6. Soziale Rollen von Mann und Frau: Eine kritische Betrachtung.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Geschlechtsrollen, soziale Rollen, Geschlechterverhältnis, Frauenbewegung, Feminismus, Religion, Geschichte, Erziehung, Bildung, bürgerliches Ideal, Sexismus, Identität.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Der Text enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, welche die wichtigsten Inhalte und Erkenntnisse jedes Abschnitts zusammenfasst.
- Arbeit zitieren
- Ulrike Roppelt (Autor:in), 1999, Typisch Mann? Typisch Frau? - Geschlecht und soziale Rolle, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/3550