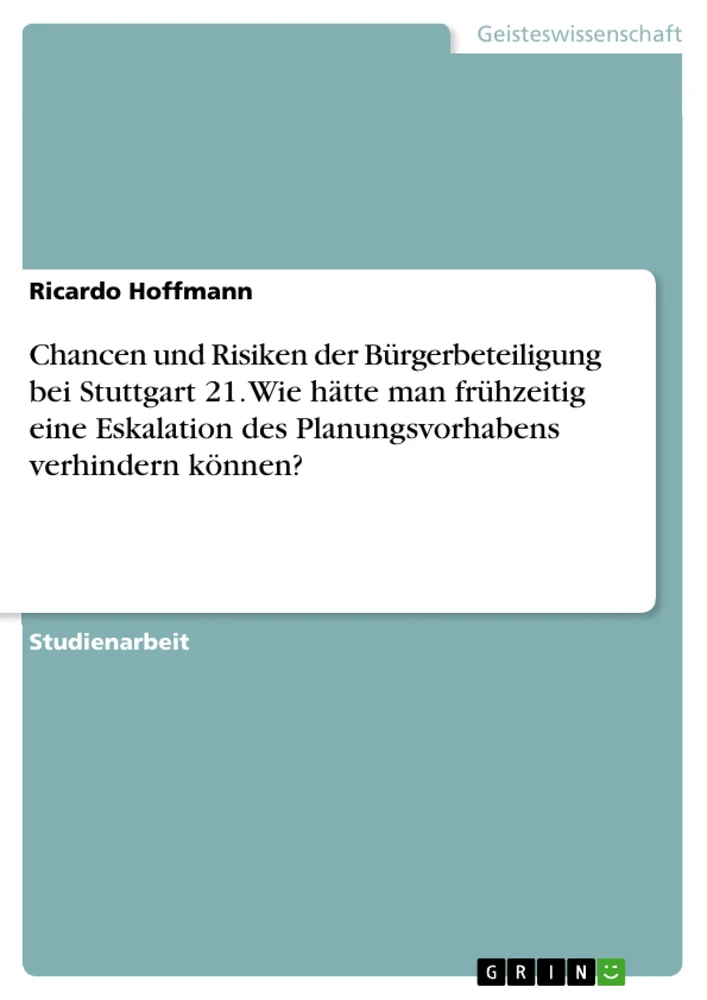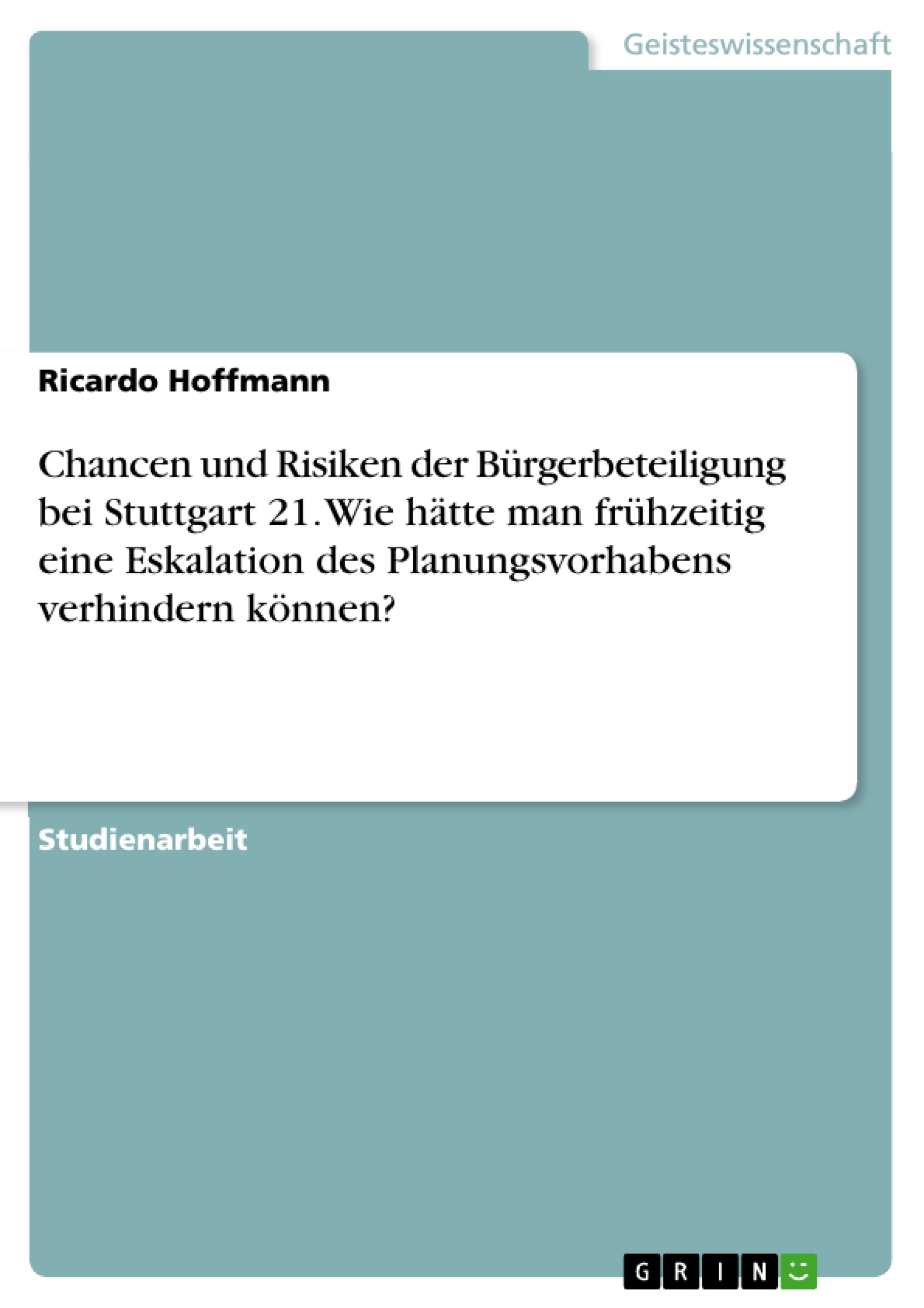Spätestens seit der Eskalation der Protestbewegung an dem sogenannten „Schwarzen Donnerstag“ des Jahres 2010 ist im Rahmen des umstrittenen Bahnhofprojektes „Stuttgart 21“ (S21) mehr als deutlich: Die Bevölkerung fordert bei Großprojekten wie z.B. im Verkehrssektor mehr Mitspracherecht und möchte nicht erst beteiligt werden, wenn die Möglichkeiten einer Einflussnahme auf den Projektverlauf beinahe komplett erodiert sind. Vielmehr wird eine frühzeitige, offene, transparente und kontinuierliche Beteiligung gewünscht.
Zwar wurden zu jeder Zeit bei dem Verkehrs- und Städtebauprojekt S21, das insbesondere den Umbau des Stuttgarter Kopfbahnhofs zu einem unterirdischen Durchgangsbahnhof sowie die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm umfasst, formell alle gesetzlichen Vorgaben der Öffentlichkeitsbeteiligung eingehalten. Trotzdem zeigt das Beispiel im Ländle explizit, dass die gängigen Verfahren scheinbar nicht mehr ausreichen. Als Gründe werden hierfür mitunter die Kostenexplosion, das Profitstreben der Banken und die mangelhafte Kommunikation durch die Projektverantwortlichen – d.h. der Deutschen Bahn AG, dem Land Baden-Württemberg, sowie der Landeshauptstadt und Region Stuttgart – genannt.
So wurde das Projekt bereits im Jahre 1994 der Öffentlichkeit vorgestellt und löste 2010 gravierende Proteste aus. Das öffentliche Schlichtungsverfahren konnte nur noch zu einer dezente Befriedung des Konflikts führen, nachdem das „Kind bereits in den Brunnen gefallen war“. Dennoch wird seit der Volksabstimmung 2011, in der sich eine Mehrheit gegen den Ausstieg des Landes an der Finanzierung aussprach, munter weitergebaut.
Es bleiben viele Fragen, denen dieses Essay versucht nachzugehen. So steht vor allem die Kernfrage im Vordergrund, ob und wie man eine Eskalation des Großvorhabens hätte frühzeitig verhindern können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Öffentlichkeitsbeteiligung bei Großvorhaben: Verfahrensschritte und gesetzliche Grundlagen des Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahrens in Deutschland
- 2.1. Das Raumordnungsverfahren (ROV): Klassisches Instrument der Raumordnung bei Projekten mit überörtlicher Bedeutung...
- 2.2. Das Planfeststellungsverfahren (PFV): Verfahrensschritte und formelle Beteiligung..
- 3. Der Status quo: Probleme und Schwachstellen in der formellen Beteiligung..
- 3.1. Komplexität im Verfahren und Partizipationsparadox ......
- 3.2. Spannungsfeld Politik, Verwaltung und Bürger: Unterschiedliche Handlungslogiken.
- 3.3. Kritik zu S21: Politisch legitimiert ist nicht gleich gesellschaftlich akzeptiert!..
- 3.4. Zwischenfazit.
- 4. Chancen und Risiken einer frühzeitigen Beteiligungskultur
- 4.1. Frühzeitige und kontinuierliche Beteiligung: Begrenzung des Partizipationsparadox durch Information und Kommunikation.
- 4.2. Transparente Beteiligung und Kommunikation: Eindämmung der Postdemokratie (nach Crouch).11
- 4.3. Kulturwandel in Deutschland: Mehr als nur gesetzliche Vorgaben...
- 5. Fazit: Chancen ergreifen, Kulturwandel vorantreiben!.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eskalation des „Stuttgart 21“-Projekts und analysiert, wie eine frühzeitige und effektive Bürgerbeteiligung die Entstehung dieses Konflikts hätte verhindern können. Die Arbeit beleuchtet die gesetzlichen Grundlagen und Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung bei Großprojekten in Deutschland und analysiert die Schwächen des bestehenden Systems. Sie untersucht Chancen und Risiken einer frühzeitigen und kontinuierlichen Beteiligungskultur und diskutiert, wie diese Prozesse effizienter gestaltet werden können.
- Rechtliche Rahmenbedingungen der Bürgerbeteiligung bei Großprojekten in Deutschland
- Die Herausforderungen und Probleme der formellen Beteiligung am Beispiel von „Stuttgart 21“
- Chancen und Risiken einer frühzeitigen, transparenten und kontinuierlichen Bürgerbeteiligung
- Der Einfluss der Politik, Verwaltung und Bürger auf die Planung und Umsetzung von Großprojekten
- Die Notwendigkeit eines Kulturwandels in der Bürgerbeteiligung in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Eskalation des „Stuttgart 21“-Projekts und stellt die Notwendigkeit einer frühzeitigen Bürgerbeteiligung bei Großvorhaben heraus. Kapitel 2 beschreibt die Verfahrensschritte und gesetzlichen Grundlagen des Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahrens in Deutschland, einschließlich der formellen Beteiligung der Öffentlichkeit. Kapitel 3 analysiert die Probleme und Schwachstellen der formellen Beteiligung, insbesondere die Komplexität des Verfahrens, die unterschiedlichen Handlungslogiken von Politik, Verwaltung und Bürgern und die Kritik an der mangelnden gesellschaftlichen Akzeptanz von „Stuttgart 21“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Bürgerbeteiligung, Großprojekte, Raumordnungs- und Planfeststellungsverfahren, „Stuttgart 21“, Eskalation, Partizipationsparadox, Postdemokratie, Kulturwandel, Politik, Verwaltung, Bürger, Kommunikation, Transparenz, Rechtliche Rahmenbedingungen, und gesellschaftliche Akzeptanz.
- Quote paper
- Ricardo Hoffmann (Author), 2016, Chancen und Risiken der Bürgerbeteiligung bei Stuttgart 21. Wie hätte man frühzeitig eine Eskalation des Planungsvorhabens verhindern können?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/354607