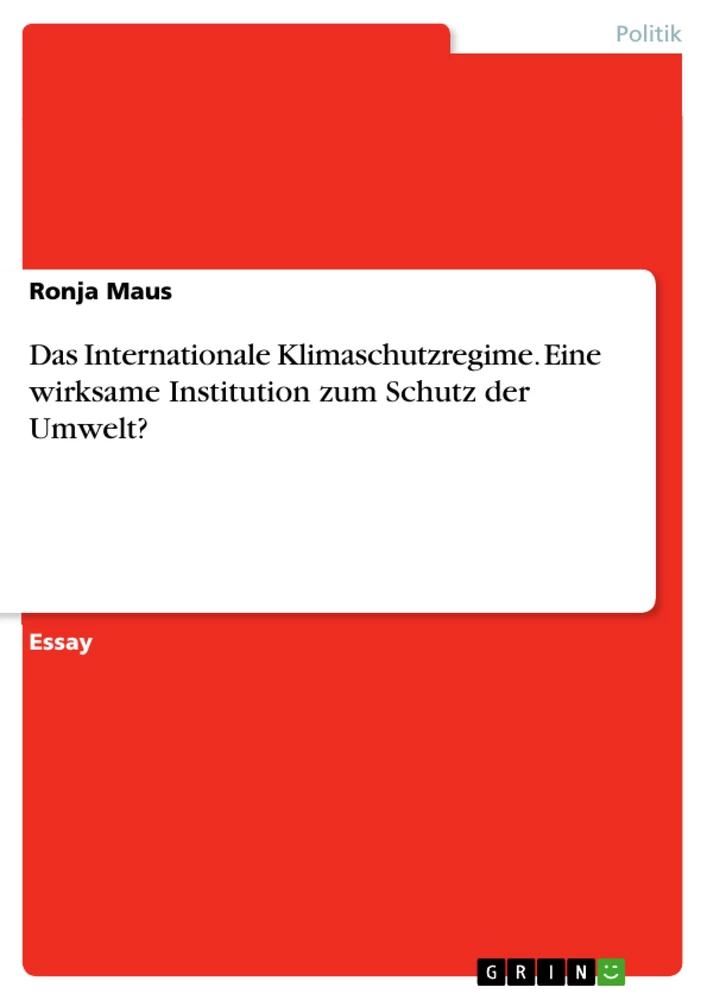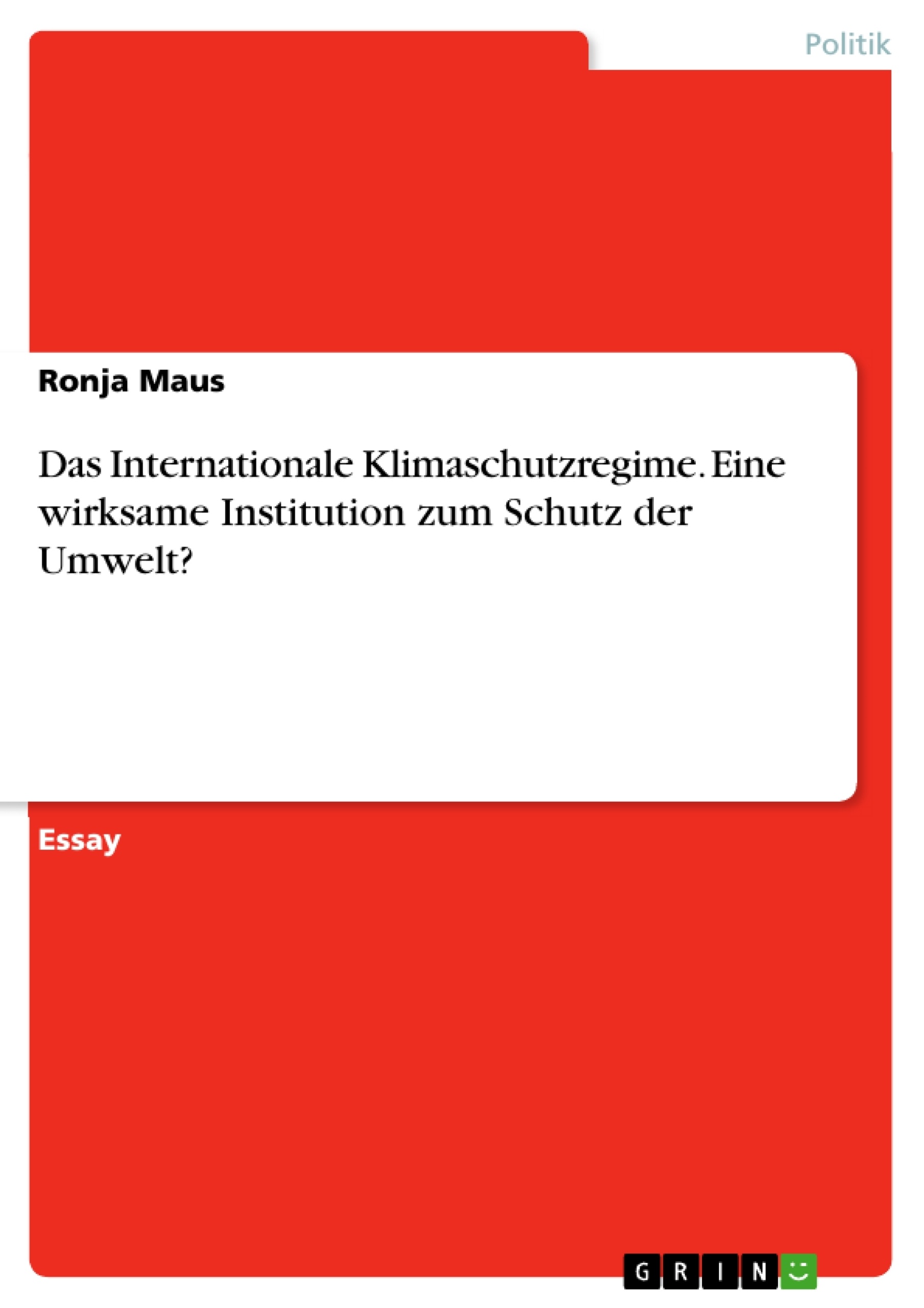Am 18. November 2011 veröffentlichte der Weltklimarat IPCC einen Sonderbericht, der davor warnt, dass die globale Erwärmung zu immer heftigeren Klimakatastrophen führen wird. Weltweit werde es einen Anstieg an Dürre-, Wirbelsturm- und Überschwemmungskatastrophen geben, die nicht nur die Landwirtschaft sowie die Wirtschaft allgemein, sondern auch direkt das Leben vieler Menschen bedrohen. Besonders betroffen seien Menschen in Afrika sowie Bewohner kleinerer Inseln.
Ein einzelner Staat kann diese globalen Umweltprobleme nicht lösen. Stattdessen kann nur eine Form der internationalen Kooperation, bei der möglichst viele Staaten partizipieren, dazu beitragen, den Klimawandel zu bekämpfen. Dieser Essay untersucht daher das internationale Klimaregime: Was kann diese Institution zur Lösung des Konfliktfelds Klimawandel beitragen?
Die Leitfrage wird dementsprechend sein, wie wirksam dieses Regime und seine internationale Klimapolitik sind. Effektivität wird in diesem Rahmen als eine merkbare Verhaltensänderung der staatlichen Akteure definiert. Einleitend wird der theoretische Hintergrund vorgestellt, diesen bilden sie Regimetheorie sowie das Gefangenendilemma. Darauf aufbauend wird das internationale Klimaschutzregime präsentiert. In Kapitel 3 werden die wichtigsten Schritte in der internationalen Klimapolitik dargestellt. Dieser Essay beschränkt sich auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen sowie das Kyoto-Protokoll. Abschließend wird das Engagement des internationalen Klimaschutzregimes bewertet.
1. Einleitung
Am 18. November 2011 veröffentlichte der Weltklimarat IPCC einen Sonderbericht, der davor warnt, dass die globale Erwärmung zu immer heftigeren Klimakatastrophen führen wird. Weltweit werde es einen Anstieg an Dürre-, Wirbelsturm- und Überschwemmungskatastrophen geben, die nicht nur die Landwirtschaft sowie die Wirtschaft allgemein, sondern auch direkt das Leben vieler Menschen bedrohen. Besonders betroffen seien Menschen in Afrika sowie Bewohner kleinerer Inseln (o.A. 2011).
Ein einzelner Staat kann diese globalen Umweltprobleme nicht lösen. Stattdessen kann nur eine Form der internationalen Kooperation, bei der möglichst viele Staaten partizipieren, dazu beitragen, den Klimawandel zu bekämpfen. Dieser Essay untersucht daher das internationale Klimaregime: Was kann diese Institution zur Lösung des Konfliktfelds Klimawandel beitragen? Die Leitfrage wird dementsprechend sein, wie wirksam dieses Regime und seine internationale Klimapolitik sind. Effektivität wird in diesem Rahmen als eine merkbare Verhaltensänderung der staatlichen Akteure definiert. Einleitend wird der theoretische Hintergrund vorgestellt, diesen bilden sie Regimetheorie sowie das Gefangenendilemma. Darauf aufbauend wird das internationale Klimaschutzregime präsentiert. In Kapitel 3 werden die wichtigsten Schritte in der internationalen Klimapolitik dargestellt, dieser Essay beschränkt sich auf das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationenüber Klimaänderungen sowie das Kyoto-Protokoll. Abschließend wird das Engagement des internationalen Klimaschutzregimes bewertet.
2. Theoretischer Hintergrund
Wie einleitend dargestellt, kann nur eine internationale Kooperation von vielen Staaten nachhaltig auf eine Beseitigung des globalen Klimawandels einwirken. Das internationale System ist jedoch durch die Abwesenheit einer zentralen Herrschaftsinstanz geprägt, sodass die Durchsetzung verbindlichen Normen sowie die Überwachung deren Einhaltung schwierig ist (Gehring/Oberthür 1997: 9f). Wie können Regimes wechselseitige (im besten Falle bindende) Vereinbarungen zwischen Staaten fördern? Zur Beantwortung der Fragen wird in einem ersten Schritt der theoretische Rahmen dieser Arbeit mit der Regimetheorie und dem Gefangenendilemma skizziert, in einem zweiten Schritt werden diese Kenntnisse auf das Praxisbeispiel des Klimaschutzregimes übertragen und angewendet.
2.1 Die Regimetheorie und das Gefangenendilemma
Die Regimetheorie ist eine Theorie in den Internationalen Beziehungen, die ihre Wurzeln zu dem Paradigma des Neoinstitutionalismus zurückverfolgen kann. Sie entstand Ende der 70er Jahre und wurde maßgeblich von Robert O. Keohane geprägt. Die Regimetheorie besagt, dass internationale Institutionen wie z.B. internationale Organisationen oder Regime das Handeln eines Staats beeinflussen können. Daher liegt ihr Hauptaugenmerk auf der Untersuchung von internationalen Institutionen. Zangl fasst ihre zentralen Prämissen wie folgt zusammen: Staaten sind die wichtigsten Akteure in der internationalen Politik, welche durch anarchische Strukturen gekennzeichnet ist. Das Handeln der Staaten ist rational und interessengeleitet (Zangl 2010: 131). Während sich diese Thesen eher dem Neorealismus zuordnen lassen, bedient sich die Regimetheorie auch diverser Argumentationslinien des Neoliberalismus. So geht die Regimetheorie davon aus, dass Kooperation zwischen verschiedenen Staaten möglich ist. Dies ist z.B. der Fall, wenn die Zusammenarbeit „angesichts zunehmend komplexer Interdependenzbeziehungen über Staatsgrenzen hinweg im gemeinsamen Interesse aller beteiligten Staaten liegt“ (ebd.).
Ebenso wie internationale Organisationen sind internationale Regime zwischenstaatliche soziale Institutionen. Ein wichtiger Unterschied zwischen internationalen Organisationen und internationalen Regimes besteht darin, dass letztere über keine Akteursqualität verfügen. Zudem sind Regimes stets auf ein spezifisches Problemfeld in der internationalen Politik fokussiert (beispielsweise Abrüstung oder Menschenrechte) (Rittberger/Zangl 2008: 25). Dementsprechend lautet eine prominente Definition von Regimes wie folgt:
„Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures around which actors` expectations converge in a given area of international relations.“ (Krasner 1982: 186)
Regimes kommt im Bereich der internationalen Politik eine wichtige Aufgabe zu, indem sie Staaten bei der Kooperation im Rahmen eines internationalen Konflikts unterstützen. Um dies zu veranschaulichen bedient sich Zangl des spieltheoretischen Ansatzes. Mithilfe des Gefangenendilemmas illustriert er die Funktion von internationalen Regimes, dies wird im Folgenden dargestellt: Das Gefangenendilemma ist eine Modellierung von einer Interessenkonstellation, bei der zwei Akteure aufeinandertreffen und sich in ihrer Entscheidungsfindung bezüglich eines Konflikts reziprok beeinflussen. Dabei handeln diese Akteure jeweils rational und interessengeleitet. Der Hintergrund dieses Dilemmas ist, dass nur eine Kooperation der Akteure zur Beilegung des Konflikts helfen kann, diese ist zwar im gemeinsamen Interesse der Akteure, jedoch gleichzeitig mit Kosten verbunden. Daher ist die Defektion (d.h. Nicht-Kooperation) die wichtige Verhaltensstrategie der beiden Akteure. In dieser Situation haben die beiden Akteure insgesamt drei verschiedene Möglichkeiten zu interagieren: Erstens die gemeinsame Kooperation der Akteure, von der beide Akteure gleichermaßen profitieren. Zweitens die einseitige Kooperation, d.h. ein Akteur kooperiert (und trägt somit alleine die Kosten und tätigt einen Beitrag zur Beseitigung des Konflikts), während der andere Akteur defektiert (er investiert nicht, sondern ist in der „Nutznießerposition“ durch den Beitrag des ersten Akteurs). Da der individuelle Gewinn in dieser Szenariolösung am höchsten ist, wird sie von den einzelnen Akteuren präferiert. Drittens die beidseitige Defektion mit der Folge, dass die zwei Akteure zwar keine Kosten tragen, jedoch auch nicht das Problem beseitigen konnten (Scharpf 2000: 131). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass somit auf einer kollektiven Ebene die Möglichkeit der beidseitigen Kooperation die beste ist. Diese Strategie ist jedoch äußerst gefährdet, da auf der individuellen Ebene die Möglichkeit der Defektion die beste ist. Daher wird zum Beispiel eine dritte Instanz benötigt, die die Einhaltung der Kooperationstreue überwacht. Dies ist laut Zangl eine zentrale Aufgabe von internationalen Regimes (Zangl 2010: 139f). Des Weiteren helfen Regimes Staaten bei der Umsetzung ihrer Kooperationsinteressen, indem sie „Transaktionskosten“ (ebd.) reduzieren, indem sie zum Beispiel einen festen und spezifischen Verhandlungsrahmen bieten.
2.2 Anwendung am Beispiel des internationalen Klimawandelregimes
Der zentrale internationale Konflikt des in diesem Essay untersuchten Regimes ist der globale Klimawandel. Übertragen auf das Gefangenendilemma lassen sich folgende Beobachtungen festhalten: Alle Staaten haben ein Interesse an einem stabilen Klima (wobei das Problem für einige Staaten dringender bzw. von größerer Wichtigkeit ist). Trotzdem sind die einzelnen Staaten in der Regel zögernd bei der Senkung von CO2-Emissionen, da die Kosten (z.B. durch verminderte industrielle Produktion und somit verringerte Wirtschaftsleistung) kurzfristig zu hoch sind. Zudem können einzelne rationale Staaten die Strategie des „Trittbrettfahrens“ anwenden, indem sie selbst defektieren, aber trotzdem von den Anstrengungen der anderen Staaten im Klimaschutz profitieren. Noch ist die Frage offen, ob das politische Engagement auf der internationalen Ebene als Regime bezeichnet werden kann. Zur Beantwortung möchte ich auf die oben angeführte Definition von Krasner zurückgreifen: Das Politikfeld („given area of international relations“) ist der globale Klimawandel. Das Prinzip des internationalen Klimaschutzregimes beruht auf der Annahme, dass der Klimawandel maßgeblich durch das Treibhausgas CO2 entsteht. Daher ist das Prinzip in der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen verankert:
„Die Vertragsparteien sollen auf der Grundlage der Gerechtigkeit und entsprechend ihren gemeinsamen, aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und ihren jeweiligen Fähigkeiten das Klimasystem zum Wohl heutiger und künftiger Generationen schützen.“ (Vereinte Nationen 1992: 5)
Daraus ergibt sich automatisch die zentrale Norm des internationalen Klimaschutzregimes, die Senkung des Ausstoßes von CO2. Die Regeln des Regimes sind formuliert in dem Kyoto-Protokoll, ein völkerrechtliches Abkommen, das Vorgaben zur Reduktion der Treibhausgase festlegt. Die Entscheidungsverfahren des Klimaschutzregimes finden sich wieder in den jährlich stattfindenden Vertragsstaatenkonferenzen (Conference of the Parties, „COP“).
3. Die internationale Klimapolitik
Der globale Klimawandel ist seit den 80er Jahren verstärkt auf der politischen Agenda. Auslöser für die intensivierte Beachtung der Umweltveränderungen waren laut Ott „Fortschritte in der wissenschaftlichen Erforschung des Klimasystems der Erde, das Erscheinen politischer Akteure mit einem starken Interesse an der wissenschaftlichen und politischen Problemlösung, die Sensibilisierung großer Teile der Bevölkerung in den westlichen Industrienationen und eine Serie außergewöhnlicher klimatischer Ereignisse“ (Ott 1997: 203)
Im Folgenden möchte ich die wichtigsten Entwicklungen in der internationalen Klimapolitik seitdem skizzieren, dabei beschränke ich mich auf eine Darstellung des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationenüber Klimaänderungen sowie des Kyoto-Protokolls.
3.1 Das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationenüber Klimaänderungen
Im Jahr 1992 fand die Umweltkonferenz der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro statt. Während der Verhandlungen wurden divergierende Interessenpositionen offensichtlich, die Ott in drei Akteursgruppen einteilt: die Progressiven, die Bremser und die Unentschiedenen. Zu den Progressiven zählt er die Staaten der EG sowie die Staaten der Alliance of Small Island States. Dem gegenüber stehen die Bremser, zu denen laut Ott die ölexportierenden Staaten des Nahen Ostens, die USA und Russland gehören. Die Entwicklungsländer bildeten die (intern heterogene) Gruppe der Unentschiedenen (Ott 1997: 205, Kiyar). Neben den Staaten engagieren sich noch eine Reihe weiterer Akteure auf dem Rahmen der internationalen Klimapolitik, so z.B. Lobby-Organisationen der Industrie sowie Umweltgruppen (Ott 1997: 207). Die zentrale Konfliktlinie auf der Rio- Konferenz drehte sich um die Frage nach konkreten Maßgaben zur Reduzierung der klimarelavanten CO2-Gase. Das Ergebnis war die Klimarahmenkonvention (UNFCCC), die einen relativ offenen Kompromiss zwischen den verschiedenen Positionen darstellte und von 165 Staaten und der Europäischen Gemeinschaft unterzeichnet wurde. In der Konvention sind die fünf Grundsätze des internationalen Klimaschutzes aufgeführt (Vereinte Nationen 1992: 5f), jedoch wurde darauf verzichtet, konkrete und verbindliche Verpflichtungen zur Senkung der Emissionen in die Konvention aufzunehmen. Dafür sind die teilnehmenden Staaten fortan verpflichtet, regelmäßige Berichte über ihre Klimapolitik zu erstellen (Vereinte Nationen 1992: 6). Darüber hinaus wurde in der UNDCCC die Einberufung einer jährlichen Vertragsstaatenkonferenz festgelegt (Vereinte Nationen 1992: 12).
3.2 Das Kyoto-Protokoll
Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der internationalen Klimapolitik stellt das Kyoto-Protokoll dar, das 1997 beschlossen wurde. Bisher haben 191 Staaten sowie die Europäische Union das Protokoll unterzeichnet, die USA als einer der größten Emittenten ist jedoch nicht darunter. Das Abkommen determiniert erstmal völkerrechtlich verbindliche Maßgaben für die CO2-Emmissionen (Reduktion von durchschnittlich fünf Prozent gegenüber dem Stand von 1990; Vereinte Nationen 2011) bis zum Jahr 2012. Zudem wurden drei flexible Mechanismen zur Realisierung der Reduktionsziele festgelegt: „Emission Trading“, „Clean Development Mechanism“, „Joint Implementation“ (ebd.). Das Kyoto-Protokoll gibt jedoch keinen Hinweis auf mögliche Sanktionen gegenüber Verstoße gegen die getroffenen Vereinbarungen.
4. Beitrag des Klimaschutzregimes zur Lösung des Kooperationsproblems des globalen Klimawandels
Die zwei wichtigsten formalen Instrumente der internationalen Klimapolitik sind das UNFCCC sowie das Kyoto-Protokoll. Diese stellen einen Erfolg dahingehend dar, dass das Thema Klimawandel in den Fokus der internationalen Politik gerückt wurde. Doch hat das Regime tatsächlich effektiv auf das Verhalten von einer Reihe von Staaten eingewirkt, sodass Emissionen reduziert werden konnten? An dieser Stelle soll die Wirksamkeit des Klimaschutzregimes kritisch hinterfragt werden.
Das Kyoto-Protokoll verpflichtet nur für die sogenannte „erste Runde von Reduktionsverpflichtungen“ (Sterk 2008), auf den COPs in Kopenhagen und Cancun scheiterte der Versuch ein rechtlich verbindliches Nachfolgeabkommen zu schließen. Als besonderer Misserfolg des Klimaschutzregimes muss die Tatsache, dass die USA als größter Emittent von Treibhausgasen der Industrieländer, das Kyoto-Protokoll bisher nicht ratifiziert hat (ebd.). Während die europäischen Industrienationen Versuche der Emissionsreduktion unternehmen, sind die Emissionen in den großen Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien kontinuierlich gestiegen (ebd.). Sterk merkt zudem an, dass die (in einem ersten Schritt) angestrebten fünf Prozent Minderung der Treibhausgase bei weitem nicht ausreichend seien, um den Klimawandel in Form der 2°C-Obergrenze aufzuhalten. Stattdessen müssten „bis zur Jahrhundertmitte (…) die globalen Emissionen um 50 bis 85 Prozent gegenüber dem Stand von 2000 reduziert werden“ (ebd.).
5. Fazit
Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen im Bereich der internationalen Politik im 21. Jahrhundert dar. Zu Beginn dieses Essays wurde das Klimaschutzregime (unter Anwendung der Regimetheorie sowie der Spieltheorie) präsentiert. Die Frage, ob dieses internationale Regime nachhaltig zu einer Lösung des globalen Klimaproblems beitragen kann, muss aktuell jedoch negativ beantwortet werden. Trotz des Kyoto-Protokolls, dessen Zielvorgaben als zu niedrig eingestuft werden können, steigen die weltweiten Emissionen weiter an. Dies wird sich auch nicht ändern, solange die größten Emittenten wie die USA oder die aufstrebenden Schwellenländer sich von verbindlichen Verpflichtungen distanzieren und weitere rechtliche Bemühungen hinsichtlich ihrer Reduzierungsvorgaben kompromisslos blockieren.
Literatur
Gehring, Thomas / Oberthür, Sebastian (1997): Internationale Regime als Steuerungsinstrumente der Umweltpolitik, in: Gehring, Thomas / Oberthür, Sebastian (Hrsg.): Internationale Umweltregime: Umweltschutz durch Verhandlungen und Verträge. Opladen: Leske + Budrich, S. 9-25.
Kiyar, Dagmar (2009) (i.A. der Bundeszentrale für politische Bildung): Internationale Klimapolitik. Abgerufen unter: http://www.bpb.de/themen/6N9GLL,0,Internationale_Klimapolitik.html (18.11.2011).
Krasner, Stephen D. (1982): Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables, in: International Organization 36, 2 (1982), S. 185-205.
o.A. (2011): Sonderbericht: Weltklimarat IPCC prognostiziert neue Wetterextreme. Abgerufen unter: http://pdf.zeit.de/wissen/umwelt/2011-11/bericht-extremwetter-ipcc.pdf (19.11.2011).
Ott, Herrmann (1997): Das internationale Regime zum Schutz des Klimas, in: Gehring, Thomas / Oberthür, Sebastian (Hrsg.): Internationale Umweltregime: Umweltschutz durch Verhandlungen und Verträge. Opladen: Leske + Budrich, S. 201-219.
Rittberger, Volker / Zangl, Bernhard (2008): Internationale Organisationen - Politik und Geschichte. Opladen: Leske + Budrich
Scharpf, Fritz (2000): Interaktionsformen: Akteurszentrierter Institutionalismus in der Politikforschung. Opladen: Leske + Budrich, S. 123-148.
Sterk, Wolfgang (2008) (i.A. der Bundeszentrale für politische Bildung): Heute schon an morgen denken: Die Zukunft der internationalen Klimapolitik. Abgerufen unter: http://www.bpb.de/popup/popup_druckversion.html?guid=IIMOS7 (19.11.2011).
Vereinte Nationen (1992): Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen. Abgerufen unter: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convger.pdf (17.11.2011).
Vereinte Nationen (2011): Kyoto Protocol. Abgerufen unter: http://unfccc.int/kyoto_protocol/- items/2830.php (18.11.2011).
Zangl, Bernhard (2010): Regimetheorie, in: Schieder, Siegfried / Manuela Spindler (Hrsg.): Theorien der Internationalen Beziehungen. Opladen: Leske + Budrich, S. 131-157.
[...]
- Quote paper
- Ronja Maus (Author), 2012, Das Internationale Klimaschutzregime. Eine wirksame Institution zum Schutz der Umwelt?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/354164