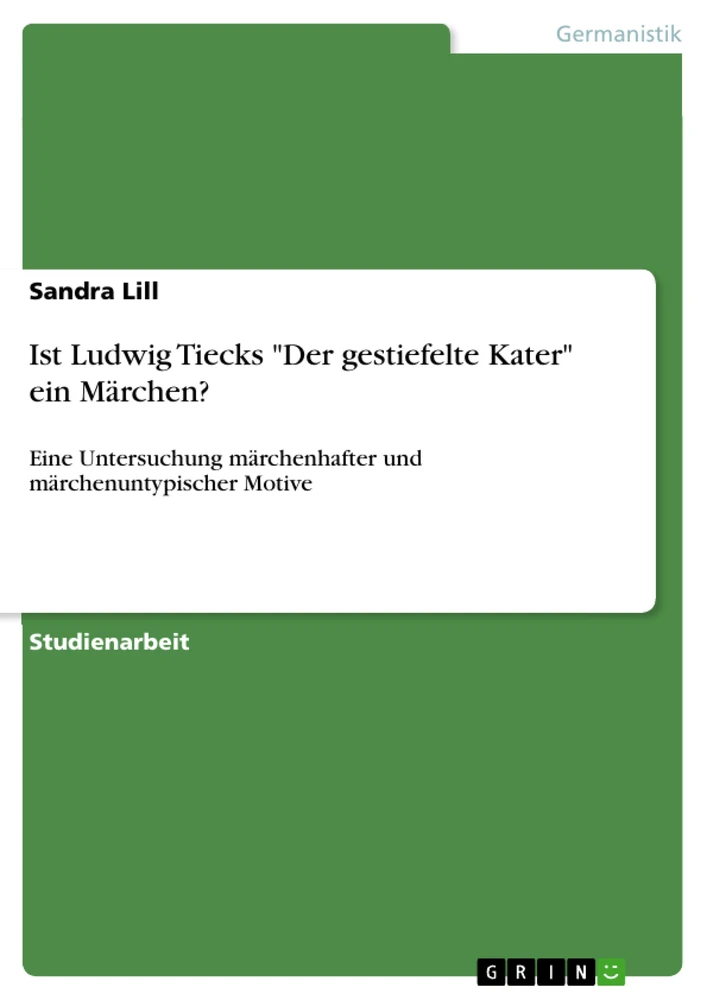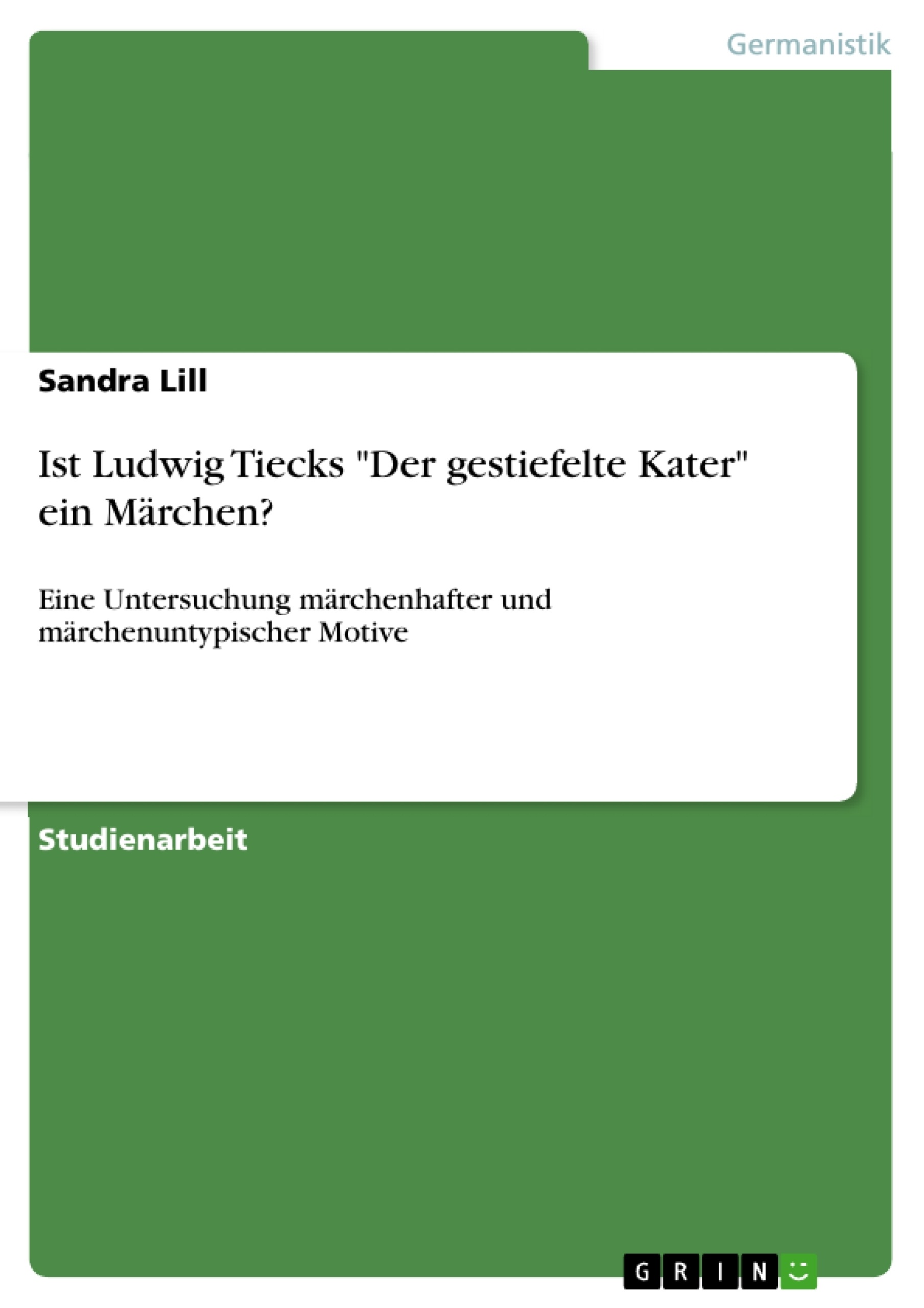In dieser mit der Bestnote bewerteten Hausarbeit erläutert Sandra Lill, ob es sich bei Ludwig Tiecks Werk "Der gestiefelte Kater" um ein Märchen handelt. Die Kriterien hierfür werden zunächst erläutert und das Werk anschließend darauf untersucht. Die Illusionsbrechung, die Tieck durch sein Spiel im Spiel vornimmt, ist typisch für seine ironische und melancholische Grundstimmung in der Epoche der Romantik.
Ludwig Tieck gibt seinem 1797 erschienenen Stück „Der gestiefelte Kater“ den Untertitel „Kindermärchen in drei Akten Mit Zwischenspielen, einem Prologe und Epiloge“. Er möchte es zunächst also als Kindermärchen aufgefasst wissen. Doch bereits dieser Untertitel, der den Aufbau in Akten prognostiziert, ist ein Indiz dafür, dass es sich nicht um ein echtes Märchen handeln kann – denn ein solches wäre, wie im Folgenden gezeigt werden soll, prosaisch verfasst und demnach nicht in Akte gegliedert.
Doch oberflächlich betrachtet ist die Klassifizierung des Stückes, oder zumindest des Stückes im Stück, als Märchen thematisch durchaus zutreffend, da Tieck den Stoff aus Charles Perraults hundert Jahre zuvor erschienenem Märchen „Le Maître Chat ou Le Chat Botté“ verwendet und weiter bearbeitet. Die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm führten zeitweise eine deutsche Übersetzung dieses Textes in ihrer Sammlung „Kinder- und Hausmärchen“, welche die Geschichte des Theaterstückes, das bei Tieck vor dem von vornherein unzufriedenen Publikum aufgeführt wird und bei diesem am Ende auch kläglich durchfällt, erzählt.
Betrachtet man jedoch nicht nur die oberflächliche Thematik des Stückes im Stück sondern bezieht dessen Rahmenhandlung im Theatersaal sowie die vielen verschiedenen Folien mit ein, auf denen Tieck seine Handlung voranbringt, kann die Gattungsbestimmung nicht mehr eindeutig vorgenommen werden. Zwar kommen mehrere märchenhafte Motive vor, doch wie im weiteren Verlauf verdeutlicht werden soll, wäre eine Typisierung Tiecks‘ „Der gestiefelte Kater“ als reines Märchen dennoch viel zu kurz gegriffen. Nichts desto trotz soll im Folgenden versucht werden, zu entscheiden, ob es sich zumindest wie im Untertitel angekündigt um ein Märchen – bzw. Kunstmärchen – handelt, oder ob dieser vollkommen in die Irre führt. Um zuvor die Begrifflichkeiten eindeutig zu klären, sollen zunächst die typischen Merkmale dieser Gattung erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problematik der Gattungsbestimmung von „Der gestiefelte Kater“
- 2. Vorstellung der Gattung „Märchen“
- 2.1. Märchenhafte Motive in „Der gestiefelte Kater“
- 2.1.1. Ort- und Zeitlosigkeit des Geschehens
- 2.1.2. Verwendung märchenhafter Figuren
- 2.1.3. Glückliches Ende des Stückes im Stück
- 2.2. Märchenuntypische Motive in „Der gestiefelte Kater“
- 2.2.1. Hinterfragen wunderbarer Ereignisse
- 2.2.2. Aus der Rolle Fallen der Figuren
- 2.2.3. Scheitern des Stückes im Stück
- 3. Verneinung der Eingangsfrage und Aufzeigen möglicher Alternativen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Frage, ob Ludwig Tiecks „Der gestiefelte Kater“ als Märchen klassifiziert werden kann. Die Arbeit analysiert die Merkmale des Märchens und vergleicht diese mit den Eigenschaften von Tiecks Stück. Ziel ist es, die Gattungsbestimmung des Stücks zu diskutieren und mögliche Alternativen aufzuzeigen.
- Gattungsbestimmung von Tiecks „Der gestiefelte Kater“
- Merkmale des Märchens (Volksmärchen vs. Kunstmärchen)
- Analyse märchenhafter und märchenuntypischer Motive in Tiecks Stück
- Kontextualisierung des Stücks innerhalb der literarischen Tradition
- Diskussion der Grenzen der Gattungsbestimmung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problematik der Gattungsbestimmung von „Der gestiefelte Kater“: Die Arbeit beginnt mit der Problematik der Einordnung von Tiecks "Der gestiefelte Kater". Der Untertitel "Kindermärchen" wirft sofort Fragen auf, da die Struktur des Stücks – gegliedert in Akte mit Prolog und Epilog – von der typischen Prosaform eines Märchens abweicht. Die Verwendung von Perraults "Le Maître chat" als Vorlage deutet zwar auf eine märchenhafte Thematik hin, doch die Einbettung des Märchens in eine Rahmenhandlung im Theatersaal und die vielschichtigen Ebenen der Handlung erschweren eine eindeutige Klassifizierung. Der Bezug auf Schlegel, der die Schwierigkeiten der Gattungsbestimmung hervorhebt, unterstreicht die Komplexität der Frage.
2. Vorstellung der Gattung „Märchen“: Dieses Kapitel definiert die Merkmale eines Märchens, basierend auf der Anonymität von Autor, Entstehungszeit und -ort, der Variabilität durch mündliche Überlieferung und der Akzeptanz des Wunderbaren. Es differenziert zwischen Volksmärchen und Kunstmärchen. Volksmärchen zeichnen sich durch mündliche Überlieferung und Variabilität aus, wohingegen Kunstmärchen einen bekannten Autor und eine feste Entstehungszeit haben. Das Kunstmärchen verwendet zwar Motive des Volksmärchens, weicht aber in den Punkten Anonymität und Variabilität ab. Die Arbeit betont, dass die unwahrscheinlichen Ereignisse im Kunstmärchen im Gegensatz zum Volksmärchen bewusst als unwahrscheinlich wahrgenommen werden und ein positives Ende nicht garantiert ist.
2.1. Märchenhafte Motive in „Der gestiefelte Kater“: Dieser Abschnitt analysiert die märchenhaften Elemente in Tiecks Stück. Der Fokus liegt auf der Ort- und Zeitlosigkeit des Geschehens, die durch die vage Beschreibung des Handlungsortes und den unbestimmten Zeitangaben im Stück deutlich wird. Die fehlende genaue Geographie und die unspezifischen Zeitangaben unterstreichen die märchenhafte Atmosphäre.
Schlüsselwörter
Ludwig Tieck, Der gestiefelte Kater, Märchen, Kunstmärchen, Gattungsbestimmung, Volksmärchen, Motiv, Rahmenhandlung, Ironie, Komik.
Häufig gestellte Fragen zu Ludwig Tiecks "Der gestiefelte Kater"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Frage, ob Ludwig Tiecks "Der gestiefelte Kater" als Märchen klassifiziert werden kann. Sie analysiert die Merkmale des Märchens und vergleicht diese mit den Eigenschaften von Tiecks Stück. Ziel ist die Diskussion der Gattungsbestimmung und die Aufzeigung möglicher Alternativen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: 1. Problematik der Gattungsbestimmung von „Der gestiefelte Kater“, 2. Vorstellung der Gattung „Märchen“ (mit den Unterkapiteln 2.1 Märchenhafte Motive und 2.2 Märchenuntypische Motive in „Der gestiefelte Kater“) und 3. Verneinung der Eingangsfrage und Aufzeigen möglicher Alternativen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Gattungsbestimmung von Tiecks "Der gestiefelte Kater", die Merkmale des Märchens (Volksmärchen vs. Kunstmärchen), die Analyse märchenhafter und märchenuntypischer Motive in Tiecks Stück, die Kontextualisierung des Stücks innerhalb der literarischen Tradition und die Diskussion der Grenzen der Gattungsbestimmung.
Wie wird die Problematik der Gattungsbestimmung von "Der gestiefelte Kater" dargestellt?
Das erste Kapitel thematisiert die Schwierigkeiten, Tiecks "Der gestiefelte Kater" eindeutig einer Gattung zuzuordnen. Der Untertitel "Kindermärchen" steht im Widerspruch zur Struktur des Stücks (Akte mit Prolog und Epilog), die von der typischen Prosaform eines Märchens abweicht. Die Verwendung von Perraults Vorlage und die Einbettung in eine Rahmenhandlung erschweren eine eindeutige Klassifizierung. Schlegels Ausführungen zu den Schwierigkeiten der Gattungsbestimmung werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie wird die Gattung "Märchen" definiert?
Kapitel 2 definiert das Märchen anhand von Merkmalen wie Anonymität von Autor, Entstehungszeit und -ort, Variabilität durch mündliche Überlieferung und Akzeptanz des Wunderbaren. Es unterscheidet zwischen Volksmärchen (mündliche Überlieferung, Variabilität) und Kunstmärchen (bekannter Autor, feste Entstehungszeit, bewusste Wahrnehmung unwahrscheinlicher Ereignisse, kein garantiertes Happy End).
Welche märchenhaften und märchenuntypischen Motive werden in Tiecks Stück analysiert?
Die Analyse märchenhafter Motive konzentriert sich auf die Ort- und Zeitlosigkeit des Geschehens in Tiecks Stück, die durch vage Beschreibungen erzeugt wird. Märchenuntypische Motive werden ebenfalls untersucht, jedoch wird der detaillierte Inhalt dieser Analyse im FAQ nicht ausführlich dargestellt.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass Tiecks "Der gestiefelte Kater" nicht einfach als Märchen klassifiziert werden kann. Das dritte Kapitel präsentiert mögliche alternative Gattungszuordnungen, die im FAQ jedoch nicht im Detail beschrieben sind.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ludwig Tieck, Der gestiefelte Kater, Märchen, Kunstmärchen, Gattungsbestimmung, Volksmärchen, Motiv, Rahmenhandlung, Ironie, Komik.
- Quote paper
- Sandra Lill (Author), 2012, Ist Ludwig Tiecks "Der gestiefelte Kater" ein Märchen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/353951