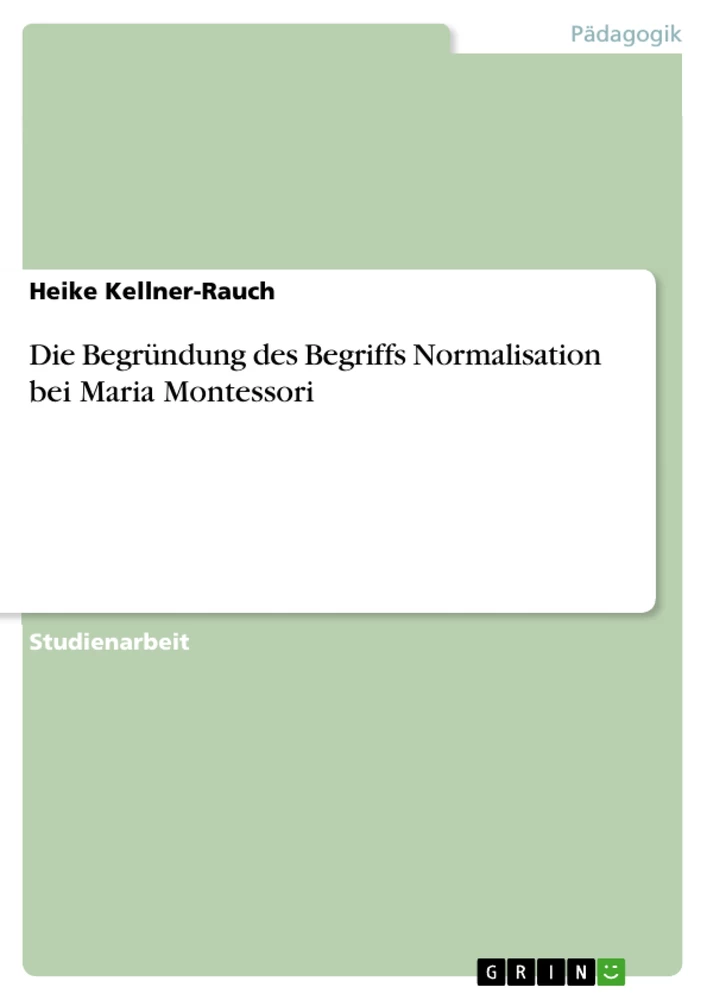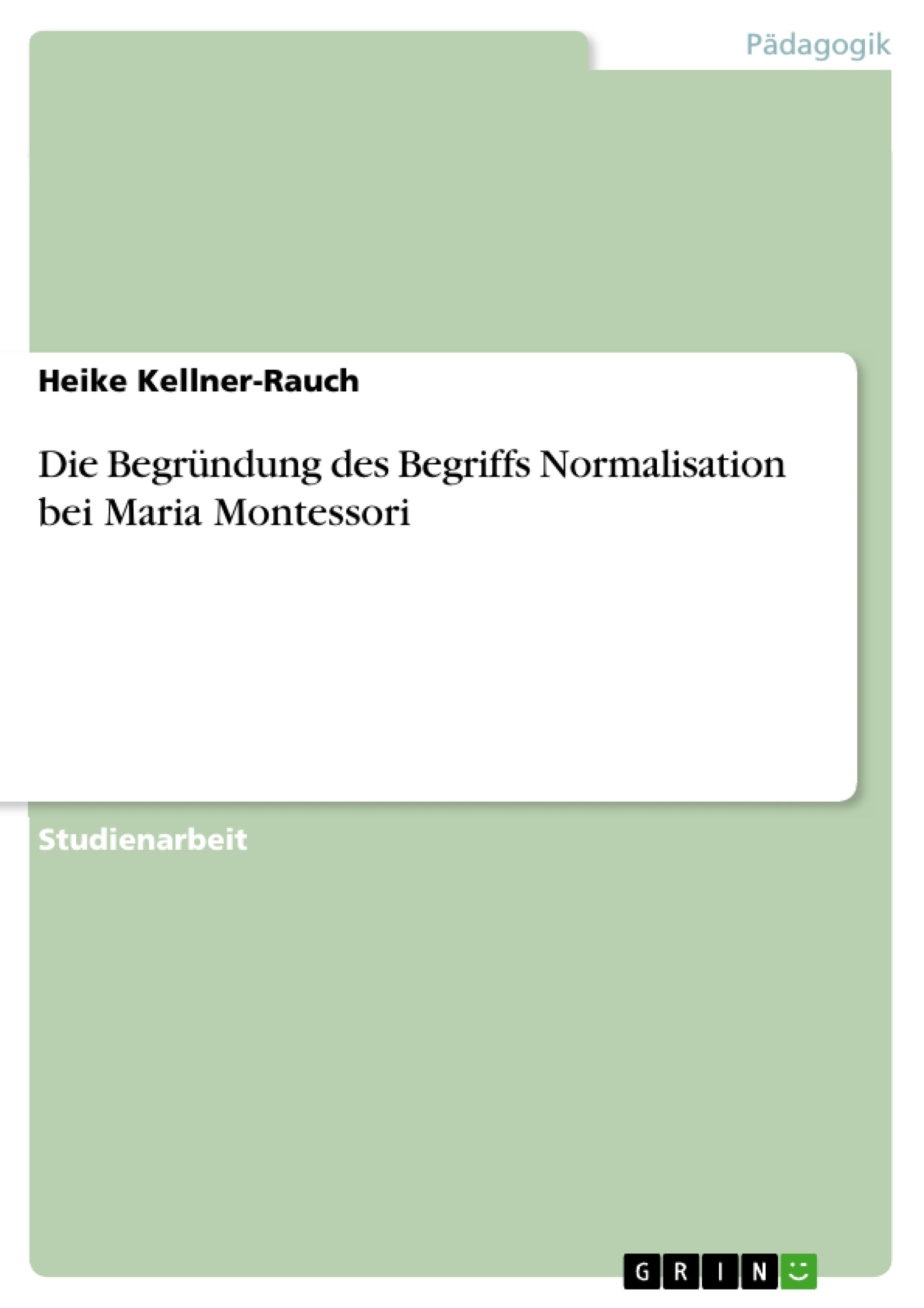Montessori-Pädagogik wird meist zuerst mit ihren Methoden in Verbindung gebracht: Freiarbeit, didaktisches Material, die vorbereitete Umgebung. Bleibt man auf dieser praktisch-methodischen Ebene stehen, ist es naheliegend zum Montessori-Fan zu werden. Entsteht doch durch diese Methode ein Bild von einer menschenfreundlichen Schule in der Kinder nach ihren Fähigkeiten gefördert werden können und nicht dem üblichen Druck ausgesetzt sind. Zahlreiche praktische Publikationen geben Zeugnis von der Anwendung. Zu leicht wird dabei jedoch das Ziel der Montessori-Pädagogik aus den Augen verloren. Worum ging es Montessori in ihrer Bildungstheorie? Wo ist der Ansatzpunkt für eine Weiterentwicklung der Montessori-Pädagogik? Was muß bei der praktischen Umsetzung in den Brennpunkt des Interesses gestellt werden?
Montessori war keine Praktikerin in der pädagogischen Arbeit mit Kindern. Vielmehr war sie eine Frau, die aus mannigfaltigen Quellen gespeist ein Praxiskonzept (so Dickopp 1998, S. 18) einer personal-transzendentalen Pädagogik erstellt hat. Sie ist keine Theoretikerin mit großem philosophischen Überbau und sie ist in keinster Weise eine pädagogische Systematikerin, die sich selbst Disziplin in ihrer Argumentation auferlegt hätte. Sie ist aber auch keine "einfache" Denkerin. Sie ist eine Pädagogin des 20. Jahrhunderts, die die Umbrüche und Brüche ihrer Zeit wahrgenommen und zu einer Vision von Erziehung verarbeitet hat. Eine Vision, die auch im beginnenden 21. Jahrhundert wegweisend sein kann.
Ihre Thesen sind Reflexionen über das, was am Kind beobachtet werden kann, schwer zu beweisen und auch über das konkret Sichtbare hinausgehend. Dennoch für die pädagogische Praxis Handlungsorientierung und Verstehenshilfe - wenn man sich auf ihr Denken einlassen will und kann, was im Letzten bedeutet sich auf das Geheimnis, das im Menschen verborgen ist, einzulassen.
Montessoris Grundannahme wird zum Zielbegriff: Es ist hier zu hinterfragen ob aus dem Beobachteten (kurz: Menschen entwickeln sich unter bestimmten Umständen auf eine bestimmte Weise, hier "normal" zu individuellen und sozialen Personen) ein Ziel (hier: Erziehung muß Kinder das Personwerden ermöglichen, muß Normalisation sein) abgeleitet werden darf. Ist das Konzept der Normalisation ein naturalistischer Fehlschluß weil es das IST mit dem SOLL, das Seiende mit dem Angezielten verwechselt?
Aus welchen Quellen ist das Konzept gespeist? Wie begründet Montessori Normalisation? Und was ist Normalisation überhaupt?
Inhaltsverzeichnis
- Problemaufriß - Horizont der Fragestellung
- Der Zielbegriff der Normalisation - Notwendige Begriffsklärungen
- Ordnung - Weg und Ziel der Normalisation
- Die Lebensenergien des Menschen
- Die Personalität des Menschen
- Der innere Bauplan des Menschen
- Was ist Normalität?
- Deviation - ein kurzer Blick auf den Gegenbegriff
- Wie begründet Maria Montessori ihr Konzept der Normalisation?
- "Deviation und Normalisation" (1934/1996)
- "Über die Bildung des Menschen" (1947)
- Zusammenfassung
- Welche Quellen speisen das Konzept der Normalisation? Die Wurzeln des pädagogischen Denkens Maria Montessoris
- Die Welt folgt einer kosmischen Ordnung
- Jeder Mensch hat einen Bauplan in sich.
- Das Kind ist Subjekt seiner Entwicklung.
- Das Konzept der Normalisation ein naturalistischer Fehlschluß?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Maria Montessoris Konzept der Normalisation. Ziel ist es, die Begründung dieses Konzepts zu verstehen, seine Quellen aufzuzeigen und seine philosophischen Implikationen zu beleuchten. Dabei wird die Frage nach einem möglichen naturalistischen Fehlschluss kritisch geprüft.
- Montessoris Verständnis von Normalisation als Ziel pädagogischer Arbeit
- Die Rolle von Ordnung und Lebensenergien im Normalisationsprozess
- Die Bedeutung der Personalität und des inneren Bauplans des Menschen
- Die philosophischen Quellen Montessoris Konzeptes
- Kritik des Konzepts der Normalisation
Zusammenfassung der Kapitel
Problemaufriß - Horizont der Fragestellung: Der einführende Abschnitt beleuchtet die gängige Wahrnehmung der Montessori-Pädagogik, die sich oft auf die Methoden konzentriert und das übergeordnete Ziel aus den Augen verliert. Die Arbeit stellt die Frage nach dem eigentlichen Ziel Montessoris und der Begründung ihres Konzepts der Normalisation, wobei die kritische Auseinandersetzung mit der möglichen Verwechslung von Sein und Sollen im Mittelpunkt steht.
Der Zielbegriff der Normalisation - Notwendige Begriffsklärungen: Dieses Kapitel definiert Montessoris Normalisation als eine zweite Geburt, in der der Mensch seine Identität findet und psychische Gesundheit erreicht. Es erklärt Normalisation als die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit gemäß einem inneren Bauplan, ermöglicht durch konzentriertes Handeln und die Ordnung der psychischen Energien. Die Rolle der vorbereiteten Umgebung und der selbstständigen Arbeit wird im Kontext der inneren und äußeren Ordnung erläutert.
Wie begründet Maria Montessori ihr Konzept der Normalisation?: Dieser Abschnitt untersucht Montessoris Begründung der Normalisation anhand ihrer Schriften. Er analysiert ihre Argumentation und die Verbindung zwischen ihrer Pädagogik und ihren philosophischen Überzeugungen. Es werden wichtige Konzepte wie die "psychische Gesundheit" und die Selbsterziehung des Kindes erörtert.
Welche Quellen speisen das Konzept der Normalisation? Die Wurzeln des pädagogischen Denkens Maria Montessoris: Hier werden die philosophischen und anthropologischen Quellen Montessoris Konzeptes der Normalisation untersucht. Es wird die Bedeutung der kosmischen Ordnung, des inneren Bauplans jedes Menschen und die zentrale Rolle des Kindes als Subjekt seiner eigenen Entwicklung herausgestellt.
Schlüsselwörter
Maria Montessori, Normalisation, psychische Gesundheit, Personalität, innerer Bauplan, Ordnung, Lebensenergien, Selbsterziehung, naturalistischer Fehlschluss, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Maria Montessoris Konzept der Normalisation"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Maria Montessoris Konzept der Normalisation. Sie beleuchtet die Begründung dieses Konzepts, seine philosophischen Quellen und seine Implikationen. Ein kritischer Schwerpunkt liegt auf der Prüfung eines möglichen naturalistischen Fehlschlusses.
Welche Themen werden im Inhaltsverzeichnis behandelt?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst folgende Punkte: Problemaufriss, Begriffsklärungen zum Ziel der Normalisation (Ordnung, Lebensenergien, Personalität, Normalität, Deviation), Montessoris Begründung des Konzepts anhand ihrer Schriften ("Deviation und Normalisation", "Über die Bildung des Menschen"), die philosophischen Quellen des Konzepts (kosmische Ordnung, innerer Bauplan, Kind als Subjekt) und schließlich die kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept als naturalistischer Fehlschluss.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Montessoris Verständnis von Normalisation als pädagogisches Ziel zu verstehen, die Rolle von Ordnung und Lebensenergien im Normalisationsprozess zu beleuchten, die Bedeutung der Personalität und des inneren Bauplans zu erörtern, die philosophischen Quellen des Konzepts aufzuzeigen und es kritisch zu hinterfragen.
Wie wird Montessoris Konzept der Normalisation definiert?
Montessoris Normalisation wird als eine Art "zweite Geburt" definiert, in der der Mensch seine Identität findet und psychische Gesundheit erreicht. Es ist die Entfaltung der individuellen Persönlichkeit gemäß einem inneren Bauplan, ermöglicht durch konzentriertes Handeln und die Ordnung der psychischen Energien. Die vorbereitete Umgebung und selbstständige Arbeit spielen dabei eine entscheidende Rolle.
Welche Quellen speisen Montessoris Konzept der Normalisation?
Die philosophischen und anthropologischen Quellen umfassen die Annahme einer kosmischen Ordnung, die Vorstellung eines in jedem Menschen angelegten Bauplans und die zentrale Rolle des Kindes als Subjekt seiner eigenen Entwicklung.
Welche Schriften von Maria Montessori werden analysiert?
Die Arbeit analysiert insbesondere "Deviation und Normalisation" (1934/1996) und "Über die Bildung des Menschen" (1947), um Montessoris Begründung der Normalisation zu verstehen und ihre Argumentation nachzuvollziehen.
Wird das Konzept der Normalisation kritisch hinterfragt?
Ja, die Arbeit prüft kritisch, ob Montessoris Konzept einen naturalistischen Fehlschluss darstellt, also eine unzulässige Vermischung von Sein und Sollen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis der Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Maria Montessori, Normalisation, psychische Gesundheit, Personalität, innerer Bauplan, Ordnung, Lebensenergien, Selbsterziehung, naturalistischer Fehlschluss und Pädagogik.
Wie werden die Kapitel zusammengefasst?
Die Zusammenfassung der Kapitel gibt einen Überblick über den Problemaufriss, die Begriffsklärung der Normalisation, die Analyse von Montessoris Begründung, die Untersuchung der philosophischen Quellen und die kritische Auseinandersetzung mit dem Konzept.
- Quote paper
- Heike Kellner-Rauch (Author), 2001, Die Begründung des Begriffs Normalisation bei Maria Montessori, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/3531