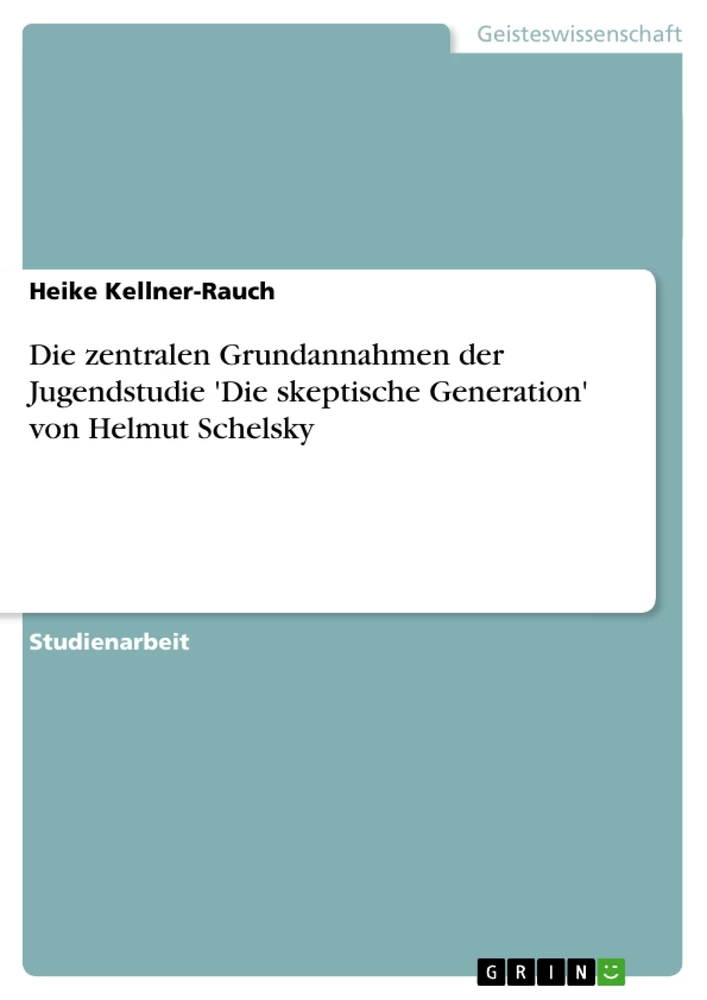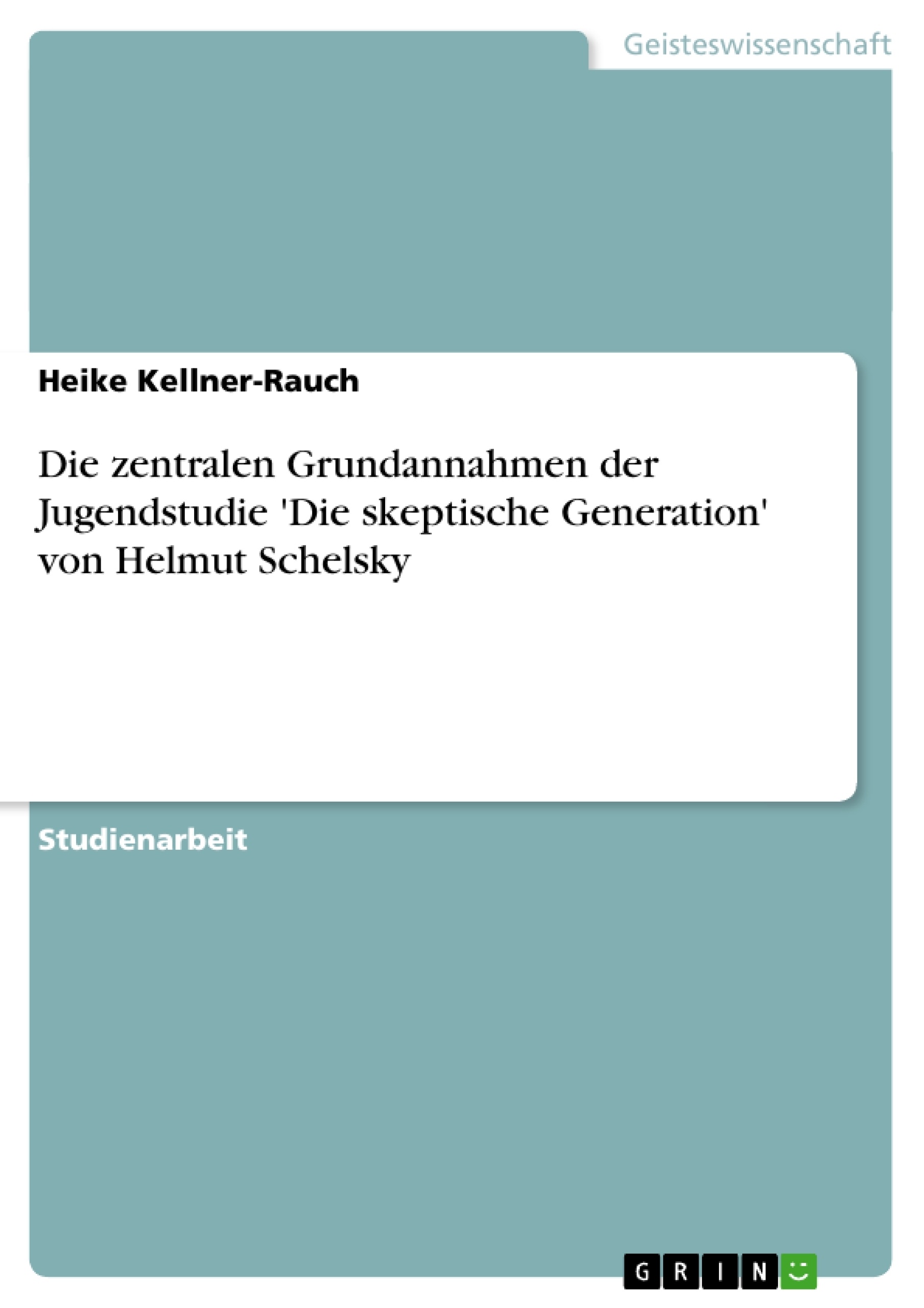Schelsky verwertete die empirischen Jugendstudien seiner Zeit, die er im Vorwort der „Skeptischen Generation“ benennt (S. 6f.). Ihn leitete die Frage nach einem Gesamtbild der deutschen Jugend, soweit sie dem Soziologen zugänglich sei und überhaupt als Einheit vorhanden. Er verfolgt einen dezidiert jugendsoziologischen und keinen pädagogischen Ansatz. Dies scheint mir einer der Gründe für das spätere Kreuzfeuer der Kritik zu sein, in das Schelsky mit dieser Studie geriet.
Schelsky kritisiert die Vormachtstellung der Oberschüler als darstellungsleitendes Modell von Jugend in vielen Jugendstudien und stellt in seiner Studie eine „Analyse der berufstätigen Jugend zwischen 14 und 25 Jahren“ dagegen, „und zwar nicht nur aus dem Grunde, daß die repräsentativen sozialwissenschaftlichen Erhebungen die Masse des Durchschnitts der Generation stärker zur Geltung bringen, sondern weil (... ihm) der junge Arbeiter und Angestellte, und nicht der Oberschüler und Hochschüler, die strukturleitende und verhaltensprägende Figur dieser Jugendgeneration darzustellen scheint.“ (Schelsky 1958, S. 8)
Gegenstand der Studie sind diejenigen, die zwischen 1945 und 1955 in Deutschland jung gewesen sind, ungefähr also die Geburtsjahrgänge 1920 und 1940. Schelsky folgt damit zunächst einer qualitativ-jahrganghaften Abgrenzung des Jugendalters: Zur Jugend zählen junge Menschen zwischen 15 und ca. 25 Jahren. Dieser jahrganghaften Abgrenzung liegt jedoch eine deutliche soziologische Definition zu Grunde: Jugend, das sind die jungen Menschen die die Schulpflicht erfüllt haben und somit NICHT MEHR KIND sind, die aber auch NOCH NICHT ERWACHSEN sind, im Sinne, dass sie noch nicht die vollgültigen und vollverantwortlichen Träger der Gesellschaft sind (vgl. Schelsky 1958, S. 16).
Inhaltsverzeichnis
- Um wen geht es in Schelskys Jugendstudie?
- Schelskys Grundhypothese: Jugend ist Übergang
- Das Verhalten der Jugendlichen wird durch drei verschiedene Faktoren-gruppen bestimmt
- Die epochale Sozialstruktur – in den ersten 50 Jahren des 20. Jahrhunderts auch ein Übergang. Oder: Das Grundproblem an der Türe zur Moderne
- Das Grundbedürfnis der Jugend ist Verhaltenssicherheit. Drei zeitgeschichtliche Lösungsversuche des Sicherheitsproblems
- Zur Kritik an Schelskys Jugendstudie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die zentralen Grundannahmen der Jugendstudie „Die skeptische Generation" von Helmut Schelsky. Der Fokus liegt insbesondere auf der Kritik an Schelskys Studie durch Wolfgang Fischer. Ziel ist es, die Kernaussagen von Schelskys Jugendstudie darzustellen und die kritische Auseinandersetzung mit dessen Schlussfolgerungen zu beleuchten.
- Die Definition von Jugend in Schelskys Studie
- Schelskys These der Jugend als Übergangsphase
- Die Rolle der Sozialstruktur und der Verhaltenssicherheit
- Kritik an Schelskys Studie durch Wolfgang Fischer
- Das Konzept der "Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen"
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Zielgruppe von Schelskys Jugendstudie und stellt die abgrenzungskriterien für die "skeptische Generation" dar. Im zweiten Kapitel werden die Grundannahmen der Studie vorgestellt, die Jugend als Übergangsphase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter definiert. Kapitel 3 beleuchtet die Faktoren, die das Verhalten der Jugend beeinflussen, während Kapitel 4 die epochale Sozialstruktur des 20. Jahrhunderts im Kontext der Studie analysiert. Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Grundbedürfnis der Jugend nach Verhaltenssicherheit und den zeitgeschichtlichen Lösungsversuchen. Das letzte Kapitel befasst sich mit der Kritik an Schelskys Studie, die in seiner Zeit und auch in der Gegenwart relevantes bleibt.
Schlüsselwörter
Jugendstudie, "Die skeptische Generation", Helmut Schelsky, Wolfgang Fischer, Jugend, Übergangsphase, Sozialstruktur, Verhaltenssicherheit, Kritik, zeitgeschichtliche Lösungsversuche, "Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen".
- Quote paper
- Heike Kellner-Rauch (Author), 2002, Die zentralen Grundannahmen der Jugendstudie 'Die skeptische Generation' von Helmut Schelsky, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/35199