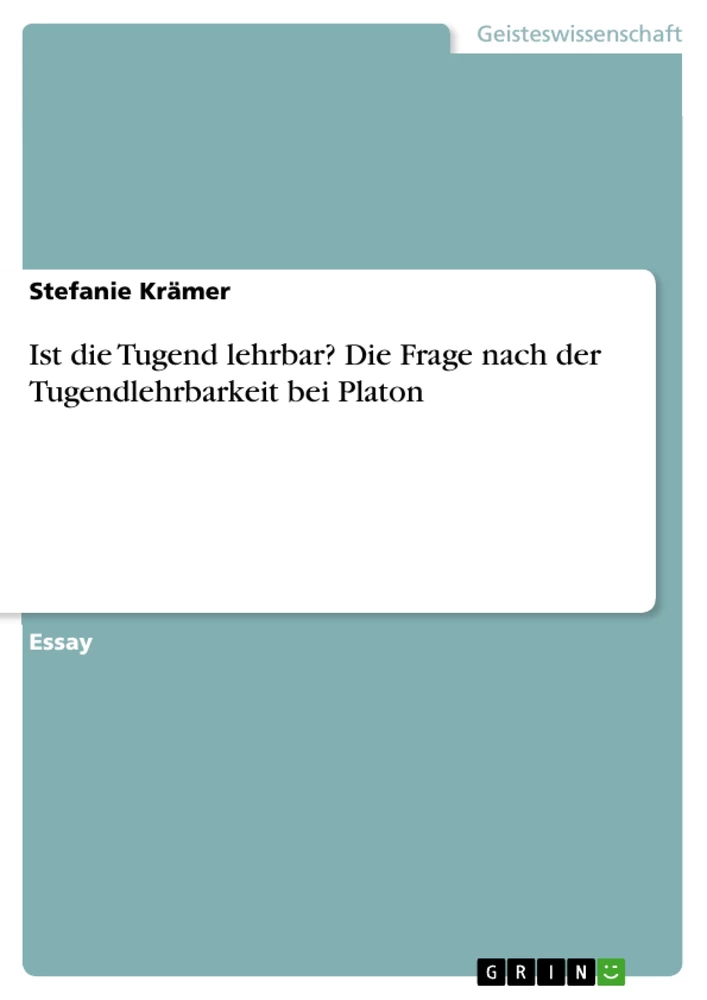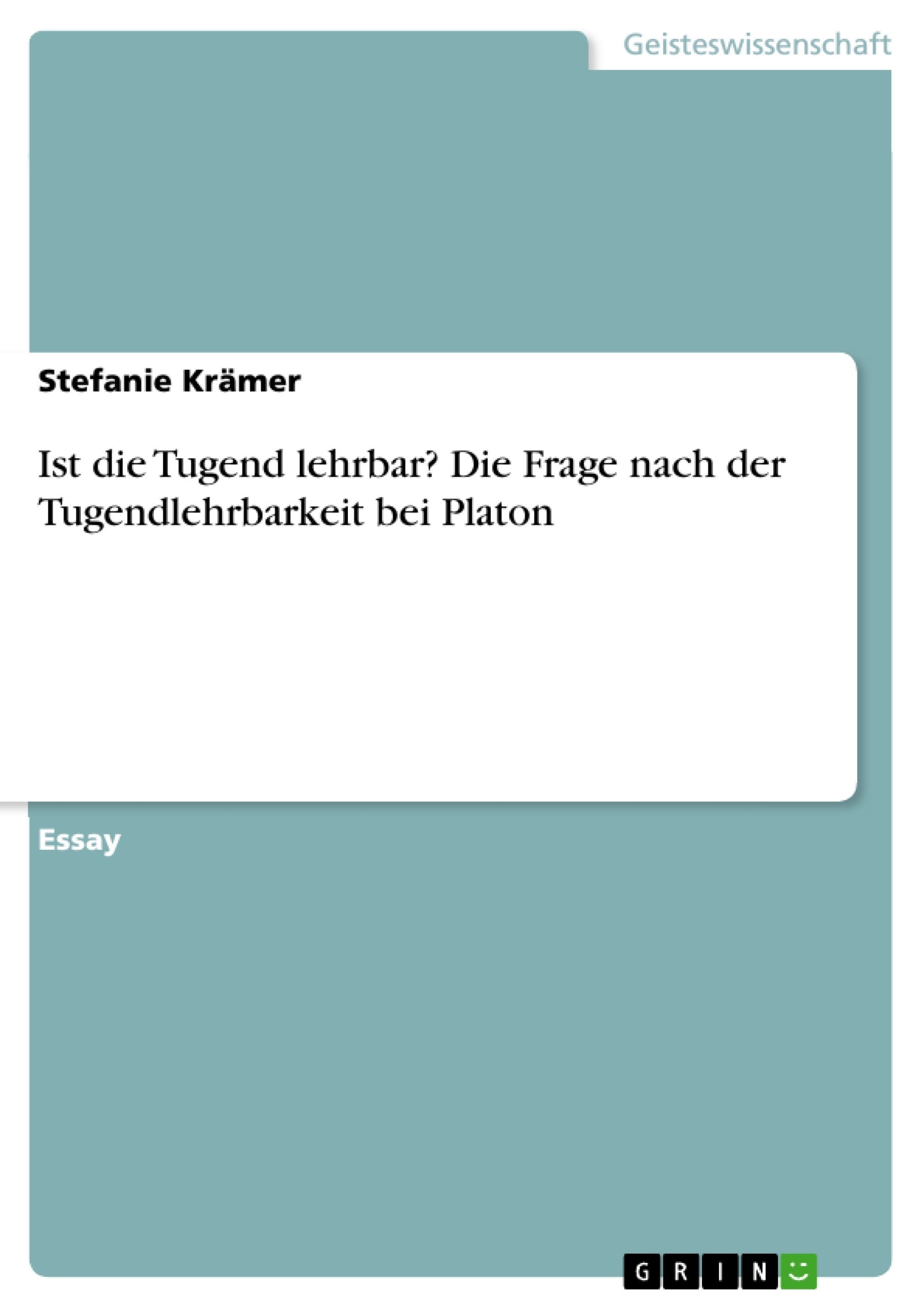Kommt einen der Begriff „Tugend“ in Verbindung mit der Antike zu Ohren, muß man
zu aller erst unweigerlich an die vier platonischen Kardinaltugenden denken. Unter
diesen umhüllenden Mantel fallen die überragenden Tugenden der Tapferkeit,
Besonnenheit, Klugheit und Gerechtigkeit, die zu einem glücklichen Leben
befähigen. Die Bezeichnung Kardinaltugend fußt im Lateinischen „cardo“ und
bedeutet so viel wie „Türangel“. Es wird deutlich, daß es sich um
Rahmenbedingungen, ja Grundtugenden handelt, die unerläßlich für das Ansehen
eines guten Mannes, eines guten Bürgers durch die Gesellschaft, aber vor allem
durch ihn selbst sind. Aufgrund dessen nehmen die vier Kardinaltugenden für das
gesamte soziale Zusammenleben und um auf den Spuren Platons zu bleiben, auch
für die Gründung einer Polis, eine essentielle Rolle ein. Die Grundtugenden gelten
dabei für Platon als Garant für die Gesundheit der Seele, indem sie für eine gute
Lebensführung sorgen. Diesem Weg zu folgen stellt den obersten Bezug allen
Handelns dar.
Die Gerechtigkeit (dikaiosynê) ist eine von Zeus gegebene Tugend, die durch
die Lebenserfahrung weiter entwickelt und geprägt wird. Sie postuliert eine innere
ethische und moralische Gesetzgebung des Denkens und Verhaltens, die sich
individuell verfestigt und durch sich selbst zwingend und maßgebend ist. Gerecht gilt
in der Polis derjenige, der an den in der Gesellschaft anerkannten Sitten und
Bräuchen sein Handeln ausrichtet und der seinen Pflichten als Bürger und seinem
Gott gegenüber nachkommt. Nach Platon ist Gerechtigkeit die oberste Tugend, denn
diese stellt sich automatisch ein, wenn ein Einklang zwischen den anderen drei
Tugenden und den entsprechenden Seelenteilen (thymmoeides = Begierdeteil,
epithymêtikon = Mutteil, logistikon = Vernunftteil) herrscht. Dieses harmonische
Verhältnis kann nur dadurch herbeigeführt werden, indem jeder Seelenteil
ausschließlich seine Funktion und Aufgabe verrichtet, ohne seinen Fokus auf andere
Dinge zu richten. Geleitet werden dabei alle Seelenteile von der Idee des Guten.
Dieses Schema läßt sich ohne weiteres auch auf die Beziehung zwischen den
Individuen und ihrem Kollektiv übertragen, denn für Platon ist der Staat das Abbild
der menschlichen Seele. Auch hier muß eine Harmonie zwischen den subjektiven
Belangen und dem allgemeinen Wohl hergestellt werden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Der Tugendbegriff im 5. Jh. v. Chr.
- Die vier Kardinaltugenden
- Das aretê-Verständnis zu Zeiten Platons
- Die Tugend (aretê), das Gute (agathon) und das Glück (eudaimonia)
- Die Fachkunden (technai) und das Tugendwissen (epistêmê)
- Die Frage nach der Tugendlehrbarkeit
- Die Frage nach der Tugendlehrbarkeit in Platons „Protagoras“
- Die Tugendlehrbarkeit in „Menon“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht den Tugendbegriff im 5. Jahrhundert v. Chr., insbesondere im Kontext des platonischen Denkens. Ziel ist es, das Verständnis von Aretê und seine Beziehung zu Glück (Eudaimonia) und dem Guten (Agathon) zu beleuchten. Dabei wird auch die Frage nach der Lehrbarkeit von Tugend behandelt.
- Die vier Kardinaltugenden (Tapferkeit, Besonnenheit, Klugheit, Gerechtigkeit) und ihre Bedeutung für das Individuum und die Polis.
- Platons Verständnis von Aretê und seine Abgrenzung vom modernen Tugendbegriff.
- Die Rolle von Wissen (Epistêmê) und Können (Technai) im Erreichen von Aretê.
- Die Debatte um die Lehrbarkeit von Tugend in Platons Dialogen „Protagoras“ und „Menon“.
- Die Verbindung von Aretê, dem Guten und dem Glück.
Zusammenfassung der Kapitel
Der Tugendbegriff im 5. Jh. v. Chr.: Dieser einleitende Abschnitt führt in die Thematik des Textes ein und kündigt die Auseinandersetzung mit dem antiken Tugendbegriff, insbesondere im Lichte der vier platonischen Kardinaltugenden, an. Er deutet die Komplexität des Begriffs „Tugend“ an und bereitet den Leser auf die detaillierte Analyse der folgenden Kapitel vor. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der Kardinaltugenden im antiken Kontext und ihrer Rolle im sozialen Gefüge der Polis.
I. Die vier Kardinaltugenden: Dieses Kapitel analysiert die vier Kardinaltugenden – Tapferkeit, Besonnenheit, Klugheit und Gerechtigkeit – im Detail. Es erläutert ihren Ursprung und ihre Bedeutung im platonischen Denken, wobei die Gerechtigkeit als oberste Tugend hervorgehoben wird, deren Erreichung ein harmonisches Zusammenspiel aller Seelenteile erfordert. Jedes Tugend wird im Detail erläutert, mit Betonung auf ihre Bedeutung für das Individuum und den Staat (Polis). Die Kapitel verdeutlicht, wie die Tugenden eng miteinander verknüpft sind und zur Erreichung eines harmonischen und glücklichen Lebens beitragen.
II. Das aretê-Verständnis zu Zeiten Platons: Hier wird das antike Verständnis von Aretê (Tugend) im Detail untersucht und von der modernen Moralvorstellung abgegrenzt. Der Text betont, dass Aretê nicht nur auf moralische Aspekte beschränkt ist, sondern alle Eigenschaften umfasst, die zum Lebenserfolg und Glück beitragen. Es werden Beispiele angeführt, die zeigen, dass nicht nur Menschen, sondern auch Objekte Aretê besitzen können, je nachdem wie gut sie ihre Funktion erfüllen. Der Mensch strebt nach dem Guten (agathon) und Aretê ist die Fähigkeit, ein gutes Leben zu führen.
Die Tugend (aretê), das Gute (agathon) und das Glück (eudaimonia): Dieses Kapitel untersucht die enge Beziehung zwischen Aretê, dem Guten und dem Glück. Aretê wird als Lebensart beschrieben, die sich auf die Persönlichkeit formend auswirkt und zum Glück führt. Es wird die Rolle der philosophischen Einsicht im Erreichen des wahren Glücks (Eudaimonia) betont, wobei die Erkenntnis des Guten als Voraussetzung hervorgehoben wird. Das Kapitel betont den funktionalen Aspekt von Aretê und sein soziales Ansehen.
Schlüsselwörter
Aretê, Tugend, Kardinaltugenden, Platon, Gerechtigkeit (dikaiosynê), Klugheit (phronêsis), Tapferkeit (andreia), Besonnenheit (sôphrosynê), Agathon (das Gute), Eudaimonia (Glück), Polis, Seelenteile, Tugendlehrbarkeit, Epistêmê (Wissen), Technai (Können).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Platon und der Tugendbegriff im 5. Jahrhundert v. Chr.
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit dem antiken Tugendbegriff im 5. Jahrhundert v. Chr., insbesondere im Kontext des platonischen Denkens. Er analysiert das Verständnis von Aretê (Tugend), seine Beziehung zu Glück (Eudaimonia) und dem Guten (Agathon) und untersucht die Frage nach der Lehrbarkeit von Tugend.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Der Text behandelt die vier Kardinaltugenden (Tapferkeit, Besonnenheit, Klugheit, Gerechtigkeit), Platons Verständnis von Aretê im Vergleich zum modernen Tugendbegriff, die Rolle von Wissen (Epistêmê) und Können (Technai) für das Erreichen von Aretê, die Debatte um die Tugendlehrbarkeit in Platons Dialogen „Protagoras“ und „Menon“, sowie die Verbindung zwischen Aretê, dem Guten und dem Glück.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text gliedert sich in Kapitel, die den Tugendbegriff im 5. Jh. v. Chr. einführen, die vier Kardinaltugenden im Detail analysieren, Platons Verständnis von Aretê untersuchen und die Beziehung zwischen Aretê, dem Guten und dem Glück beleuchten. Ein abschließender Abschnitt behandelt die Frage der Tugendlehrbarkeit in Platons Dialogen.
Wie wird Platons Verständnis von Aretê dargestellt?
Platons Aretê-Verständnis wird als umfassender Begriff dargestellt, der über rein moralische Aspekte hinausgeht und alle Eigenschaften einschließt, die zum Lebenserfolg und Glück beitragen. Es wird hervorgehoben, dass nicht nur Menschen, sondern auch Objekte Aretê besitzen können, abhängig von ihrer Funktionsfähigkeit. Der Mensch strebt nach dem Guten (agathon), und Aretê ist die Fähigkeit, ein gutes Leben zu führen.
Welche Rolle spielen Wissen und Können im Kontext von Aretê?
Der Text betont die Rolle von Wissen (Epistêmê) und Können (Technai) beim Erreichen von Aretê. Philosophische Einsicht und die Erkenntnis des Guten werden als Voraussetzungen für wahres Glück (Eudaimonia) hervorgehoben.
Wie wird die Frage der Tugendlehrbarkeit behandelt?
Die Debatte um die Lehrbarkeit von Tugend wird anhand von Platons Dialogen „Protagoras“ und „Menon“ diskutiert. Der Text analysiert die unterschiedlichen Argumentationen in diesen Dialogen und beleuchtet die Komplexität dieser Frage.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für den Text?
Schlüsselbegriffe sind: Aretê, Tugend, Kardinaltugenden, Platon, Gerechtigkeit (dikaiosynê), Klugheit (phronêsis), Tapferkeit (andreia), Besonnenheit (sôphrosynê), Agathon (das Gute), Eudaimonia (Glück), Polis, Seelenteile, Tugendlehrbarkeit, Epistêmê (Wissen), Technai (Können).
Für wen ist dieser Text gedacht?
Dieser Text ist für alle gedacht, die sich für den antiken Tugendbegriff, die Philosophie Platons und die ethische Fragestellung der Tugendlehrbarkeit interessieren. Er eignet sich besonders für akademische Zwecke, z.B. im Rahmen von Studienarbeiten oder wissenschaftlicher Forschung.
- Quote paper
- Stefanie Krämer (Author), 2003, Ist die Tugend lehrbar? Die Frage nach der Tugendlehrbarkeit bei Platon, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/35056