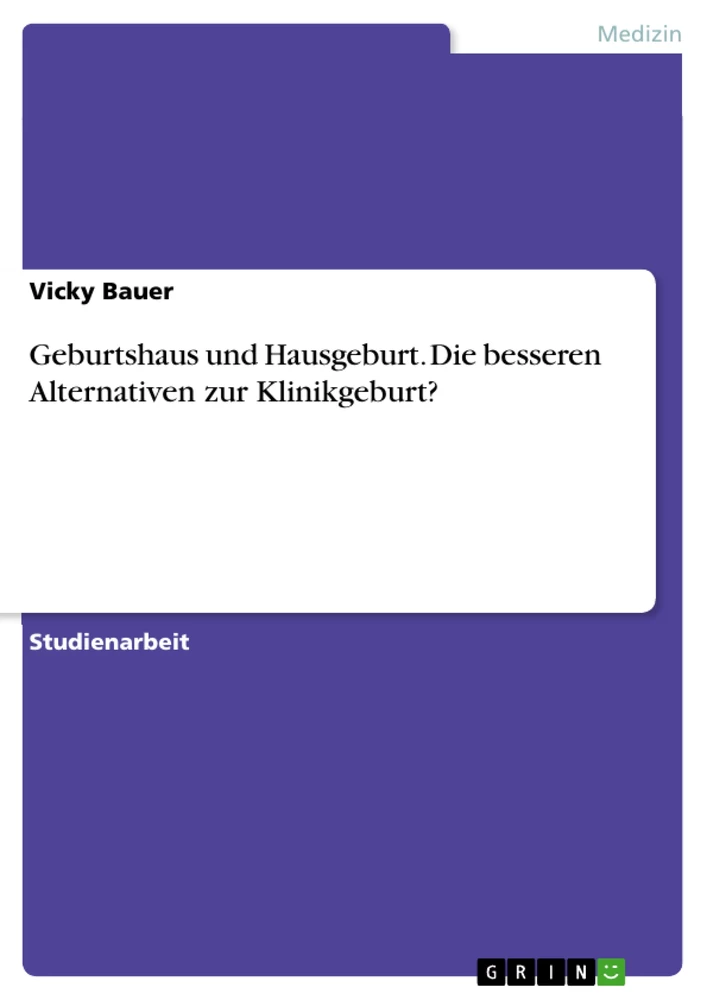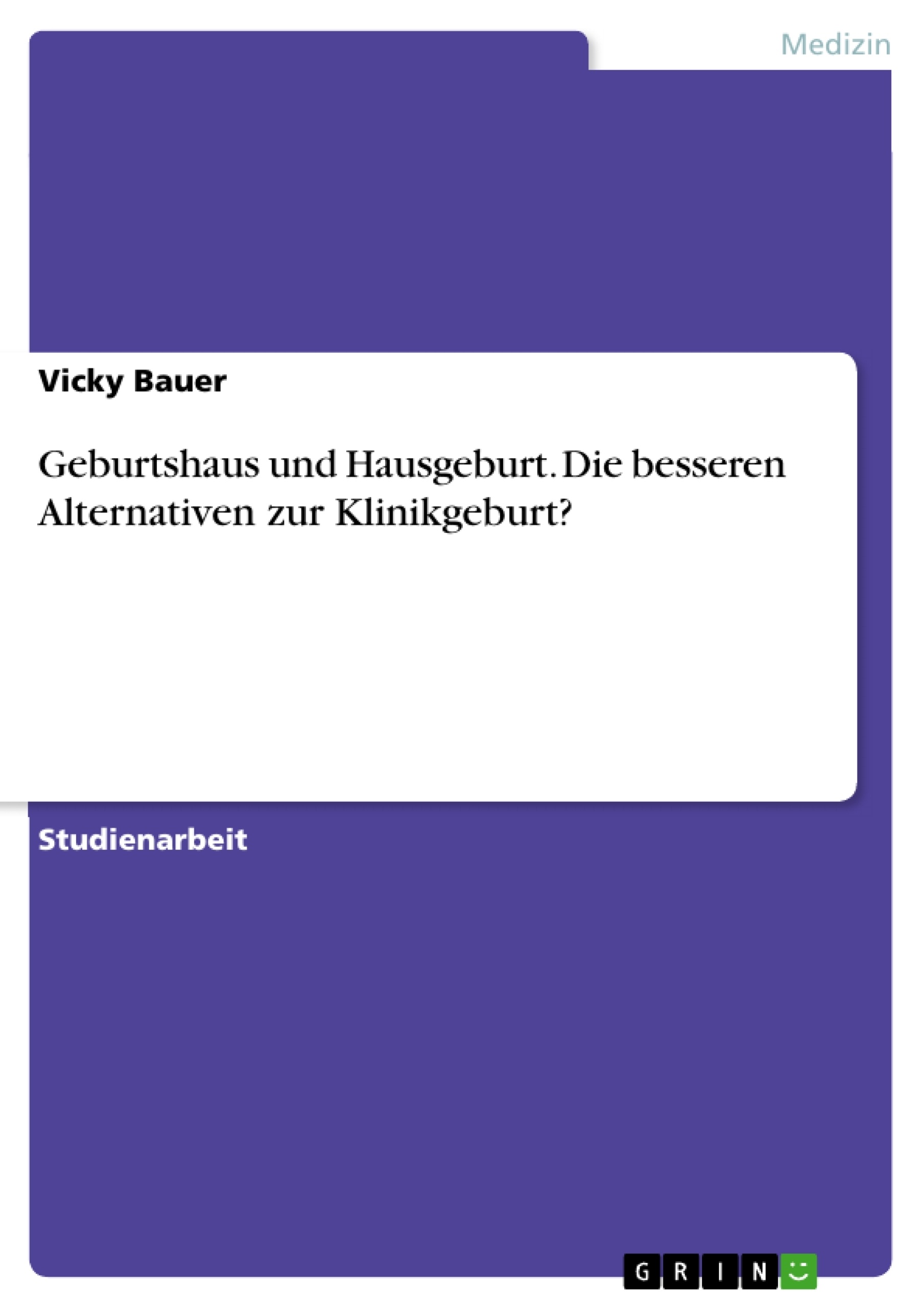In dieser Arbeit wird untersucht, inwieweit die Entbindung im Geburtshaus oder zu Hause eine bessere Alternative zur Klinikgeburt darstellen kann. Zunächst erfolgt ein Überblick über die verschiedenen Formen der Geburtshilfe. Diese werden näher beleuchtet anhand wichtiger Faktoren, welche die Entscheidung für eine bestimmte Geburtsform mitbestimmen können. Anschließend wird eine eigene Fragebogenuntersuchung zum Thema vorgestellt. Nach der Skizzierung der Methode erfolgen die Darstellung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse. In einem weiteren Kapitel wird der Themenbezug zur Sozialen Arbeit diskutiert, bevor in der Schlussbemerkung noch einmal die wichtigsten Gedanken der vorliegenden Arbeit zusammengefasst werden.
Seit der Nachkriegszeit wurde in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland, an Stelle der bis dahin üblichen Hausgeburten, immer stärker die Entbindung in der Klinik forciert. Doch viele Frauen waren mit den Bedingungen der Klinikgeburt nicht einverstanden. So bildeten sich bereits vor mehr als 20 Jahren verschiedene Interessengruppen, die sich kritisch mit dem Klinikbetrieb, der medizinischen Technik und der psychosozialen Betreuung von Schwangeren auseinander setzten. Zu Anfang der siebziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts stand zunächst die “sanfte Geburt” im Mittelpunkt, bei der es vor allem um die Vermeidung einer Trennung des Neugeborenen von der Mutter geht. Auch die Aufwertung des Stillens erhielt in diesem Kontext als ein wichtiger psychosozialer Aspekt der Mutter-Kind-Beziehung besondere Beachtung. Heute sind die Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich der Geburtsform so breit gefächert wie nie zuvor. Zwischen “natürlicher Entbindung“ und “medizinisch programmierter Geburt“ gibt es mittlerweile ein weites Feld an Möglichkeiten, wo und wie eine Geburt ablaufen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geburtshaus und Hausgeburt versus Klinikgeburt
- 2.1 Die verschiedenen Formen der Geburtshilfe
- 2.2 Wichtige Aspekte der Entscheidung für eine bestimmte Geburtsform
- 2.3 Mögliche Vorteile der Entbindung im Geburtshaus oder der Hausgeburt gegenüber der Klinikgeburt
- 3. Eine eigene Untersuchung zum Thema
- 3.1 Beschreibung der Stichprobe und des methodischen Vorgehens
- 3.2 Darstellung der Ergebnisse
- 3.3 Diskussion der Ergebnisse
- 4. Geburtshilfe im sozialarbeiterischen Kontext
- 5. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob eine Entbindung im Geburtshaus oder zu Hause eine bessere Alternative zur Klinikgeburt darstellt. Die Autorin beleuchtet verschiedene Geburtsformen und analysiert die Faktoren, die die Wahl der Geburtsart beeinflussen. Eine eigene empirische Untersuchung liefert zusätzliche Erkenntnisse.
- Vergleich verschiedener Geburtsformen (Klinikgeburt, Geburtshausgeburt, Hausgeburt)
- Analyse der Entscheidungsfaktoren bei der Wahl der Geburtsform
- Auswertung einer eigenen empirischen Untersuchung zu den Präferenzen von werdenden Müttern
- Bedeutung der Geburtshilfe im sozialarbeiterischen Kontext
- Bewertung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Geburtsmöglichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert den Wandel der Geburtshilfe in Deutschland von der Hausgeburt zur Klinikgeburt und die darauf folgende Entstehung von Alternativen wie Geburtshäusern. Sie erläutert das Ziel der Arbeit: die Untersuchung der Vor- und Nachteile von Geburtshaus- und Hausgeburten im Vergleich zur Klinikgeburt. Der methodische Aufbau der Arbeit, inklusive der eigenen Untersuchung, wird kurz vorgestellt.
2. Geburtshaus und Hausgeburt versus Klinikgeburt: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Geburtsformen, wobei der Schwerpunkt auf Klinikgeburten, Geburtshausgeburten und Hausgeburten liegt. Die Klinikgeburt wird im Detail beschrieben, inklusive der medizinischen Möglichkeiten und des typischen Ablaufs. Die Vorteile des Geburtshauses, wie die individuelle Betreuung durch eine vertraute Hebamme und die Möglichkeit einer natürlichen Geburt in einer privaten Atmosphäre, werden hervorgehoben. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der verschiedenen Modelle, ihrer Vor- und Nachteile in Bezug auf medizinische Sicherheit und die psychosoziale Betreuung.
3. Eine eigene Untersuchung zum Thema: Dieses Kapitel beschreibt die durchgeführte empirische Untersuchung. Es wird die Methodik der Studie (z.B. Stichprobengröße, angewandte Methode) detailliert erläutert, bevor die Ergebnisse präsentiert und diskutiert werden. Die Diskussion der Ergebnisse legt den Fokus auf die Interpretation der Daten und ihren Bezug zu den im vorherigen Kapitel dargestellten Aspekten der unterschiedlichen Geburtsformen. Die Ergebnisse sollen einen Beitrag zur Beantwortung der Forschungsfrage leisten.
4. Geburtshilfe im sozialarbeiterischen Kontext: Dieses Kapitel beleuchtet die Relevanz der Geburtshilfe aus sozialarbeiterischer Perspektive. Es wird auf die soziale Dimension der Geburtserfahrung eingegangen, sowie auf die unterstützende Rolle der Sozialarbeit in diesem Kontext. Die möglichen Herausforderungen und Chancen, die sich im Zusammenhang mit den verschiedenen Geburtsformen für die Sozialarbeit ergeben, werden wahrscheinlich thematisiert.
Schlüsselwörter
Geburtshaus, Hausgeburt, Klinikgeburt, Geburtshilfe, Hebamme, natürliche Geburt, medizinische Versorgung, psychosoziale Betreuung, empirische Untersuchung, soziale Arbeit
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Geburtshaus und Hausgeburt versus Klinikgeburt
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Vor- und Nachteile von Geburtshaus- und Hausgeburten im Vergleich zur Klinikgeburt. Sie beleuchtet verschiedene Geburtsformen und analysiert die Faktoren, die die Wahl der Geburtsart beeinflussen. Eine eigene empirische Untersuchung liefert zusätzliche Erkenntnisse zur Präferenz werdender Mütter.
Welche Geburtsformen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht Klinikgeburten, Geburtshausgeburten und Hausgeburten. Der Vergleich umfasst medizinische Aspekte, die psychosoziale Betreuung und die individuellen Vor- und Nachteile der jeweiligen Geburtsform.
Welche Aspekte werden in der Analyse berücksichtigt?
Die Analyse berücksichtigt medizinische Möglichkeiten, den Ablauf der Geburt, die individuelle Betreuung durch Hebammen, die Atmosphäre der Geburt (privat vs. klinisch), und die soziale Dimension der Geburtserfahrung.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Vergleich verschiedener Geburtsformen, ein Kapitel mit der Beschreibung und Auswertung einer eigenen empirischen Untersuchung, ein Kapitel zur Geburtshilfe im sozialarbeiterischen Kontext und eine Schlussbemerkung. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel erleichtern die Navigation.
Welche Methodik wurde in der empirischen Untersuchung angewendet?
Die Arbeit beschreibt detailliert die Methodik der eigenen empirischen Untersuchung, einschließlich Stichprobengröße und angewandter Methode. Die Ergebnisse werden präsentiert und im Kontext der anderen Kapitel diskutiert.
Welche Rolle spielt die Sozialarbeit in dieser Arbeit?
Ein Kapitel widmet sich der Bedeutung der Geburtshilfe aus sozialarbeiterischer Sicht. Es werden die soziale Dimension der Geburtserfahrung und die unterstützende Rolle der Sozialarbeit in diesem Kontext beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Geburtshaus, Hausgeburt, Klinikgeburt, Geburtshilfe, Hebamme, natürliche Geburt, medizinische Versorgung, psychosoziale Betreuung, empirische Untersuchung, soziale Arbeit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Autorin?
Die Autorin untersucht, ob eine Entbindung im Geburtshaus oder zu Hause eine bessere Alternative zur Klinikgeburt darstellt. Die Arbeit zielt darauf ab, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Geburtsformen zu beleuchten und die Entscheidungsfaktoren der werdenden Mütter zu analysieren.
- Arbeit zitieren
- Vicky Bauer (Autor:in), 2007, Geburtshaus und Hausgeburt. Die besseren Alternativen zur Klinikgeburt?, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/344700