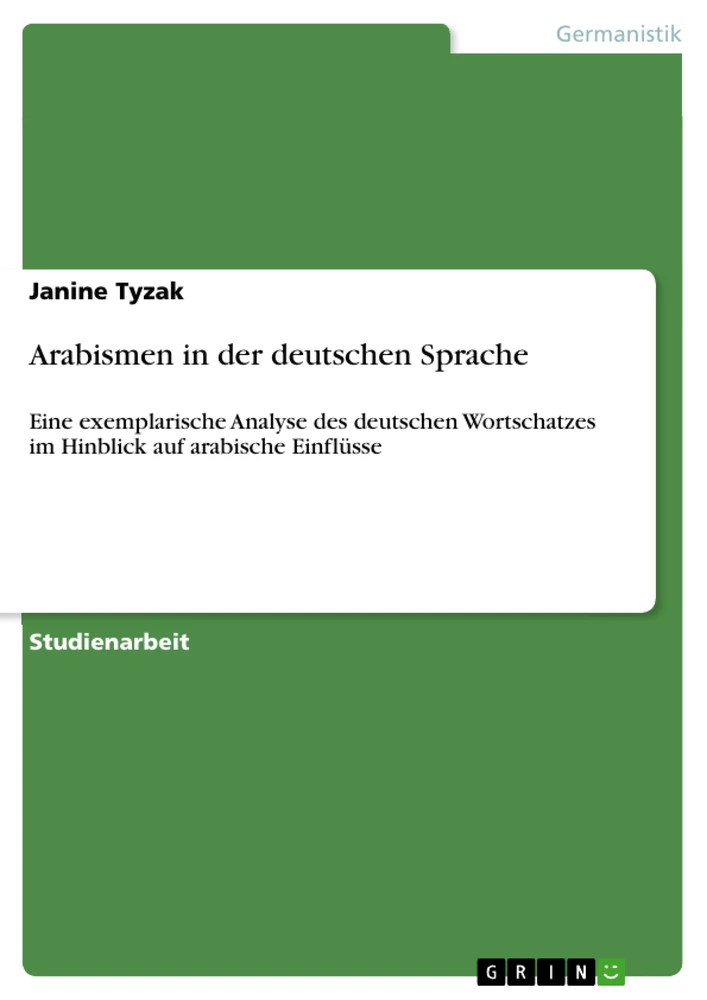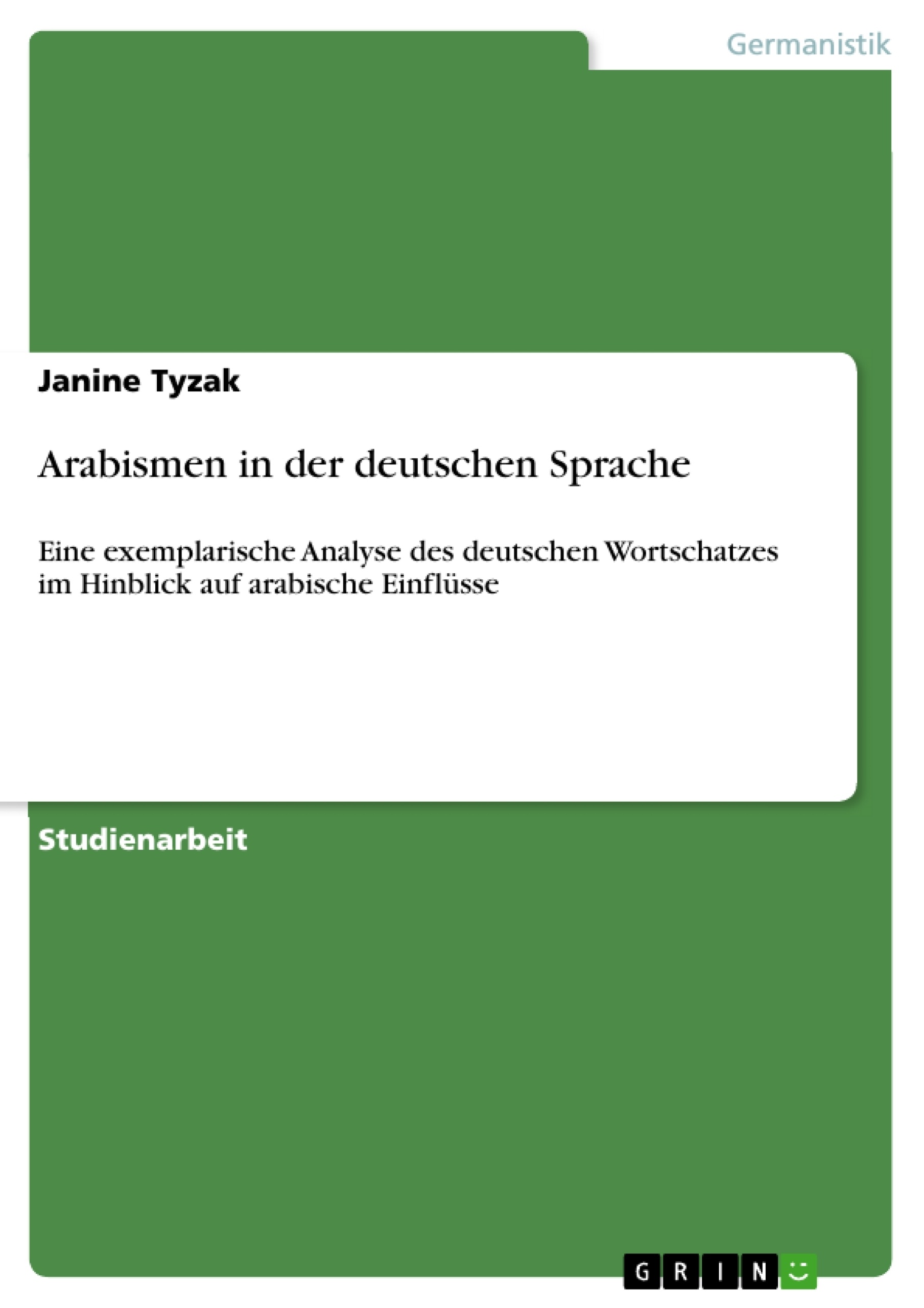Zucker, Matratze, Giraffe, Alkohol, Rasse oder Marzipan sind Wörter, die in der deutschen Standardsprache alltäglich verwendet werden. Oft sind diese Wörter phonologisch so in das deutsche Sprachsystem integriert, dass sie im Sprecherbewusstsein nicht als Transferenzen oder Fremdwörter wahrgenommen werden. All diese einführenden Worte haben eine Gemeinsamkeit, denn sie finden ihren Ursprung in der arabischen Sprache.
Die folgende Hausarbeit beschäftigt sich auf der Metaebene mit dem Diskurs arabischer Transferenzen in der deutschen Standardsprache. Dabei wird zunächst eine komprimierte Einführung in die arabische Sprache gegeben, um einen fundierten Grundstein für weiterführende Überlegungen zu ermöglichen. Anschließend werden relevante terminologischen Begriffe definiert, um die arabische Sprache dann als Spendersprache zu thematisieren. Dabei werden vor allem historische Ereignisse fokussiert, welche einen Sprachkontakt zwischen der arabischen Welt und den europäischen Ländern ermöglichten.
Ein Exkurs in die Lexik des Arabischen dient dazu, einen Einblick darüber zu gewinnen, warum deutsche Poeten und Reisende oftmals von dem orientalischen Stoffen fasziniert waren und eine entscheidende Funktion in der Übernahme von direkten Entlehnungen darstellten. Darauffolgend wird die Aufmerksamkeit auf Vermittlersprachen sowie direkte Transferenzen gerichtet.
Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist eine Analyse ausdrucksseitiger Veränderungen von Arabismen im Deutschen, welche auf die verschiedenen Lautsysteme von Geber- und Nehmersprache zurückzuführen sind. Auch arabische Transferenzen im gegenwärtigen Kiezdeutsch, welches als Sprachvarietät des Deutschen bezeichnet werden kann, werden thematisiert, um zu verdeutlichen, dass Arabismen auch heute noch einen wichtigen und oft debattierten Diskurs der deutschen Sprache präsentieren. Abschließend folgt ein Fazit mit Ausblick auf weiterführende Forschungsgebiete bietet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die arabische Sprache
- 3. Terminologische Abgrenzung Fremdwort/Lehnwort
- 4. Die arabische Sprache als Spendersprache
- 4.1 Exkurs: Lexik des Arabischen
- 4.2 Vermittlersprachen
- 4.3 Direkte Transferenzen des Arabischen ins Deutsche
- 5. Ausdrucksseitige Integration
- 5.1 Primäre Graphemkorrespondenzen
- 6. Arabismen in der Jugendsprache: Kiezdeutsch
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Präsenz arabischer Einflüsse auf die deutsche Standardsprache. Das Hauptziel ist es, die Integration arabischer Wörter in den deutschen Wortschatz exemplarisch zu analysieren und aufzuzeigen, wie diese Integration sprachlich und historisch erfolgt ist. Die Arbeit beleuchtet dabei den Einfluss der arabischen Sprache als Spendersprache auf das Deutsche.
- Die Definition und Abgrenzung der Begriffe Fremdwort und Lehnwort
- Historische und kulturelle Faktoren des Sprachkontakts zwischen Arabisch und Deutsch
- Sprachliche Veränderungen und Anpassungen arabischer Wörter im Deutschen
- Die Rolle von Handelsbeziehungen und Kolonialismus bei der Übernahme arabischer Wörter
- Die aktuelle Präsenz von Arabismen in der deutschen Jugendsprache (Kiezdeutsch)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein, indem sie alltäglich verwendete Wörter deutscher Standardsprache nennt, die arabischen Ursprungs sind. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der von einer kurzen Einführung in die arabische Sprache über terminologische Klärungen bis hin zur Analyse der Integration arabischer Wörter im Deutschen und deren aktuellem Gebrauch in der Jugendsprache reicht. Die Einleitung stellt die These auf, dass trotz großer geographischer Distanz und scheinbar geringer direkter Interaktion, die arabische Sprache einen spürbaren Einfluss auf den deutschen Wortschatz hat.
2. Die arabische Sprache: Dieses Kapitel liefert einen kurzen Überblick über die arabische Sprache, ihre Verbreitung und ihren geschichtlichen Kontext. Es hebt die Bedeutung des Korans für die Standardisierung und die hohe religiöse Bedeutung des klassischen Arabisch hervor. Gleichzeitig wird der Gegensatz zum Reichtum an regionalen Dialekten, die vor allem mündlich verwendet werden, angesprochen und der resultierende Diglossie-Zustand erläutert. Dieses Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis der arabischen Sprache als Spendersprache.
3. Terminologische Abgrenzung Fremdwort/Lehnwort: Dieses Kapitel differenziert zwischen den Begriffen Fremdwort und Lehnwort, wobei die fließenden Übergänge zwischen beiden betont werden. Es erklärt, dass ein Lehnwort in die Nehmersprache integriert ist, während ein Fremdwort seine Fremdheit behält. Für die weitere Arbeit wird der Terminus Lehnwort bevorzugt, da die untersuchten Wörter einen hohen Integrationsgrad im Deutschen aufweisen.
4. Die arabische Sprache als Spendersprache: Das Kapitel behandelt die Wege, auf denen arabische Wörter ins Deutsche gelangten. Hierbei werden handelspolitische Beziehungen, die Rolle der arabischen Sprache als Vehikularsprache im Mittelalter und der Einfluss des Kolonialismus (insbesondere die andalusische Periode) als entscheidende Faktoren genannt. Das Kapitel betont den Einfluss von Migration und der Bedeutung der arabischen Sprache als identitätsstiftendes Element für arabischsprachige Bevölkerungsgruppen in Deutschland.
5. Ausdrucksseitige Integration: Dieses Kapitel analysiert die Anpassungen, die arabische Wörter im Deutschen erfahren haben. Es konzentriert sich auf die lautlichen und schriftlichen Veränderungen, die auf die unterschiedlichen Lautsysteme von Geber- und Nehmersprache zurückzuführen sind. Die Tiefe der Analyse von Graphemkorrespondenzen impliziert einen detaillierten Vergleich phonetischer und graphischer Aspekte der Integration von Arabismen.
6. Arabismen in der Jugendsprache: Kiezdeutsch: Dieses Kapitel befasst sich mit der aktuellen Verwendung von arabischen Wörtern in der deutschen Jugendsprache, dem sogenannten Kiezdeutsch. Es unterstreicht, dass Arabismen auch heute noch einen wichtigen Bestandteil des deutschen Sprachgebrauchs darstellen und Gegenstand aktueller sprachwissenschaftlicher Diskussionen sind.
Schlüsselwörter
Arabismen, deutsche Standardsprache, Lehnwort, Fremdwort, Sprachkontakt, Sprachtransfer, arabische Sprache, Spendersprache, Kiezdeutsch, Handel, Kolonialismus, Integration, Graphemkorrespondenzen, Diglossie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Arabische Einflüsse auf die deutsche Standardsprache
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Einfluss der arabischen Sprache auf die deutsche Standardsprache. Sie analysiert die Integration arabischer Wörter in den deutschen Wortschatz, beleuchtet die historischen und sprachlichen Aspekte dieser Integration und betrachtet die aktuelle Präsenz von Arabismen in der deutschen Jugendsprache (Kiezdeutsch).
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Definition und Abgrenzung von Fremdwörtern und Lehnwörtern; historische und kulturelle Faktoren des Sprachkontakts zwischen Arabisch und Deutsch; sprachliche Veränderungen und Anpassungen arabischer Wörter im Deutschen; die Rolle von Handelsbeziehungen und Kolonialismus bei der Übernahme arabischer Wörter; und die aktuelle Präsenz von Arabismen im Kiezdeutsch.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Überblick über die arabische Sprache, terminologische Abgrenzung von Fremd- und Lehnwörtern, die arabische Sprache als Spendersprache, ausdrucksseitige Integration arabischer Wörter, Arabismen im Kiezdeutsch und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas.
Welche Methoden werden in der Hausarbeit verwendet?
Die Hausarbeit verwendet eine deskriptive und analytische Methode. Sie analysiert die Integration arabischer Wörter in den deutschen Wortschatz, indem sie deren sprachliche und historische Entwicklung untersucht. Der Fokus liegt auf der Analyse von Graphemkorrespondenzen, um die Anpassung der arabischen Wörter an das deutsche Sprachsystem zu beleuchten.
Welche Ergebnisse liefert die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zeigt exemplarisch die Integration arabischer Wörter in die deutsche Sprache auf und beleuchtet die Wege, auf denen diese Integration erfolgte (Handel, Kolonialismus, Migration). Sie verdeutlicht den Einfluss der arabischen Sprache als Spendersprache und die aktuelle Bedeutung von Arabismen, insbesondere im Kiezdeutsch.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arabismen, deutsche Standardsprache, Lehnwort, Fremdwort, Sprachkontakt, Sprachtransfer, arabische Sprache, Spendersprache, Kiezdeutsch, Handel, Kolonialismus, Integration, Graphemkorrespondenzen, Diglossie.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Hausarbeit?
Die Hausarbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die den Inhalt jedes Kapitels kurz und prägnant beschreiben. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über die behandelten Themen und die Ergebnisse jedes Kapitels.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Das Hauptziel der Hausarbeit ist es, die Integration arabischer Wörter in den deutschen Wortschatz exemplarisch zu analysieren und aufzuzeigen, wie diese Integration sprachlich und historisch erfolgt ist. Sie beleuchtet den Einfluss der arabischen Sprache als Spendersprache auf das Deutsche.
- Quote paper
- Janine Tyzak (Author), 2014, Arabismen in der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/343343