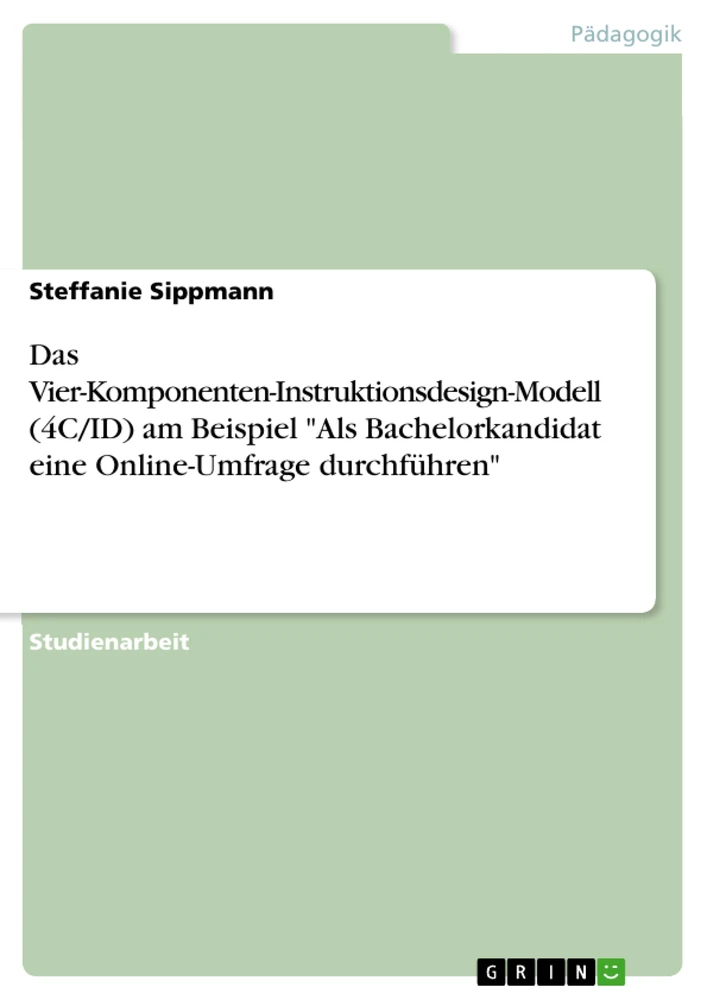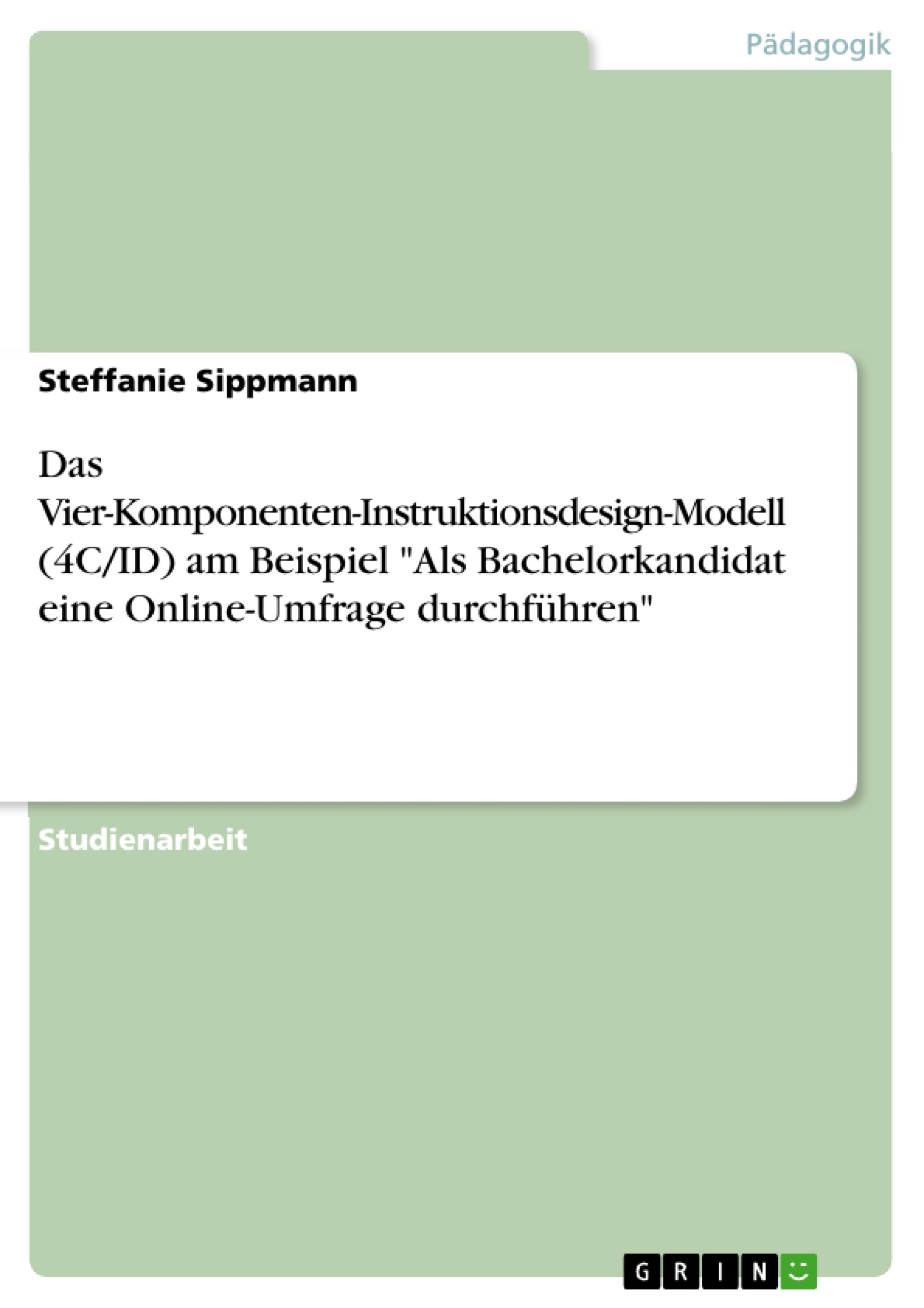Ziel dieser Hausarbeit ist es, einen Schulungsentwurf nach dem Vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modell, kurz 4C/ID, zu entwerfen, der Bachelorkandidaten die Zielkompetenz „Eine Online-Umfrage durchführen“ vermitteln soll.
Nach Angaben der ARD-ZDF-Onlinestudien nutzen in Deutschland 79,1 % der Menschen das Internet und der Trend ist weiter steigend. Diese hohe Nutzungsrate hat auch Einfluss auf die empirische Forschung. So ist der Anteil an Online-Umfragen in den letzten 10 Jahren kontinuierlich gestiegen und ist mittlerweile die am häufigsten genutzte Erhebungsmethode, vor Face-to-Face-, Telefon- oder Paper-Pencil-Befragungen.
Die Vorteile einer Online-Umfrage liegen neben der großen Reichweite vor allem in der hohen Ökonomie, der relativ einfachen Erhebung großer Stichproben in relativ kurzer Zeit sowie der hohen Akzeptanz dieser Methodik bei den Befragten, die diese Form als anonymisierter empfinden, sich weniger der sozialen Erwünschtheit anpassen und ehrlicher antworten als in Offline-Umfragen. Insgesamt wird mit der internetbasierten Befragungsmethode oftmals eine bessere Datenqualität erzielt.
Daher ist es zu einer Notwendigkeit geworden, sowohl bei empirischen Forschungen im Rahmen von Umfragen für die Abschlussarbeiten von Studierenden als auch im wissenschaftlichen empirisch-forschenden Berufsleben Online-Umfragen selbstständig durchführen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Zielsetzung
- 1.2 4CID-Modell
- 1.3 Szenario
- 1.4 Überblick
- 2 Theoretischer Exkurs
- 2.1 Pfadabhängigkeit
- 2.2 Unterschied zwischen Didaktik und Instruktionsdesign
- 2.3 Bezugstheorie des 4CID-Modells
- 3 Hierarchische Kompetenzanalyse
- 3.1 Hierarchiefunktion
- 3.2 Hierarchieerstellung
- 3.3 (Non-)Rekurrente Fertigkeiten
- 4 Bildung von Aufgabenklassen
- 4.1 Funktion
- 4.2 Vereinfachende Annahmen und Aufgabenklassen
- 5 Entwicklung von Lernaufgaben
- 5.1 Lernaufgaben
- 5.2 Variabilität
- 5.3 Mediale Umsetzung
- 6 Prozedurale und unterstützende Informationen
- 6.1 Unterstützende Information
- 6.2 Prozedurale Information
- 7 Part-task practice
- 8 Didaktische Szenarien
- 8.1 Fallmethode und Famulator
- 8.2 Fidelity
- 9 Fazit
- 9.1 Verortung im ADDIE-Phasenmodell
- 9.2 Stärken-Schwächen-Abschätzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, einen Schulungsentwurf für die Durchführung von Online-Umfragen nach dem Vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modell (4C/ID) zu entwickeln. Der Entwurf soll Bachelor-Kandidaten die notwendigen Kompetenzen vermitteln. Die Arbeit untersucht die Anwendbarkeit des 4C/ID-Modells im Kontext der empirischen Sozialforschung und beleuchtet die Vorteile von Online-Umfragen gegenüber anderen Methoden.
- Anwendbarkeit des 4C/ID-Modells auf die Kompetenz "Online-Umfrage durchführen"
- Vorteile von Online-Umfragen in der empirischen Forschung
- Entwicklung von authentischen Lernaufgaben im Rahmen des 4C/ID-Modells
- Gestaltung von unterstützende und prozedurale Informationen
- Integration von Part-task Practice für die Automatisierung von Routineabläufen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und begründet die Relevanz von Online-Umfragen in der heutigen Zeit aufgrund der hohen Internetnutzungsrate. Es definiert die Zielsetzung der Arbeit, nämlich die Entwicklung eines Schulungsentwurfs nach dem 4C/ID-Modell, und stellt das 4C/ID-Modell selbst vor. Das Kapitel beschreibt zudem das Szenario der geplanten Schulung für Bachelor-Kandidaten und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
2 Theoretischer Exkurs: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Hintergrund für die Arbeit. Es beleuchtet Konzepte der Pfadabhängigkeit, unterscheidet zwischen Didaktik und Instruktionsdesign und beschreibt detailliert die Bezugstheorie des 4C/ID-Modells als Grundlage für den Schulungsentwurf. Die Diskussion der verschiedenen Konzepte dient der Begründung der gewählten Methodik.
3 Hierarchische Kompetenzanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die Erstellung einer hierarchischen Kompetenzanalyse der komplexen Fähigkeit, eine Online-Umfrage durchzuführen. Es erläutert die Funktion dieser Hierarchie und die Unterscheidung zwischen rekurrenten und nicht-rekurrenten Fertigkeiten. Diese Analyse dient als Basis für die Entwicklung der Lernaufgaben im späteren Verlauf der Arbeit.
4 Bildung von Aufgabenklassen: Hier werden die Aufgabenklassen definiert, die für die Schulung relevant sind. Es wird die Funktion der Aufgabenklassen erläutert und vereinfachende Annahmen sowie die konkrete Gestaltung der Klassen beschrieben. Diese Aufgabenklassen bilden den Rahmen für die in Kapitel 5 entwickelten Lernaufgaben.
5 Entwicklung von Lernaufgaben: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung von Lernaufgaben, die auf den zuvor definierten Aufgabenklassen basieren. Es geht detailliert auf die Gestaltung der Lernaufgaben, die Variabilität und die mediale Umsetzung ein. Die Lernaufgaben sind das Herzstück des Schulungsentwurfs und zielen auf einen hohen Lerntransfer ab.
6 Prozedurale und unterstützende Informationen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Gestaltung von unterstützenden und prozeduralen Informationen, die den Lernenden zur Verfügung gestellt werden. Es erläutert den Unterschied zwischen beiden Informationsarten und ihre Bedeutung für das Lernen komplexer Fähigkeiten im Kontext von Online-Umfragen. Der Fokus liegt auf dem effizienten Lernen und dem Umgang mit komplexen Problemstellungen.
7 Part-task practice: In diesem Kapitel wird die Bedeutung des "Part-task practice" für die Automatisierung von Routineabläufen bei der Durchführung von Online-Umfragen beleuchtet. Es wird beschrieben, wie diese Praxis die Effizienz und die Genauigkeit der Durchführung von Online-Umfragen verbessert. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung und der Automatisierung wiederkehrender Prozesse.
8 Didaktische Szenarien: Dieses Kapitel beschreibt die didaktischen Szenarien der Schulung. Es werden die Fallmethode und der Einsatz von Famulatoren diskutiert und der Aspekt der Fidelity (Echtheit) im Bezug auf die Lernaufgaben behandelt. Die Kapitel verdeutlicht die praktische Umsetzung des Schulungsentwurfs.
Schlüsselwörter
Vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modell (4C/ID), Online-Umfrage, empirische Sozialforschung, Lerntransfer, authentische Lernaufgaben, unterstützende Informationen, prozedurale Informationen, Part-task practice, Kompetenzanalyse, Didaktik, Instruktionsdesign.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Schulungsentwurf für Online-Umfragen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit beschreibt den Entwurf einer Schulung zur Durchführung von Online-Umfragen, basierend auf dem Vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modell (4C/ID). Die Schulung richtet sich an Bachelor-Kandidaten und zielt darauf ab, ihnen die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln.
Welches Modell wird verwendet und warum?
Die Arbeit verwendet das 4C/ID-Modell als Grundlage für den Schulungsentwurf. Dieses Modell wird eingesetzt, um einen strukturierten und effektiven Schulungsansatz zu gewährleisten und die Lernenden optimal auf die Durchführung von Online-Umfragen vorzubereiten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie die Anwendbarkeit des 4C/ID-Modells, die Vorteile von Online-Umfragen gegenüber anderen Methoden, die Entwicklung authentischer Lernaufgaben, die Gestaltung unterstützender und prozeduraler Informationen sowie die Integration von Part-task Practice.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, theoretischer Exkurs (Pfadabhängigkeit, Didaktik vs. Instruktionsdesign, Bezugstheorie des 4C/ID-Modells), hierarchische Kompetenzanalyse, Bildung von Aufgabenklassen, Entwicklung von Lernaufgaben, prozedurale und unterstützende Informationen, Part-task practice, didaktische Szenarien (Fallmethode, Famulatoren, Fidelity) und Fazit (Verortung im ADDIE-Modell, Stärken-Schwächen-Abschätzung).
Was ist die Zielsetzung der hierarchischen Kompetenzanalyse?
Die hierarchische Kompetenzanalyse dient der systematischen Zerlegung der komplexen Fähigkeit, Online-Umfragen durchzuführen, in kleinere, übersichtlichere Teilschritte. Dies ermöglicht die gezielte Entwicklung von Lernaufgaben.
Welche Rolle spielen Aufgabenklassen und Lernaufgaben?
Die Bildung von Aufgabenklassen strukturiert den Lernprozess. Auf Basis dieser Klassen werden dann konkrete Lernaufgaben entwickelt, die einen hohen Lerntransfer und die Automatisierung von Routineabläufen (durch Part-task practice) ermöglichen sollen.
Was ist der Unterschied zwischen unterstützenden und prozeduralen Informationen?
Unterstützende Informationen liefern Kontext und Hintergrundwissen, während prozedurale Informationen konkrete Anweisungen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Durchführung von Aufgaben liefern. Beide sind wichtig für das erfolgreiche Lernen.
Welche didaktischen Szenarien werden eingesetzt?
Die Arbeit beschreibt den Einsatz der Fallmethode und von Famulatoren als didaktische Szenarien. Die Echtheit (Fidelity) der Lernaufgaben wird ebenfalls berücksichtigt.
Wie wird die Arbeit im ADDIE-Modell verortet?
Das Fazit der Arbeit verortet den entwickelten Schulungsentwurf im ADDIE-Phasenmodell (Analyse, Design, Development, Implementation, Evaluation) und bewertet dessen Stärken und Schwächen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: 4C/ID-Modell, Online-Umfrage, empirische Sozialforschung, Lerntransfer, authentische Lernaufgaben, unterstützende Informationen, prozedurale Informationen, Part-task practice, Kompetenzanalyse, Didaktik, Instruktionsdesign.
- Quote paper
- Steffanie Sippmann (Author), 2015, Das Vier-Komponenten-Instruktionsdesign-Modell (4C/ID) am Beispiel "Als Bachelorkandidat eine Online-Umfrage durchführen", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/341865