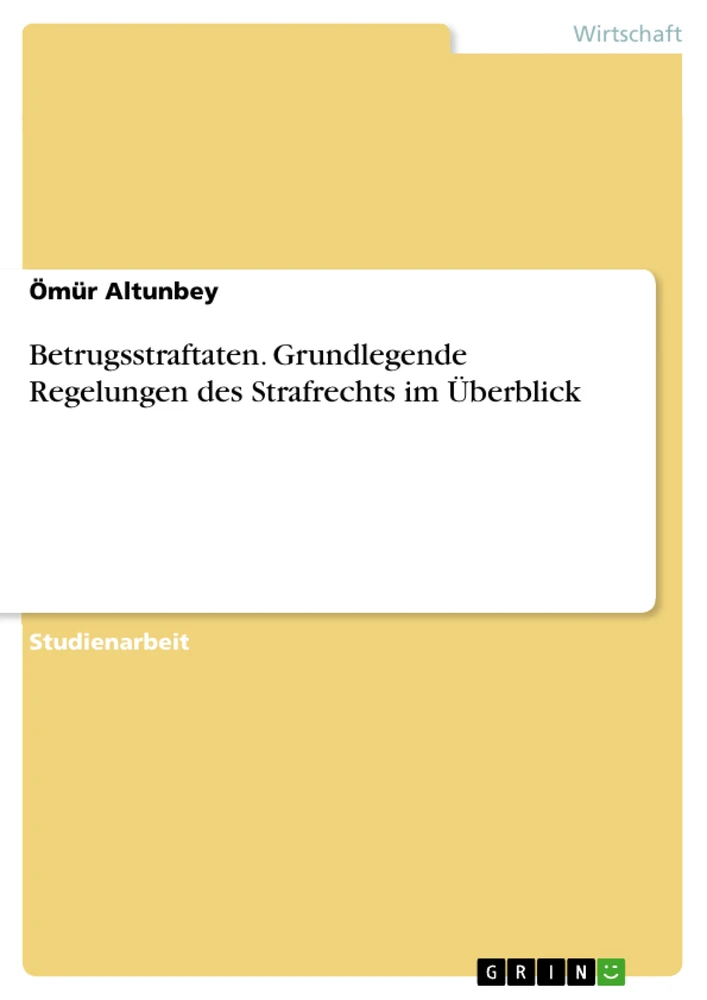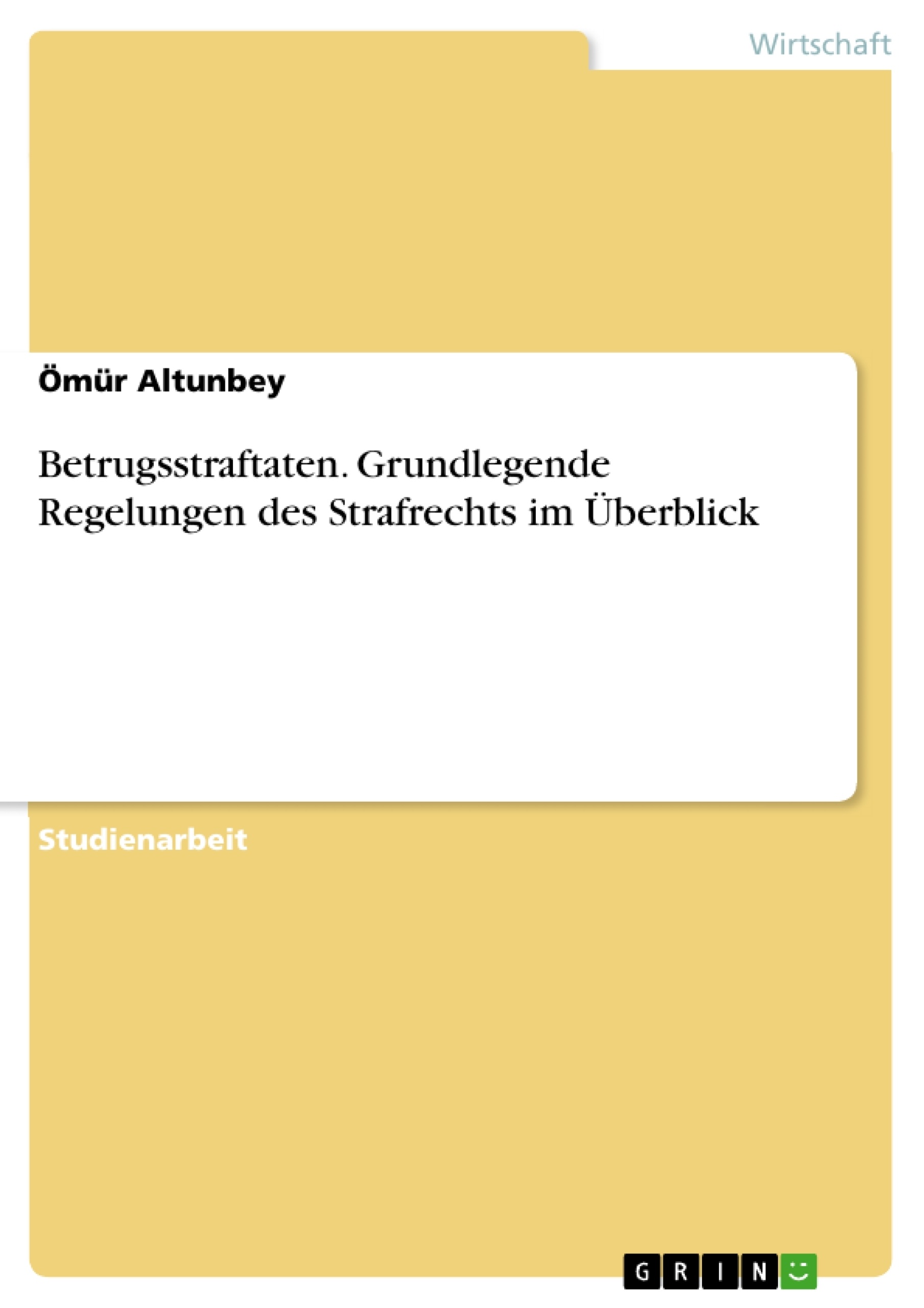Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die grundlegenden Regelungen von ausgewählten Betrugsstraftaten aufzuzeigen. Die Arbeit ist in sieben Teile untergliedert und behandelt die einzelnen Vorschriften in gesonderten Kapiteln.
Zu Beginn der Arbeit wird der Betrug gem. § 263 StGB aufgegriffen. Dabei werden die objektiven und subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen analysiert und die Rechtsfolgen erläutert. Anschließend folgt ein Fallbespiel, welches die Funktions-weise der Vorschrift verdeutlichen soll.
Im dritten und vierten Teil der Ausarbeitung werden weitere Betrugsstraftaten wie Computerbetrug und Subventionsbetrug hinsichtlich ihrer Tatbestände und Rechtsfolgen näher betrachtet.
Im letzten Teil erfolgt eine kompakte Darstellung der wichtigsten Aussagen des Kreditbetrugs, gefolgt von einem Beispiel. Abschließend endet die Arbeit mit einem Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 1.3 Themenabgrenzung
- 2 Betrug
- 2.1 Voraussetzungen
- 2.1.1 Objektiver Tatbestand
- 2.1.2 Subjektiver Tatbestand
- 2.2 Rechtsfolgen
- 2.3 Fallbeispiel
- 3 Computerbetrug
- 3.1 Objektiver und subjektiver Tatbestand
- 3.2 Rechtsfolgen
- 4 Subventionsbetrug
- 4.1 Objektiver und subjektiver Tatbestand
- 4.2 Rechtsfolgen
- 5 Kreditbetrug
- 5.1 Objektiver und subjektiver Tatbestand
- 5.2 Rechtsfolgen
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht verschiedene Arten von Betrugsdelikten im deutschen Strafrecht. Ziel ist es, die Voraussetzungen des objektiven und subjektiven Tatbestands sowie die jeweiligen Rechtsfolgen für Betrug, Computerbetrug, Subventionsbetrug und Kreditbetrug darzustellen. Die Arbeit soll ein umfassendes Verständnis dieser Straftaten ermöglichen.
- Voraussetzungen des Betrugs
- Unterschiede zwischen verschiedenen Betrugsformen
- Rechtsfolgen bei Betrugsdelikten
- Analyse von Fallbeispielen
- Relevanz der jeweiligen Tatbestände im modernen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Seminararbeit ein, beschreibt die Problemstellung und den Gang der Untersuchung. Sie grenzt den Themenbereich ab und skizziert den Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Klärung der zentralen Fragestellungen und der methodischen Vorgehensweise.
2 Betrug: Dieses Kapitel behandelt den allgemeinen Betrugstatbestand gemäß § 263 StGB. Es analysiert ausführlich die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale, wobei das Täuschungsmanöver, der Irrtum, die Vermögensverfügung und der Vermögensschaden im Detail erläutert werden. Der subjektive Tatbestand umfasst Vorsatz und den entsprechenden Bereicherungsvorsatz. Die Rechtsfolgen des Betrugs, inklusive Strafzumessung, werden ebenfalls abgehandelt, um ein vollständiges Bild des Delikts zu vermitteln. Ein Fallbeispiel verdeutlicht die Anwendung der Tatbestandsmerkmale in der Praxis.
3 Computerbetrug: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Computerbetrug, der sich durch die Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme auszeichnet. Es werden die spezifischen objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale im Vergleich zum allgemeinen Betrug erläutert, wobei der Schwerpunkt auf der Art und Weise der Täuschung und der Vermögensverfügung mittels EDV liegt. Die Rechtsfolgen werden im Kontext der Besonderheiten des Computerbetrugs diskutiert.
4 Subventionsbetrug: Das Kapitel konzentriert sich auf den Subventionsbetrug. Es analysiert den objektiven und subjektiven Tatbestand unter Berücksichtigung der Besonderheiten von Subventionen. Die gezielte Täuschung zur Erlangung unrechtmäßiger Subventionen wird im Detail beleuchtet. Dabei wird auch die Frage der Vermögensverfügung im Kontext der Subventionsgewährung untersucht. Die Rechtsfolgen des Subventionsbetrugs werden ebenfalls im Detail erläutert, unter Berücksichtigung der besonderen gesetzlichen Regelungen im Subventionsgesetz.
5 Kreditbetrug: Dieses Kapitel behandelt den Kreditbetrug. Der Fokus liegt auf der Analyse des objektiven und subjektiven Tatbestands. Es werden die spezifischen Merkmale der Täuschung im Zusammenhang mit Kreditanträgen und -gewährungen analysiert. Besondere Aufmerksamkeit wird der Frage gewidmet, wie die Vermögensverfügung des Kreditgebers durch die Täuschungshandlung herbeigeführt wird. Die Rechtsfolgen des Kreditbetrugs, sowohl strafrechtlicher als auch zivilrechtlicher Natur, werden umfassend diskutiert.
Schlüsselwörter
Betrug, Computerbetrug, Subventionsbetrug, Kreditbetrug, § 263 StGB, objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, Rechtsfolgen, Vermögensschaden, Täuschung, Irrtum, Vorsatz, Bereicherungsvorsatz, elektronische Datenverarbeitung, Subventionsgesetz, Strafgesetzbuch.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Verschiedene Arten von Betrugsdelikten im deutschen Strafrecht
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht verschiedene Arten von Betrugsdelikten im deutschen Strafrecht, darunter Betrug (§ 263 StGB), Computerbetrug, Subventionsbetrug und Kreditbetrug. Sie analysiert die objektiven und subjektiven Tatbestände sowie die jeweiligen Rechtsfolgen dieser Delikte.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Voraussetzungen des Betrugs, die Unterschiede zwischen verschiedenen Betrugsformen, die Rechtsfolgen bei Betrugsdelikten, analysiert Fallbeispiele und untersucht die Relevanz der jeweiligen Tatbestände im modernen Kontext. Es werden sowohl der allgemeine Betrugstatbestand als auch die spezifischen Merkmale der einzelnen Betrugsformen detailliert untersucht.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu Betrug, Computerbetrug, Subventionsbetrug und Kreditbetrug sowie ein Fazit. Jedes Kapitel analysiert den objektiven und subjektiven Tatbestand des jeweiligen Delikts und erläutert die entsprechenden Rechtsfolgen. Die Einleitung beschreibt die Problemstellung, den Gang der Untersuchung und die Themenabgrenzung. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen strukturierten Überblick.
Was wird im Kapitel "Betrug" behandelt?
Das Kapitel "Betrug" analysiert den allgemeinen Betrugstatbestand gemäß § 263 StGB. Es untersucht die objektiven Tatbestandsmerkmale (Täuschung, Irrtum, Vermögensverfügung, Vermögensschaden) und die subjektiven Tatbestandsmerkmale (Vorsatz, Bereicherungsvorsatz) im Detail. Die Rechtsfolgen des Betrugs und ein Fallbeispiel zur Veranschaulichung sind ebenfalls enthalten.
Welche Besonderheiten werden im Kapitel "Computerbetrug" betrachtet?
Das Kapitel "Computerbetrug" konzentriert sich auf die Nutzung elektronischer Datenverarbeitungssysteme bei der Begehung des Betrugsdelikts. Es werden die spezifischen objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale im Vergleich zum allgemeinen Betrug erläutert, insbesondere die Art und Weise der Täuschung und der Vermögensverfügung mittels EDV. Die Rechtsfolgen im Kontext der Besonderheiten des Computerbetrugs werden diskutiert.
Was sind die Schwerpunkte des Kapitels "Subventionsbetrug"?
Das Kapitel "Subventionsbetrug" analysiert den objektiven und subjektiven Tatbestand unter Berücksichtigung der Besonderheiten von Subventionen. Die gezielte Täuschung zur Erlangung unrechtmäßiger Subventionen und die Frage der Vermögensverfügung im Kontext der Subventionsgewährung werden detailliert untersucht. Die Rechtsfolgen des Subventionsbetrugs unter Berücksichtigung des Subventionsgesetzes werden erläutert.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Kreditbetrug"?
Das Kapitel "Kreditbetrug" analysiert den objektiven und subjektiven Tatbestand des Kreditbetrugs. Es werden die spezifischen Merkmale der Täuschung im Zusammenhang mit Kreditanträgen und -gewährungen, insbesondere die Herbeiführung der Vermögensverfügung des Kreditgebers, untersucht. Die Rechtsfolgen, sowohl strafrechtlicher als auch zivilrechtlicher Natur, werden umfassend diskutiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Betrug, Computerbetrug, Subventionsbetrug, Kreditbetrug, § 263 StGB, objektiver Tatbestand, subjektiver Tatbestand, Rechtsfolgen, Vermögensschaden, Täuschung, Irrtum, Vorsatz, Bereicherungsvorsatz, elektronische Datenverarbeitung, Subventionsgesetz, Strafgesetzbuch.
Wo finde ich ein Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis befindet sich zu Beginn der Seminararbeit und bietet einen detaillierten Überblick über die Kapitel und Unterkapitel.
- Arbeit zitieren
- Ömür Altunbey (Autor:in), 2016, Betrugsstraftaten. Grundlegende Regelungen des Strafrechts im Überblick, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/339787