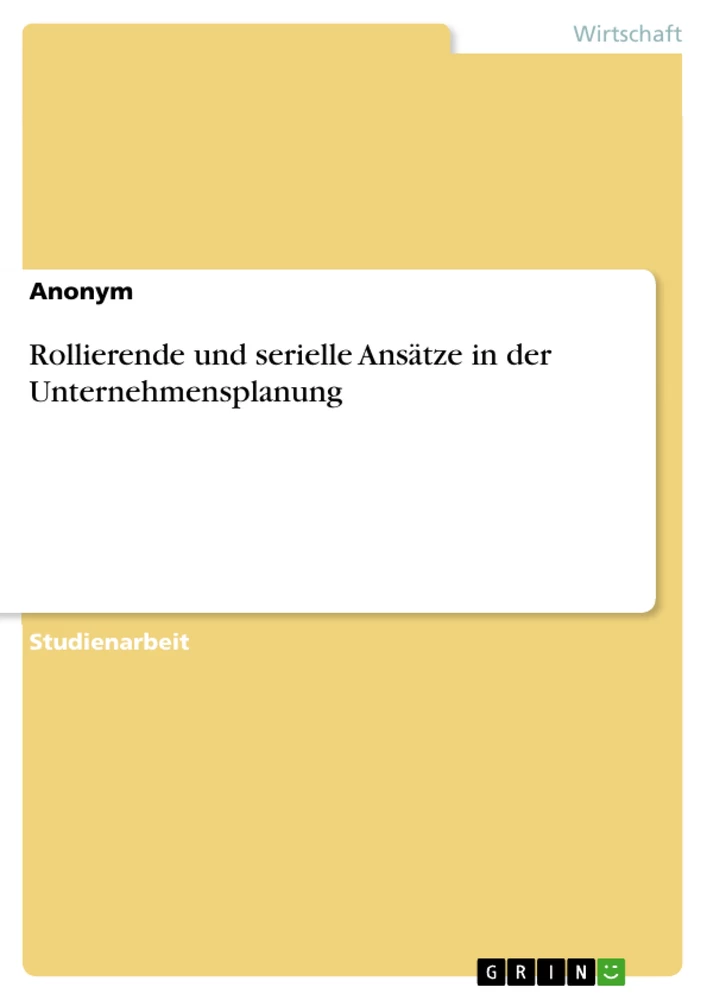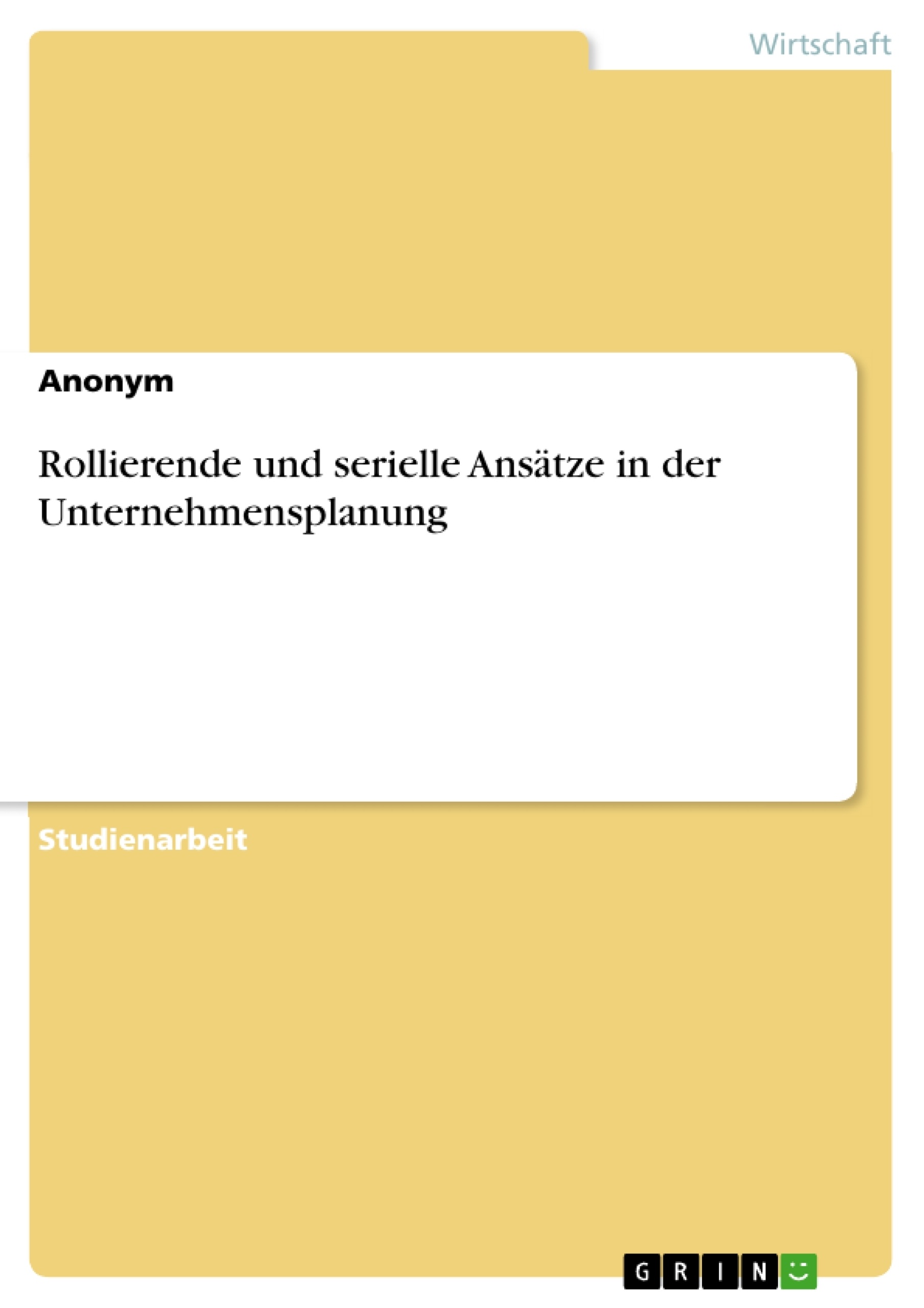Befindet man sich als Unternehmen in einer Planungssituation, dann muss man zuerst die verfolgten Ziele definieren und sich danach überlegen, welche Faktoren Einfluss darauf haben diese Ziele zu erreichen.
Hierbei ist es essentiell wichtig arbeitsteilige Aktivitäten zu koordinieren, die auf ein gemeinsames übergeordnetes Ziel ausgerichtet werden sollen. Durch eine Vielzahl an Überschneidungen von Entscheidungsfeldern, aber auch durch sequentielle Verknüpfung der Realisationsprozesse, ist ein erhöhter Bedarf an Koordination gefragt.
Bei der Koordination von Plänen muss man personelle, sachliche und zeitliche Aspekte bei verschiedenen Entscheidungsabhängigkeiten berücksichtigen. Koordinationsprobleme beruhen darauf, dass die Planung aus einzelnen Prozessen besteht, wobei diese wiederum zu verschiedenen Zeiten und von verschiedenen Personen wahrgenommen werden.
Zu zeitlichen Koordinationsproblemen kommt es aufgrund unterschiedlicher Planungszyklen, Rangordnungen und Plansequenzen. Der Planungszyklus kann dabei einen oder mehreren Planungsläufen angehören und ist der Zeitraum zwischen den jeweiligen Verabschiedungspunkten von zwei Plänen. Zu einem Problem bei der Rangordnung kommt es deswegen, da Pläne gleichen oder unterschiedlichen Ranges miteinander koordiniert werden sollen, wobei beim ersteren der Zusammenhang zwischen sachlich-inhaltlich sehr eng ist und bei letzterem Rangunterschiede entweder zeitlicher oder inhaltlicher Natur sein können. Die Plansequenz schafft Probleme, da hierbei die zeitliche Anordnung der Anfangs- und Endpunkte der einzelnen Pläne unterschiedlich oder gleich sein können.
Bei der zeitlichen Strukturierung lässt sich der Planungshorizont in einem Unternehmen in drei Zeiträume untergliedern. Bis zu einem Jahr fällt unter die kurzfristige Planung, für diesen Zeitraum lassen sich die Entwicklungen und Ziele natürlich ziemlich sicher definieren. Bei einem Zeitraum von einem bis vier Jahre erstellt man eine mittelfristige Planung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Verfahren der zeitlichen Koordination
- Flexible und starre Planungsansätze
- Serielle Planung
- Vorgehen
- Anwendung/Kritik
- Rollierende Planung
- Vorgehen
- Bedeutung/Anwendung
- Revolvierende Planung
- Vorgehen
- Anwendung
- Serielle Planung
- Resümee
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht verschiedene Ansätze der Unternehmensplanung, insbesondere die zeitliche Koordination von Planungsprozessen. Sie analysiert die Unterschiede und Vor- und Nachteile serieller, rollierender und revolvierender Planungsmethoden. Die Arbeit zielt darauf ab, ein Verständnis für die Auswahl geeigneter Planungsverfahren unter Berücksichtigung unterschiedlicher Unternehmenskontexte und -ziele zu vermitteln.
- Zeitliche Koordination von Planungsprozessen
- Vergleich serieller, rollierender und revolvierender Planung
- Geeignete Planungsverfahren für unterschiedliche Unternehmenskontexte
- Vor- und Nachteile verschiedener Planungsansätze
- Bedeutung des Planungshorizonts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Unternehmensplanung ein und betont die Bedeutung der zeitlichen Koordination arbeitsteiliger Aktivitäten, die auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet sind. Sie hebt die Herausforderungen hervor, die durch Überschneidungen von Entscheidungsfeldern und sequentielle Verknüpfungen von Realisationsprozessen entstehen. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit einer effektiven Koordination personeller, sachlicher und zeitlicher Aspekte in Abhängigkeit verschiedener Entscheidungsfaktoren. Die Einleitung legt den Grundstein für die anschließende detaillierte Betrachtung verschiedener Koordinationsverfahren und Planungsansätze.
Verfahren der zeitlichen Koordination: Dieses Kapitel befasst sich mit den grundlegenden Prinzipien der zeitlichen Koordination von Plänen. Es analysiert die Herausforderungen, die aus unterschiedlichen Planungszyklen, Rangordnungen und Plansequenzen resultieren. Der Text erläutert, wie Planungszyklen die zeitliche Abstimmung beeinflussen und wie Pläne unterschiedlichen Ranges koordiniert werden müssen. Die verschiedenen Arten von Plansequenzen und deren Auswirkungen auf die Koordination werden detailliert untersucht, um ein umfassendes Verständnis für die Komplexität der zeitlichen Planung zu schaffen. Schließlich werden die drei Prinzipien der zeitlichen Abstimmung - Reihung, Staffelung und Schachtelung - vorgestellt und anhand einer Abbildung veranschaulicht.
Flexible und starre Planungsansätze: Dieses Kapitel vergleicht verschiedene Planungsansätze, darunter serielle, rollierende und revolvierende Planung. Es beschreibt detailliert die Vorgehensweisen und Anwendungsgebiete jedes Ansatzes, analysiert deren jeweilige Stärken und Schwächen und beleuchtet kritische Aspekte. Die Diskussion umfasst die Bedeutung des Planungshorizonts und wie die verschiedenen Ansätze mit unterschiedlichen Planungszeiträumen umgehen. Der Vergleich der Ansätze ermöglicht es, die Vor- und Nachteile der Flexibilität und Starrheit in der Unternehmensplanung abzuwägen und die optimale Strategie für spezifische Unternehmenssituationen zu identifizieren.
Schlüsselwörter
Unternehmensplanung, zeitliche Koordination, serielle Planung, rollierende Planung, revolvierende Planung, Planungshorizont, Planungszyklen, Planungsverfahren, Koordinationsprobleme, flexible und starre Planungsansätze.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Zeitliche Koordination in der Unternehmensplanung
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit verschiedenen Ansätzen der Unternehmensplanung, insbesondere der zeitlichen Koordination von Planungsprozessen. Sie analysiert und vergleicht serielle, rollierende und revolvierende Planungsmethoden und untersucht deren Vor- und Nachteile in unterschiedlichen Unternehmenskontexten.
Welche Planungsmethoden werden behandelt?
Die Arbeit behandelt detailliert drei Planungsmethoden: serielle, rollierende und revolvierende Planung. Für jede Methode wird das Vorgehen, die Anwendung und die jeweiligen Vor- und Nachteile erläutert.
Was sind die Ziele der Seminararbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die Auswahl geeigneter Planungsverfahren zu vermitteln. Sie soll die Unterschiede zwischen den verschiedenen Methoden aufzeigen und helfen, die optimale Strategie für spezifische Unternehmenssituationen zu identifizieren.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Zeitliche Koordination von Planungsprozessen, Vergleich serieller, rollierender und revolvierender Planung, geeignete Planungsverfahren für unterschiedliche Unternehmenskontexte, Vor- und Nachteile verschiedener Planungsansätze sowie die Bedeutung des Planungshorizonts.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu den Verfahren der zeitlichen Koordination, ein Kapitel zu flexiblen und starren Planungsansätzen (mit Unterkapiteln zu serieller, rollierender und revolvierender Planung), ein Resümee und ein Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Beschreibung und Analyse der jeweiligen Themen.
Was sind die wichtigsten Schlüsselbegriffe?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind: Unternehmensplanung, zeitliche Koordination, serielle Planung, rollierende Planung, revolvierende Planung, Planungshorizont, Planungszyklen, Planungsverfahren, Koordinationsprobleme, flexible und starre Planungsansätze.
Wie werden die verschiedenen Planungsmethoden verglichen?
Die Seminararbeit vergleicht die seriellen, rollierenden und revolvierenden Planungsmethoden anhand ihrer Vorgehensweisen, Anwendungsgebiete, Stärken, Schwächen und der Bedeutung des Planungshorizonts. Der Vergleich ermöglicht es, die Vor- und Nachteile von Flexibilität und Starrheit in der Unternehmensplanung abzuwägen.
Was ist die Bedeutung des Planungshorizonts?
Der Planungshorizont spielt eine zentrale Rolle bei der Auswahl des geeigneten Planungsansatzes. Die Arbeit untersucht, wie die verschiedenen Ansätze mit unterschiedlichen Planungszeiträumen umgehen und wie der Planungshorizont die Effektivität der jeweiligen Methode beeinflusst.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Seminararbeit ist relevant für Studierende, die sich mit Themen der Unternehmensplanung und Projektmanagement befassen, sowie für alle, die ein tieferes Verständnis der zeitlichen Koordination in Planungsprozessen entwickeln möchten.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden sich im vollständigen Text der Seminararbeit (einschließlich Literaturverzeichnis).
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Rollierende und serielle Ansätze in der Unternehmensplanung, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/339780