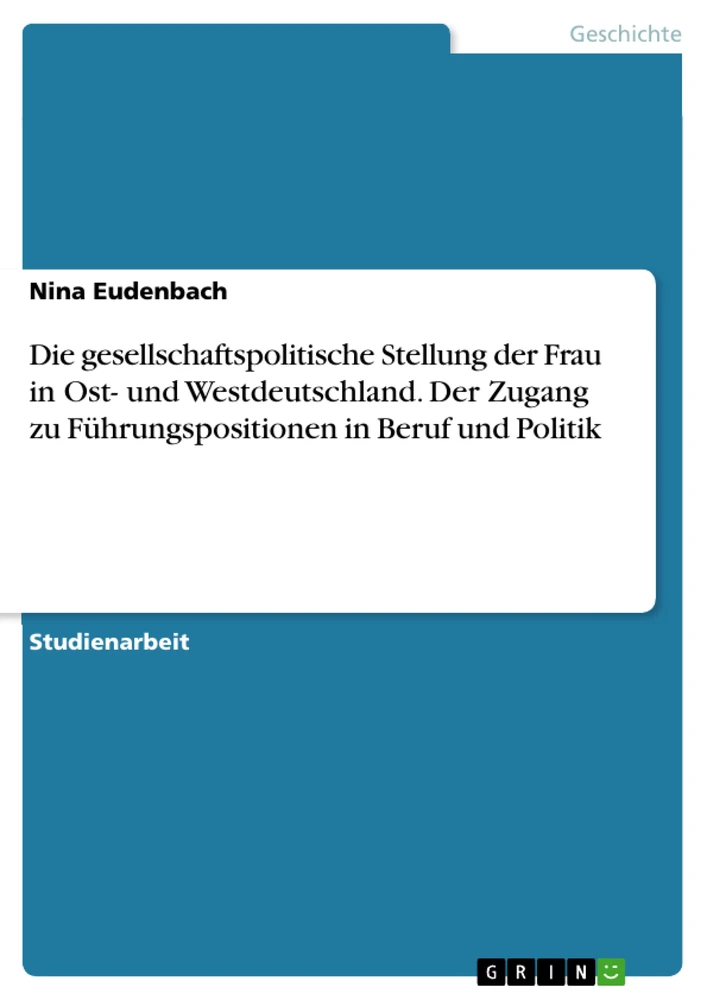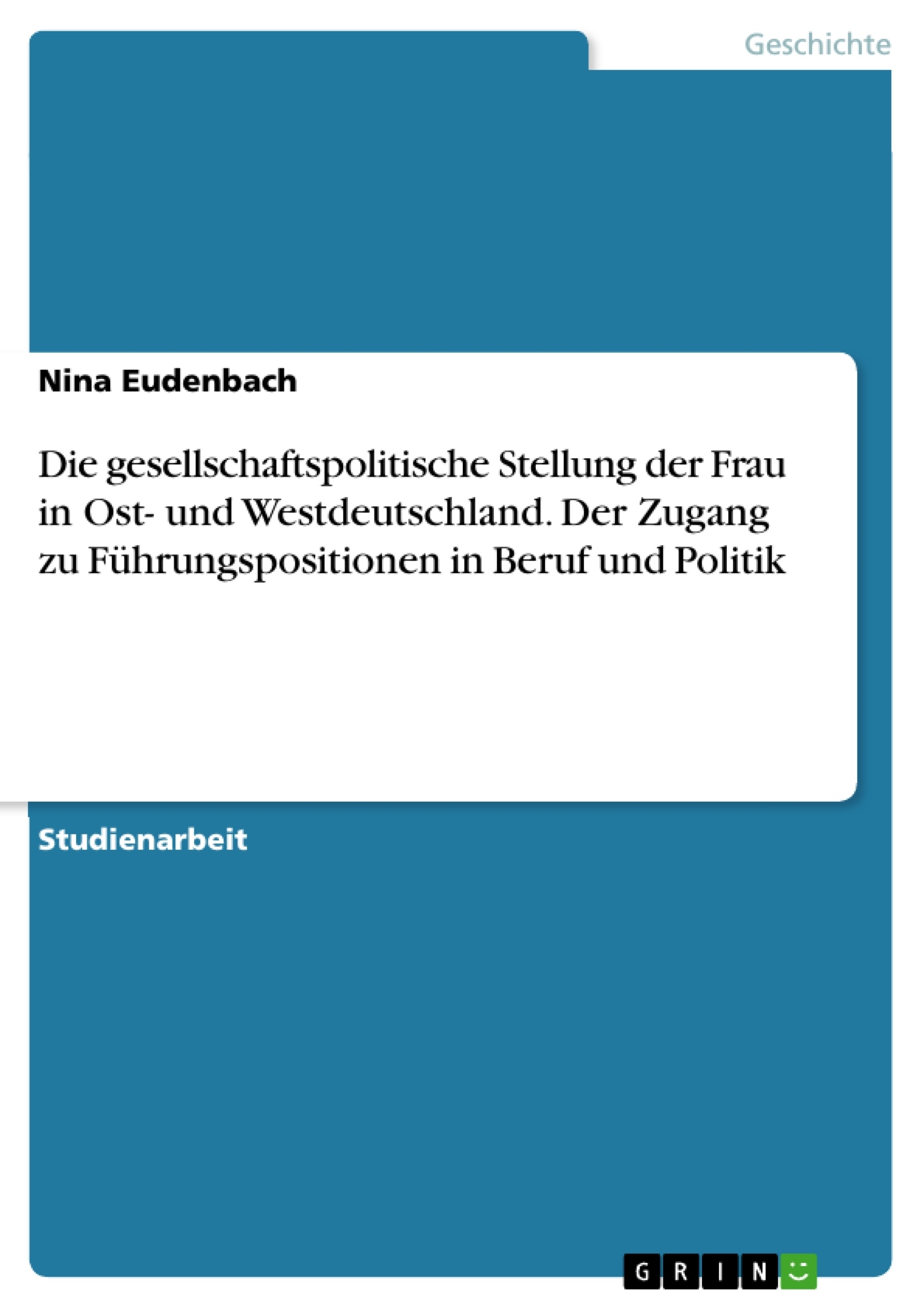In den 50er und 60er Jahren war das klassische Bild der Frau in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) das der Hausfrau und Mutter. Wenn eine Frau doch arbeitete, dann tat sie dies meistens nur, weil sie noch nicht verheiratet war oder weil sie niemanden zum Heiraten fand. Das Arbeitsleben einer Frau hatte daher nur kurzlebigen Charakter. In der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) war genau das Gegenteil Realität. Dass eine Frau nicht erwerbstätig war, war eher die Seltenheit und von der Gesellschaft verpönt. Beruf und Familie sollten und mussten sie unter einen Hut bekommen. In beiden Ländern wurden diese Gegebenheiten von Seiten der Politik und der restlichen Gesellschaft bestärkt und vorangetrieben.
Die jeweils andere deutsche Variante wurde von beiden Seiten stets kritisiert und in Verruf gebracht. So veröffentlichte das Bundesministerium für Gesamtdeutsche Fragen 1950 eine Sammlung von Artikeln mit der Überschrift „Arbeiten, arbeiten, arbeiten!“. In den Artikeln wurde der „Erwerbszwang“ der ostdeutschen Frauen scharf kritisiert und ihm die paradiesische Lage der von materiell entlohnter Arbeit „freigestellten“ bundesrepublikanischen Frauen entgegen gestellt. Gleichzeitig wurde auf ostdeutscher Seite versucht unter Heranziehung der sozialistischen Klassiker, vor allem Clara Zetkin, der Bevölkerung weis zu machen, dass die relativ hohe Erwerbstätigenquote von Frauen ein Beweis für eine gesamtgesellschaftlich realisierte Gleichberechtigung der Frau sei.
In folgender Arbeit wird vergleichend die Frage untersucht inwiefern sich die Unterschiede in der sozialpolitischen Stellung der Frau in den verschiedenen Systemen der DDR und der BRD auf ihren Zugang zu Führungspositionen in Beruf und Politik auswirkten. Der Fokus liegt hierbei auf den Unterschieden, die die unterschiedlichen Systeme in der Gesellschaft verursachen. Es wird sich nicht im Besonderen mit der Frauenbewegung oder Emanzipation der Frau beschäftigt.
Dabei wird zunächst die notwendige Frauenarbeit in der Nachkriegszeit dargestellt. Es wird auf die Frauenpolitik und das gesellschaftliche Leitbild der Frau in beiden deutschen Staaten eingegangen um danach die Funktion von Frauen in Politik und Verbänden zu untersuchen. Zum Ende wird die Erwerbsarbeit von Frauen in beiden deutschen Staaten beleuchtet. Es folgt das Fazit, in welchem alle Erkenntnisse zusammen getragen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nachkriegszeit
- Unmittelbare Nachkriegszeit
- Frauen in Männerberufen
- Gesellschaftspolitische Rolle der Frau
- Sozialistische Frauenpolitik
- Konservative Frauenpolitik
- Frauenleitbild der DDR
- Frauenleitbild der BRD
- Die Frau in der Politik
- Nützliche gesellschaftliche Arbeit in der DDR
- Die Frau in der Partei
- Weibliche politische Partizipation in der BRD
- West-deutsche Frauenverbände
- Frauenerwerbsarbeit
- DDR
- BRD
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert vergleichend die gesellschaftspolitische Stellung der Frau in der DDR und der BRD im Kontext der Nachkriegszeit. Der Fokus liegt dabei auf den Auswirkungen der unterschiedlichen politischen Systeme auf den Zugang von Frauen zu Führungspositionen im Beruf und in der Politik. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Unterschiede, die durch die jeweiligen Systeme in der Gesellschaft entstanden sind, und verzichtet auf eine detaillierte Betrachtung der Frauenbewegung oder der Emanzipation der Frau.
- Die Rolle der Frau in der unmittelbaren Nachkriegszeit
- Die sozialistische und konservative Frauenpolitik in Ost- und Westdeutschland
- Das Frauenleitbild in der DDR und in der BRD
- Die Funktion von Frauen in Politik und Verbänden in beiden deutschen Staaten
- Die Erwerbsarbeit von Frauen in der DDR und in der BRD
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Darstellung der unmittelbaren Nachkriegszeit und der Notwendigkeit von Frauenarbeit in beiden deutschen Staaten. Dabei wird die schwierige Situation der Frauen in der Nachkriegszeit, insbesondere ihre Rolle bei der Bewältigung des Mangels und der Aufrechterhaltung des Haushalts, hervorgehoben. Anschließend wird die Erwerbstätigkeit von Frauen im Kontext der wiederaufgebauten Industrie in beiden Staaten untersucht.
Die Arbeit beleuchtet die unterschiedlichen Frauenbilder und -politik in der DDR und der BRD. Es wird die sozialistische Frauenpolitik in der DDR, die die Gleichstellung von Frauen durch aktive Beteiligung am Arbeitsleben förderte, gegenübergestellt der konservativen Frauenpolitik in der BRD, die traditionellere Geschlechterrollen und eine dominante Rolle der Hausfrau und Mutter betonte. Die Arbeit betrachtet auch die Rolle der Frau in der Politik, einschließlich ihrer Teilnahme an politischen Partizipationsformen und der Aktivitäten von Frauenverbänden. Abschließend wird die Erwerbsarbeit von Frauen in beiden deutschen Staaten im Hinblick auf ihre unterschiedlichen Bedingungen und Möglichkeiten untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schwerpunkten Frauenpolitik, Gesellschaftspolitik, DDR, BRD, Nachkriegszeit, Frauenleitbild, Erwerbsarbeit, politische Partizipation, Frauenverbände, Führungspositionen, Gleichstellung.
- Arbeit zitieren
- Nina Eudenbach (Autor:in), 2015, Die gesellschaftspolitische Stellung der Frau in Ost- und Westdeutschland. Der Zugang zu Führungspositionen in Beruf und Politik, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/338975