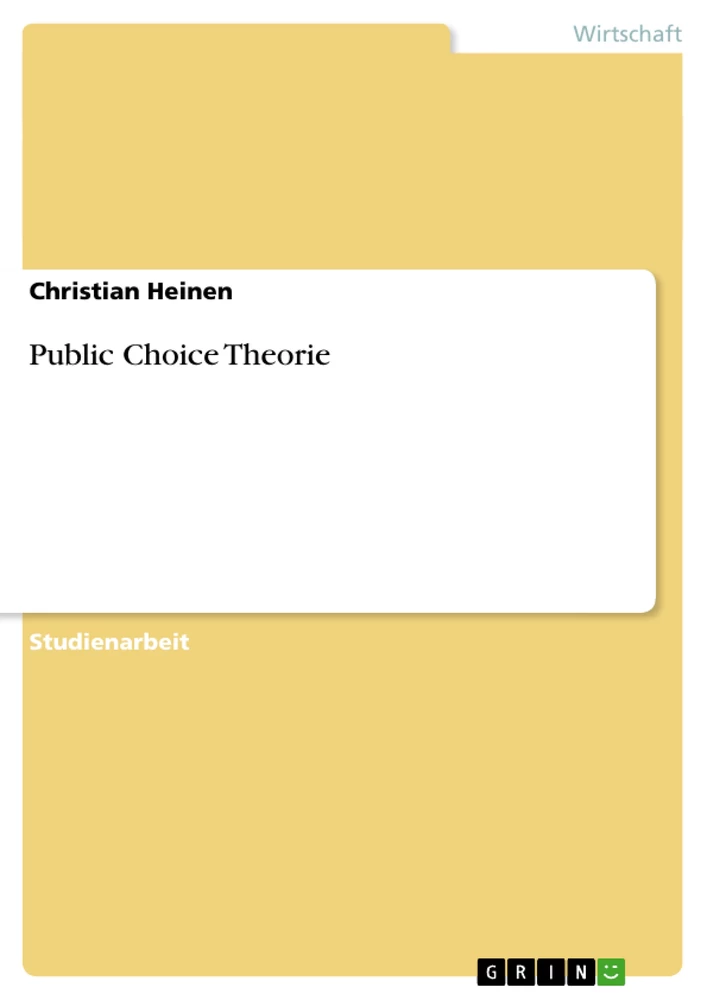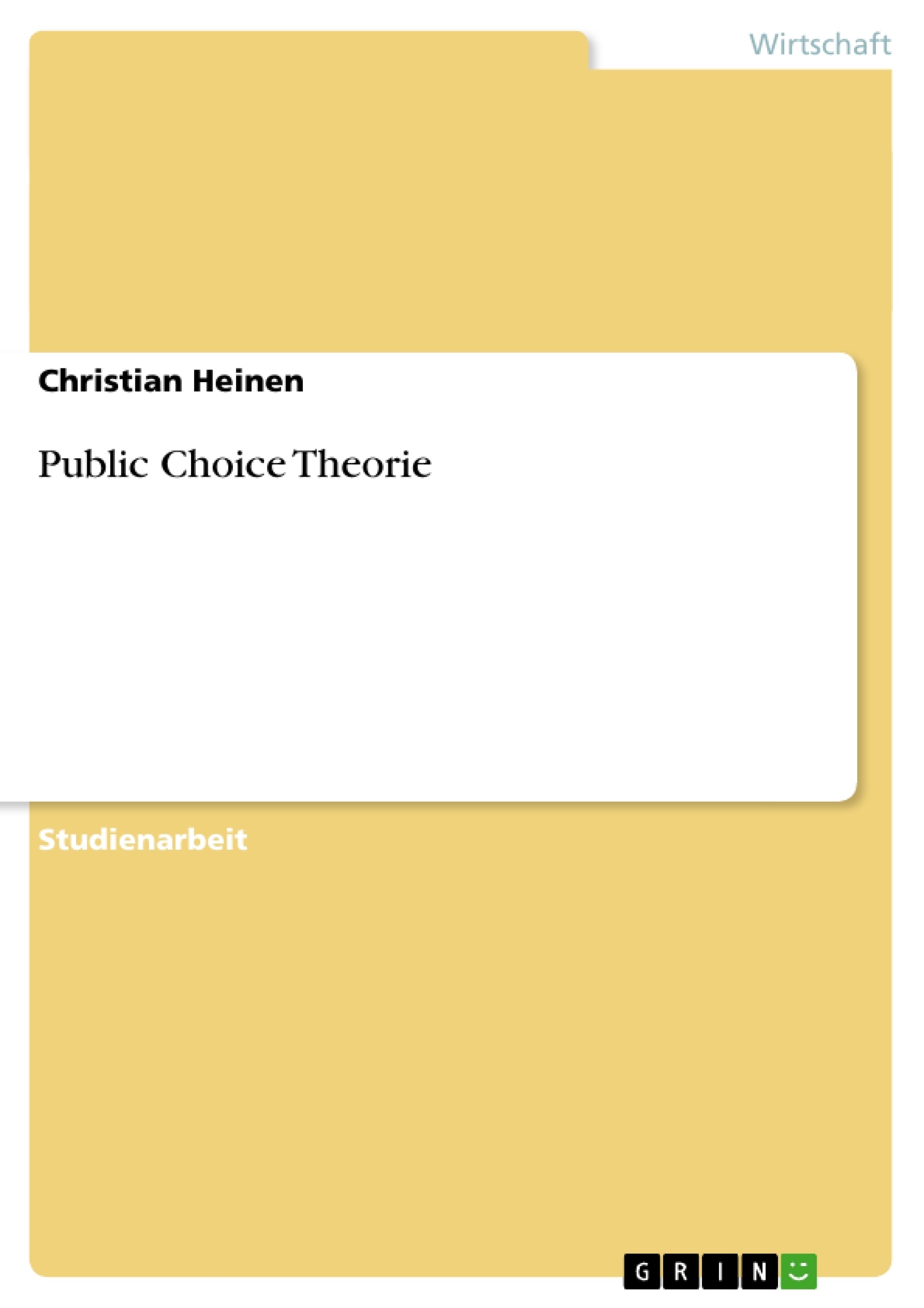Ökonomische Theorien der Politik sind Theorien, die das entscheidungslogische Instrumentarium der modernen Wirtschaftstheorie zur Erklärung politischer Strukturen und Prozesse sowie der wechselseitigen Abhängigkeit von Wirtschaft und Politik anwenden. Die Public Choice Theory (Neue politische Ökonomie) basiert auf dem Prinzip des methodologischen Individualismus, demzufolge Aussagen über soziale, ökonomische oder politische Strukturen und Prozesse aus Aussagen über individuelles Verhalten ableitbar sind (vgl. Esser 1984, S. 667ff.). Die grundlegenden Annahmen der ökonomischen Theorien der Politik sind deshalb, ebenso wie die der ökonomischen Theorie im allgemeinen, Annahmen über individuelles Verhalten. Zentrales Axiom ist das Rationalitätsprinzip, welches postuliert, dass Individuen in einer gegebenen Situation immer diejenige Verhaltensalternative wählen, von der sie den größten Nutzen erwarten, oder die bei nicht unterscheidbarem Nutzen mit den geringsten Kosten verbunden ist. Zusätzlich werden Annahmen über die Strukturen individueller Präferenzen postuliert, die davon ausgehen, dass Individuen in der Lage seien ihre Wünsche und Ansprüche konsistent zu ordnen und Verhaltensalternativen entsprechend dieser Präferenzordnung zu bewerten. Das Rationalitätsprinzip und die ergänzenden Annahmen über individuelle Präferenzstrukturen beschreiben eine einfache abstrakte Theorie individuellen Verhaltens. Diese Theorie wird im Rahmen einer Konzeption sozialen Tausches zur Erklärung sozialer Strukturen und Prozesse angewandt. Gemäß dieser Konzeption können soziale Beziehungen als ein Austausch von materiellen und immateriellen Gütern und Dienstleistungen interpretiert werden (Becker 1992, S. 5ff.).
Die ökonomische Analyse politischer Entscheidungen hat zwei gleichermaßen wichtige Zielsetzungen. Die normative Analyse der ökonomischen Theorie der Politik ist eng mit der Wohlfahrtstheorie verknüpft. Diese beschäftigt sich mit der Thematik, was für eine Gesellschaft insgesamt gut wäre. In vielen Bereichen der Ökonomik wird dazu eine „soziale Wohlfahrtsfunktion“ mit „gesellschaftlichen Indifferenzkurven“ verwendet (vgl. Frey 1995, S. 343ff.). Dies wirft das Problem auf, wie man derartige soziale Präferenzen aus den individuellen Präferenzfunktionen der Gesellschaftsmitglieder gewinnen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundansätze der ökonomischen Theorie der Politik
- Das Unmöglichkeitstheorem
- Logik des kollektiven Handelns
- Die budgetmaximierende Demokratie
- Wählerverhalten
- Das Modell des rationalen Wählers
- Das Medianwählermodell
- Einflussfaktoren für das Wählerverhalten
- Der staatliche Entscheidungsprozess
- Direkte Demokratie
- Die Konjunkturpolitik im Spannungsfeld der Demokratie
- Kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Public Choice Theorie, auch bekannt als Neue Politische Ökonomie. Sie wendet das Instrumentarium der modernen Wirtschaftstheorie auf die Analyse politischer Strukturen und Prozesse an, um die wechselseitige Abhängigkeit von Wirtschaft und Politik zu erklären. Der Fokus liegt dabei auf der positiven Analyse, d.h. der Erklärung beobachteter Phänomene in der realen Welt.
- Das Rationalitätsprinzip und seine Anwendung auf individuelles politisches Verhalten
- Die Aggregation individueller Präferenzen zu kollektiven Entscheidungen
- Die Logik des kollektiven Handelns und die Organisation von Interessen
- Das Wählerverhalten und die Einflussfaktoren auf die Wahlentscheidung
- Der staatliche Entscheidungsprozess in der direkten Demokratie und die Rolle der Konjunkturpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in die ökonomischen Theorien der Politik ein und stellt das Konzept der Public Choice Theorie vor. Sie erläutert die grundlegenden Annahmen der Theorie, insbesondere das Rationalitätsprinzip und die Konzeption sozialen Tausches. Darüber hinaus werden die beiden Zielsetzungen der ökonomischen Analyse politischer Entscheidungen, die normative und die positive Analyse, vorgestellt.
- Kapitel 2: Grundansätze der ökonomischen Theorie der Politik
Dieses Kapitel befasst sich mit den wichtigsten Grundansätzen der Public Choice Theorie. Es erläutert das Unmöglichkeitstheorem von K. Arrow und seine Bedeutung für die Aggregation individueller Präferenzen zu kollektiven Entscheidungen. Weiterhin wird die „Logik des kollektiven Handelns“ von M. Olson vorgestellt, die zeigt, wie gesellschaftliche Interessen ungleich organisiert sind und sich nicht immer wechselseitig kontrollieren.
- Kapitel 3: Wählerverhalten
Kapitel 3 analysiert das Wählerverhalten unter der Annahme des rationalen Wählers. Es erklärt, warum rationale Wähler trotz hoher Informationskosten und geringer Einflussnahme auf das Wahlergebnis wählen gehen.
- Kapitel 4: Der staatliche Entscheidungsprozess
Das Kapitel beleuchtet den staatlichen Entscheidungsprozess anhand des Beispiels der direkten Demokratie. Es zeigt, wie sich aus individuellen Präferenzen ein kollektiver Wille bildet und wie Regierungen den Konjunkturzyklus für politische Machterhaltung nutzen können.
Schlüsselwörter
Die Public Choice Theorie beschäftigt sich mit der Anwendung ökonomischer Theorien auf politische Prozesse und Strukturen. Zentrale Themen sind das Rationalitätsprinzip, die Aggregation individueller Präferenzen, die Logik des kollektiven Handelns, das Wählerverhalten und der staatliche Entscheidungsprozess.
- Quote paper
- Christian Heinen (Author), 2005, Public Choice Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/33659