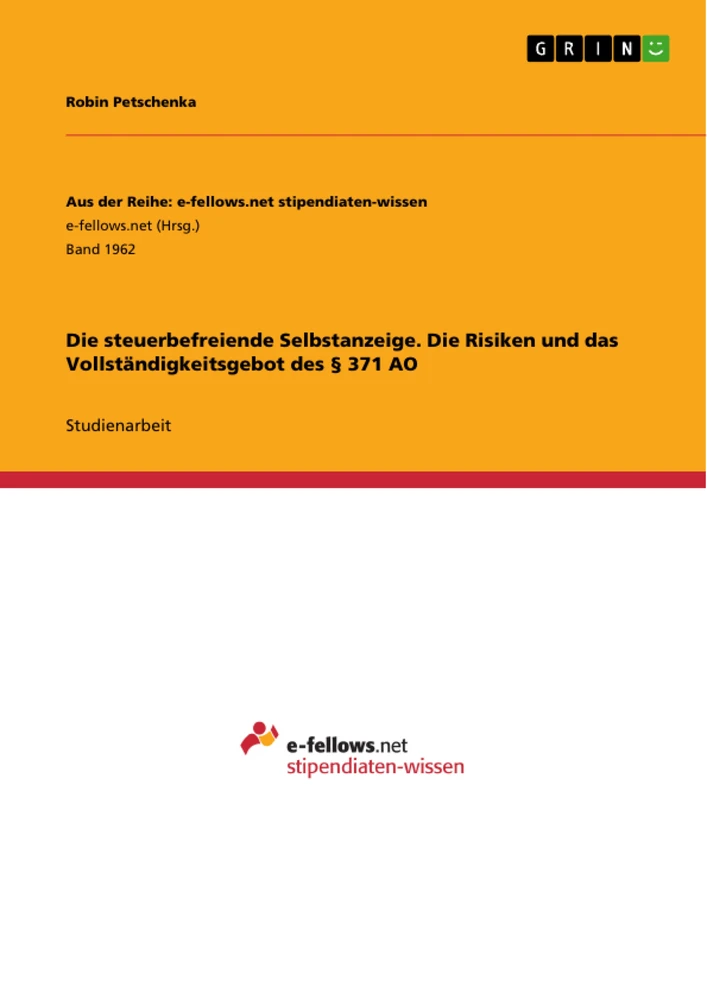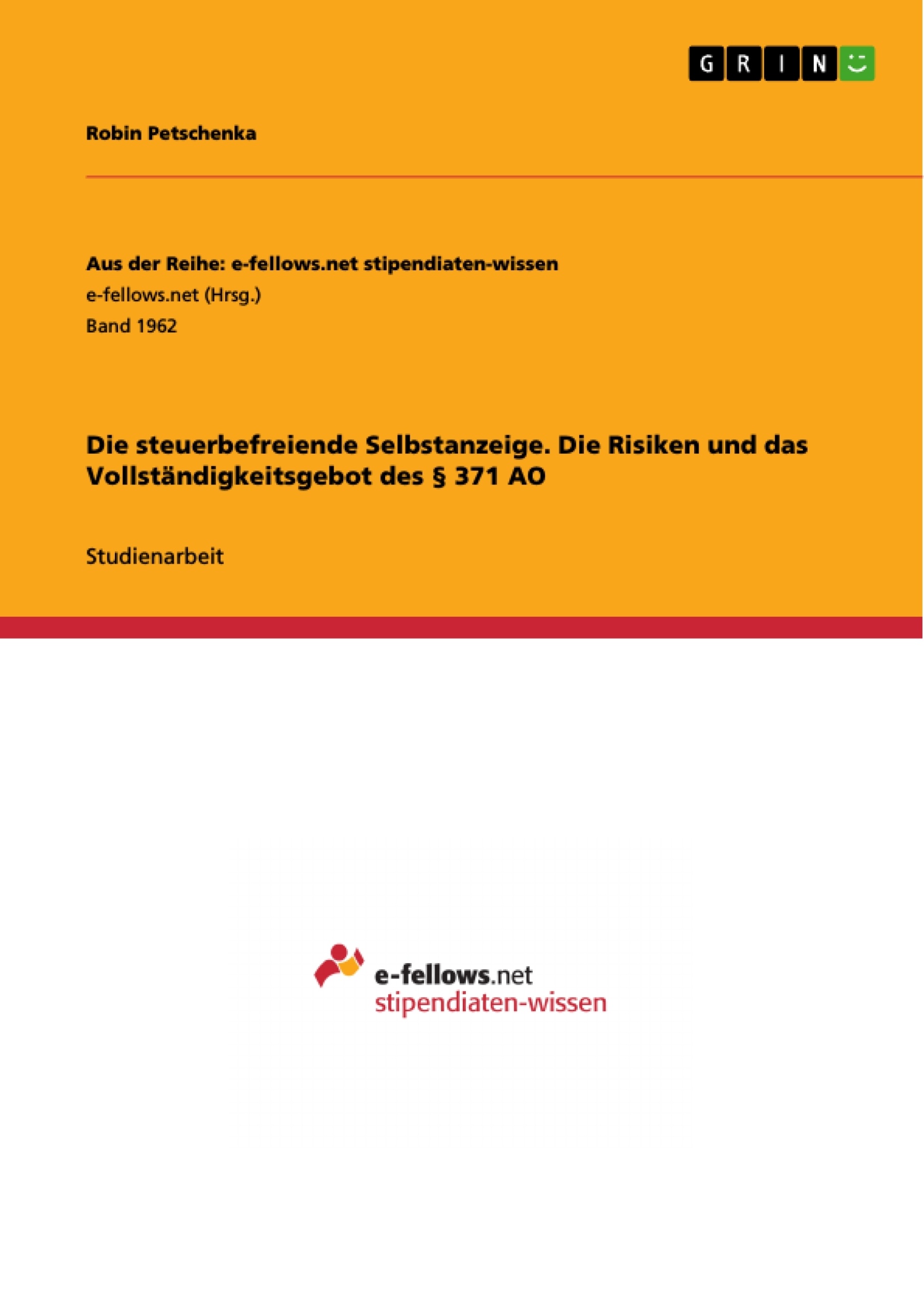Die Selbstanzeigetatbestände wurden durch das Änderungsgesetz vom 22.12.2014 erneut modifiziert. Die Anforderungen wurden verschärft, sodass sich nun zahllose neue Risiken für den Steuersünder ergeben. Die beiden Erklärungstatbestände für die Nacherklärung bei Steuerstraftaten sind § 371, 398a AO. Unabhängig davon, ob der Selbstanzeigende Straffreiheit gemäß § 371 AO oder Absehen von Verfolgung gemäß § 398a AO erlangen will, muss es sich um eine wirksame Selbstanzeige im Sinne des §371 AO handeln.
Für die Wirksamkeit einer Selbstanzeige ist das Vollständigkeitsgebot maßgeblich und damit in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung. Aufgrund der immensen Wichtigkeit des Vollständigkeitsgebotes für die Wirksamkeit einer Selbstanzeige soll dieses Gebot in der vorliegenden Arbeit einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem zeitlichen Berichtigungszeitraum und einem Vergleich der verschiedenen Auslegungsmethoden des neu eingeführten zehnjährigen Zeitraums.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Sinn und Zweck der Selbstanzeige
- I. Fiskale Gründe
- II. Rückkehr zur Steuerehrlichkeit
- C. Rechtsfolge
- I. Strafrechtliche Folgen
- II. Wirtschaftliche Folgen
- D. Vollständigkeitsgebot
- I. zeitliche Vollständigkeit
- 1. Strafrechtliche Verfolgungsverjährung
- a. Beginn
- b. Dauer
- aa. Verjährungsdauer in Fällen des § 370 Abs. 1 AO
- bb. Verjährungsdauer in Fällen des § 370 Abs. 3 AO
- c. Ruhen und Unterbrechung
- d. Zwischenergebnis zur strafrechtlichen Verfolgungsverjährung
- 2. fester Berichtigungszeitraum
- a. Dauer
- aa. erste Ansicht
- bb. andere Ansicht
- cc. Ergebnis zur Dauer des gesetzlichen Berichtigungsverbunds
- b. Inhalt des gesetzlichen Berichtigunsverbunds
- aa. Erfolgseintritt
- bb. Tathandlung
- cc. Veranlagungszeitraum
- dd. Stellungnahme
- c. Zwischenergebnis zum festen Berichtigungszeitraum
- a. Dauer
- 3. Zwischenergebnis zur zeitlichen Vollständigkeit
- 1. Strafrechtliche Verfolgungsverjährung
- II. sachliche Vollständigkeit
- 1. Erhebungsartenproblematik
- a. Person des Steuerschuldners
- b. Extensivere Auslegung
- c. Stellungnahme
- 2. Zwischenergebnis zur sachlichen Vollständigkeit
- 1. Erhebungsartenproblematik
- III. Ausnahmen des Vollständigkeitsgebots
- 1. Umsatzsteuer- und Lohnsteuervoranmeldungen
- 2. Außenprüfungen
- 3. Unterschiede des materiellen und steuerrechtlichen Tatbegriffs
- IV. Zusammenfassung
- I. zeitliche Vollständigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Risiken der Selbstanzeige im deutschen Steuerstrafrecht nach der jüngsten Reform. Sie analysiert das Vollständigkeitsgebot des § 371 AO und dessen Auswirkungen auf die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige.
- Sinn und Zweck der Selbstanzeige
- Rechtsfolgen einer Selbstanzeige (strafrechtlich und wirtschaftlich)
- Das Vollständigkeitsgebot des § 371 AO (zeitliche und sachliche Aspekte)
- Ausnahmen vom Vollständigkeitsgebot
- Analyse der Rechtsprechung und Literatur zum Thema
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel dient der Einführung in die Thematik der Selbstanzeige im Steuerstrafrecht und der Bedeutung des Vollständigkeitsgebots. Es skizziert die zentralen Fragestellungen und den Aufbau der Arbeit.
B. Sinn und Zweck der Selbstanzeige: Dieses Kapitel beleuchtet die fiskalen Gründe und das Motiv der Rückkehr zur Steuerehrlichkeit, die hinter einer Selbstanzeige stehen. Es analysiert die Intention des Steuerpflichtigen und die Ziele des Gesetzgebers hinsichtlich der strafbefreienden Wirkung der Selbstanzeige.
C. Rechtsfolge: Hier werden die strafrechtlichen und wirtschaftlichen Folgen einer Selbstanzeige umfassend dargestellt. Es wird untersucht, welche Sanktionen im Falle einer unvollständigen Selbstanzeige drohen und wie sich diese auf den Steuerpflichtigen auswirken.
D. Vollständigkeitsgebot: Der Kern der Arbeit liegt in der detaillierten Analyse des Vollständigkeitsgebots nach § 371 AO. Es werden sowohl die zeitliche als auch die sachliche Vollständigkeit beleuchtet, einschließlich der damit verbundenen Probleme und Ausnahmen. Die Diskussion der verschiedenen Rechtsauffassungen und die Darstellung konkreter Fallbeispiele bilden einen wichtigen Bestandteil dieses Kapitels. Die verschiedenen Aspekte der zeitlichen Vollständigkeit, wie die Verjährungsfristen und der feste Berichtigungszeitraum, werden sorgfältig untersucht und miteinander verknüpft, um ein ganzheitliches Verständnis zu ermöglichen. Die sachliche Vollständigkeit wird unter Berücksichtigung der Erhebungsartenproblematik und der unterschiedlichen Auslegungsmöglichkeiten analysiert. Die Ausnahmen vom Vollständigkeitsgebot, wie etwa bei Umsatzsteuer- und Lohnsteuervoranmeldungen oder Außenprüfungen, werden im Kontext der Gesamtproblematik erläutert und deren Bedeutung für die Praxis herausgestellt.
Schlüsselwörter
Selbstanzeige, Steuerstrafrecht, Vollständigkeitsgebot, § 371 AO, Strafbefreiung, zeitliche Vollständigkeit, sachliche Vollständigkeit, Verjährung, Berichtigungszeitraum, Rechtsfolgen, Fiskalität, Steuerehrlichkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Selbstanzeige im deutschen Steuerstrafrecht
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Selbstanzeige im deutschen Steuerstrafrecht, insbesondere im Hinblick auf das Vollständigkeitsgebot gemäß § 371 AO. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse der Rechtsfolgen, der Bedeutung des Vollständigkeitsgebots (zeitlich und sachlich) und der Ausnahmen hiervon.
Was sind die Zielsetzung und die Themenschwerpunkte des Dokuments?
Die Arbeit untersucht die Risiken der Selbstanzeige nach der jüngsten Reform und analysiert das Vollständigkeitsgebot des § 371 AO und dessen Auswirkungen auf die strafbefreiende Wirkung. Konkret werden Sinn und Zweck der Selbstanzeige, die strafrechtlichen und wirtschaftlichen Rechtsfolgen, das Vollständigkeitsgebot (zeitliche und sachliche Aspekte), Ausnahmen vom Vollständigkeitsgebot und die Analyse relevanter Rechtsprechung und Literatur behandelt.
Was wird im Kapitel "Sinn und Zweck der Selbstanzeige" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die fiskalen Gründe und das Motiv der Rückkehr zur Steuerehrlichkeit hinter einer Selbstanzeige. Es analysiert die Intention des Steuerpflichtigen und die Ziele des Gesetzgebers bezüglich der strafbefreienden Wirkung.
Welche Rechtsfolgen werden im Dokument beschrieben?
Das Dokument beschreibt umfassend die strafrechtlichen und wirtschaftlichen Folgen einer Selbstanzeige. Es untersucht die Sanktionen bei unvollständigen Selbstanzeigen und deren Auswirkungen auf den Steuerpflichtigen.
Wie wird das Vollständigkeitsgebot nach § 371 AO behandelt?
Das Vollständigkeitsgebot bildet den Kern der Arbeit. Es wird detailliert analysiert, sowohl zeitlich als auch sachlich, inklusive der damit verbundenen Probleme und Ausnahmen. Die Arbeit diskutiert verschiedene Rechtsauffassungen und präsentiert konkrete Fallbeispiele. Die zeitliche Vollständigkeit umfasst die Verjährungsfristen und den festen Berichtigungszeitraum. Die sachliche Vollständigkeit wird unter Berücksichtigung der Erhebungsartenproblematik und unterschiedlicher Auslegungen analysiert. Ausnahmen, z.B. bei Umsatzsteuer- und Lohnsteuervoranmeldungen oder Außenprüfungen, werden im Kontext erläutert.
Was versteht man unter zeitlicher und sachlicher Vollständigkeit im Kontext des Vollständigkeitsgebots?
Die zeitliche Vollständigkeit bezieht sich auf den Zeitraum, der bei der Selbstanzeige berücksichtigt werden muss, inklusive Aspekte wie Verjährungsfristen und den festen Berichtigungszeitraum. Die sachliche Vollständigkeit hingegen betrifft die umfassende Offenlegung aller relevanten steuerlichen Sachverhalte, einschließlich der Problematik der Erhebungsarten und unterschiedlicher Auslegungsmöglichkeiten.
Welche Ausnahmen vom Vollständigkeitsgebot werden genannt?
Das Dokument nennt Ausnahmen vom Vollständigkeitsgebot bei Umsatzsteuer- und Lohnsteuervoranmeldungen sowie bei Außenprüfungen. Weiterhin wird der Unterschied zwischen materiellem und steuerrechtlichem Tatbestand thematisiert.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für das Verständnis des Dokuments?
Die Schlüsselwörter umfassen: Selbstanzeige, Steuerstrafrecht, Vollständigkeitsgebot, § 371 AO, Strafbefreiung, zeitliche Vollständigkeit, sachliche Vollständigkeit, Verjährung, Berichtigungszeitraum, Rechtsfolgen, Fiskalität, Steuerehrlichkeit.
- Quote paper
- Robin Petschenka (Author), 2016, Die steuerbefreiende Selbstanzeige. Die Risiken und das Vollständigkeitsgebot des § 371 AO, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/335525