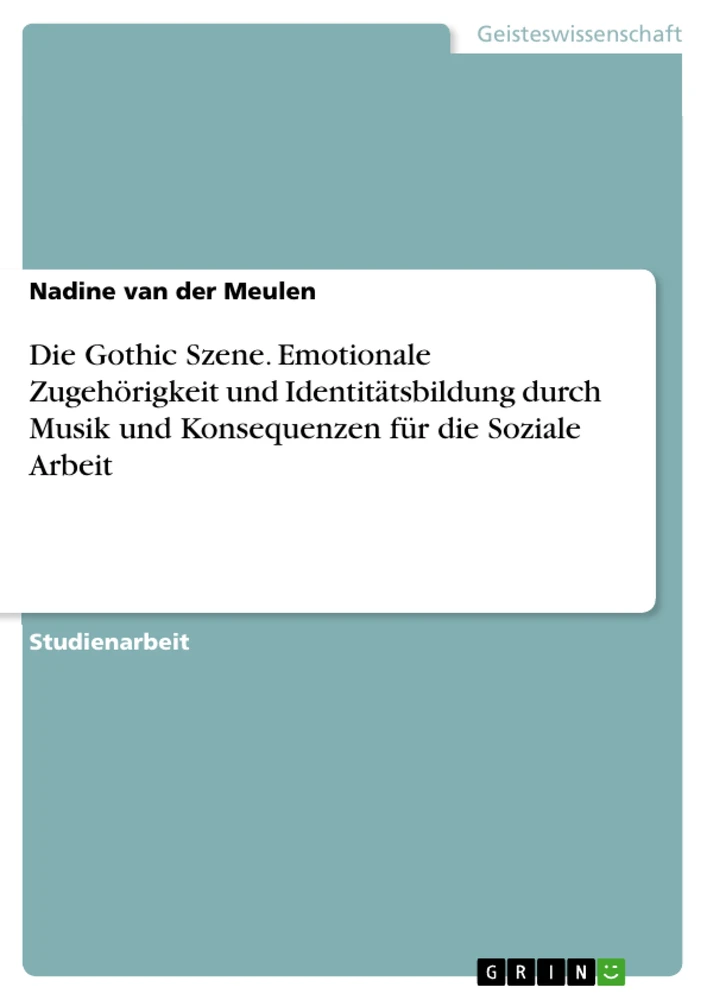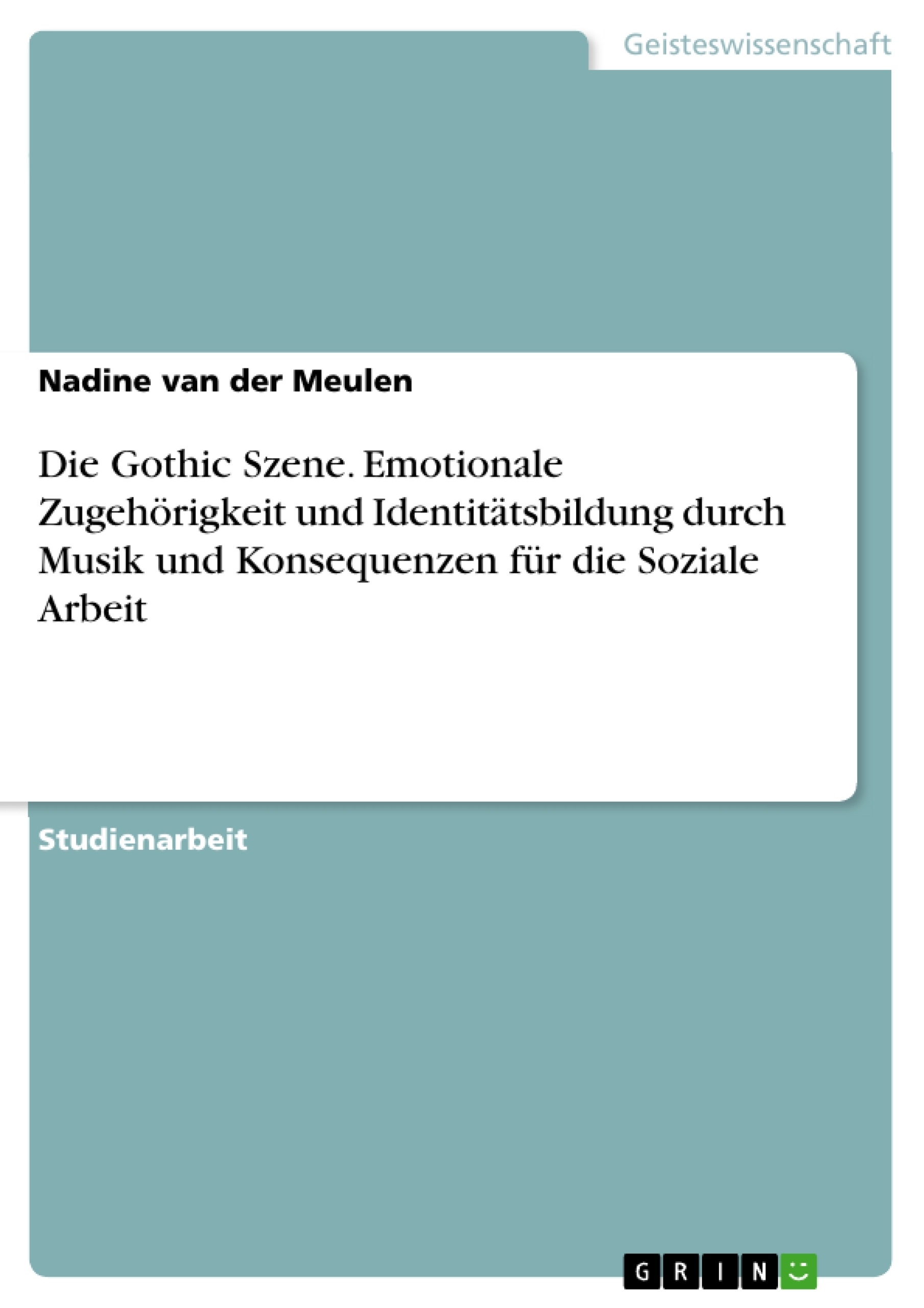Die Gothic-Szene ist seit ihren Anfängen in den 1980er Jahren mit negativen Vorstellungen wie Satanismus und Suizid behaftet und stößt immer wieder auf Ablehnung. Auf Außenstehende wirkt sie gruselig, abschreckend und morbide.
Von den Medien wird dieses Bild zusätzlich durch Medienbeiträge im Fernsehen und dem Internet unterstützt. Doch was steckt hinter der Musik dieser Szene, wie lassen sich die Texte musikpsychologisch begründen und welche Stilrichtungen haben sich in der heutigen Zeit entwickelt und welche Funktion hat sie für die Jugendlichen / für Identitätsbildung?
Hierbei wird unter Hinzuziehung von Fachliteratur herausgearbeitet, was die Gothic Szene kennzeichnet. Betrachtet wird außerdem das Geschlechterverhältnis in der Gothic Szene. Daran anknüpfend wird die Gothic Musik betrachtet und die Frage in den Fokus gestellt, wer die Macher/innen der Musik sind. Dann werden Stilrichtungen von Gothic Musik vorgestellt und zwei neuere Stilrichtungen in den Fokus genommen. Dabei handelt es sich um „Industrial“ und „Neue Deutsche Todeskunst“.
Im vierten Kapitel liegt der Fokus auf der Identitätsbildung. Betrachtet wird dabei zuerst die allgemeine Bedeutung von Musik in der Jugendphase. Konkretisiert am Songinhalt, an der Inszenierung und Kleidung in der Gothic Szene, und an den geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen wird dargestellt, wie geschlechtliche Identität durch die Musik der Gothic Szene konstruiert wird.
Anschließend werden die Konsequenzen für die Soziale Jugendarbeit diskutiert, und Anregungen gegeben, wie die Arbeit mit Kindern- und Jugendlichen der Gothic Szene in Einrichtungen wie Offene Treffs und in der Jugendarbeit allgemein langfristig aussehen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Gothic Szene
- Der Begriff Gothic
- Geschlechterverhältnis
- Gothic Musik
- Wer sind die Macher/innen der Musik?
- Stilrichtungen
- Industrial
- Neue Deutsche Todeskunst
- Identitätsbildung
- Allgemeine Bedeutung von Musik in der Jugend
- Emotionale Zugehörigkeit durch Identifikation mit düsteren Musiktexten
- Inszenierung / Kleidung
- Konsequenzen für die Soziale Arbeit im Rahmen von Jugendarbeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Gothic-Szene, ihre Musik, und ihre Bedeutung für die Identitätsbildung Jugendlicher. Sie beleuchtet die Entwicklung der Szene, verschiedene Stilrichtungen der Gothic Musik, und die Rolle der Musik im Kontext von Geschlecht und sozialer Zugehörigkeit. Zusätzlich werden die Konsequenzen für die Jugendarbeit und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit im Umgang mit dieser Szene betrachtet.
- Entwicklung und Definition der Gothic-Szene
- Stilrichtungen der Gothic-Musik und deren Entstehungsgeschichte
- Bedeutung von Gothic-Musik für die Identitätsfindung Jugendlicher
- Geschlechterrollen und -verhältnisse innerhalb der Szene
- Konsequenzen und Ansatzpunkte für die Soziale Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Gothic-Szene ein und beschreibt die ambivalenten und oft negativen Vorurteile, die mit ihr verbunden sind. Sie benennt die Forschungsfrage, die sich mit der musikalischen Ausprägung, den psychologischen Hintergründen und der Funktion der Szene für Jugendliche auseinandersetzt. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und die verwendeten Methoden, wobei die Relevanz von Fachliteratur hervorgehoben wird.
Die Gothic Szene: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der Gothic-Szene, beginnend mit dem Jahr 1979 und dem Song "Bela Lugosi's Dead" von Bauhaus. Es beschreibt die Entwicklung über verschiedene Generationen von Bands und die zunehmende Popularität und Kommerzialisierung der Szene. Die Ambivalenz der Szene wird betont, da sich die älteren Generationen von der jüngeren, kommerziell ausgerichteten Generation abgrenzen. Die Bedeutung von Events wie dem Wave-Gotik-Treffen wird erwähnt, ebenso wie die widersprüchlichen Darstellungen in den Medien, die von harmloser Trauerkultur bis hin zu Verbindungen zu Rechtsextremismus reichen. Das Kapitel endet mit der Beschreibung der Szene als eine der langlebigsten Jugendsubkulturen.
Gothic Musik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Gothic Musik. Es wird die Frage nach den Machern der Musik gestellt und verschiedenen Stilrichtungen vorgestellt, wobei "Industrial" und "Neue Deutsche Todeskunst" als Beispiele für neuere Entwicklungen hervorgehoben werden. Obwohl der detaillierte Inhalt nicht zugänglich ist, lässt sich vermuten, dass der Fokus auf der musikalischen Vielfalt und Entwicklung innerhalb der Szene liegt, unter Berücksichtigung der verschiedenen Einflüsse und die sich ändernden Geschmäcker innerhalb der Szene.
Identitätsbildung: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Musik, insbesondere Gothic-Musik, für die Identitätsbildung Jugendlicher. Es wird die allgemeine Rolle von Musik in der Jugendphase betrachtet und analysiert, wie die Inszenierung, Kleidung und die Texte der Gothic-Szene zur Konstruktion geschlechtsspezifischer Identität beitragen. Obwohl die genauen Ausführungen fehlen, ist zu erwarten, dass die Zusammenhänge zwischen musikalischer Identifikation, emotionaler Zugehörigkeit und der Ausprägung der Identität im Kontext der Gothic-Szene umfassend beleuchtet werden.
Konsequenzen für die Soziale Arbeit im Rahmen von Jugendarbeit: Dieses Kapitel diskutiert die Konsequenzen für die Soziale Jugendarbeit und gibt Anregungen für den Umgang mit Jugendlichen aus der Gothic-Szene. Es beleuchtet fehlende Angebote in Jugendeinrichtungen und wirft die Frage auf, wie die Soziale Arbeit Jugendliche aus der Gothic-Szene unterstützen kann. Es wird vermutlich ein Fokus auf gendersensible Soziale Arbeit und die kritische Auseinandersetzung mit Jugendmusikszenen gelegt.
Schlüsselwörter
Gothic-Szene, Gothic-Musik, Identitätsbildung, Jugendkultur, Subkultur, Geschlechterverhältnisse, Soziale Arbeit, Jugendarbeit, Industrial, Neue Deutsche Todeskunst, Medienrezeption.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die Gothic-Szene: Musik, Identität und Soziale Arbeit"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Gothic-Szene, ihre Musik und ihre Bedeutung für die Identitätsbildung Jugendlicher. Sie beleuchtet die Entwicklung der Szene, verschiedene Stilrichtungen der Gothic-Musik, und die Rolle der Musik im Kontext von Geschlecht und sozialer Zugehörigkeit. Zusätzlich werden die Konsequenzen für die Jugendarbeit und Möglichkeiten der Sozialen Arbeit im Umgang mit dieser Szene betrachtet.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Schwerpunkte: Entwicklung und Definition der Gothic-Szene, Stilrichtungen der Gothic-Musik und deren Entstehungsgeschichte, Bedeutung von Gothic-Musik für die Identitätsfindung Jugendlicher, Geschlechterrollen und -verhältnisse innerhalb der Szene sowie Konsequenzen und Ansatzpunkte für die Soziale Arbeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur Gothic-Szene, Gothic-Musik, Identitätsbildung und Konsequenzen für die Soziale Arbeit, sowie ein Fazit. Jedes Kapitel bietet eine umfassende Zusammenfassung der jeweiligen Themen.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in das Thema ein, beschreibt die ambivalenten Vorurteile gegenüber der Gothic-Szene, formuliert die Forschungsfrage und skizziert den Aufbau und die Methoden der Arbeit.
Was wird im Kapitel "Die Gothic-Szene" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der Gothic-Szene ab 1979, die verschiedenen Generationen von Bands, die Kommerzialisierung und die Ambivalenz der Szene. Es betrachtet Events wie das Wave-Gotik-Treffen und die widersprüchlichen Medienberichte.
Worum geht es im Kapitel "Gothic Musik"?
Das Kapitel befasst sich mit den Machern der Gothic-Musik und stellt verschiedene Stilrichtungen vor, darunter "Industrial" und "Neue Deutsche Todeskunst". Es analysiert die musikalische Vielfalt und Entwicklung innerhalb der Szene.
Was ist der Fokus des Kapitels "Identitätsbildung"?
Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Gothic-Musik für die Identitätsbildung Jugendlicher. Es betrachtet die allgemeine Rolle von Musik in der Jugendphase und analysiert, wie Inszenierung, Kleidung und Texte zur Konstruktion geschlechtsspezifischer Identität beitragen.
Welche Aspekte werden im Kapitel "Konsequenzen für die Soziale Arbeit" behandelt?
Dieses Kapitel diskutiert die Konsequenzen für die Soziale Jugendarbeit und gibt Anregungen für den Umgang mit Jugendlichen aus der Gothic-Szene. Es beleuchtet fehlende Angebote und wirft die Frage auf, wie die Soziale Arbeit Jugendliche unterstützen kann, mit einem Fokus auf gendersensible Soziale Arbeit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gothic-Szene, Gothic-Musik, Identitätsbildung, Jugendkultur, Subkultur, Geschlechterverhältnisse, Soziale Arbeit, Jugendarbeit, Industrial, Neue Deutsche Todeskunst, Medienrezeption.
- Arbeit zitieren
- Nadine van der Meulen (Autor:in), 2014, Die Gothic Szene. Emotionale Zugehörigkeit und Identitätsbildung durch Musik und Konsequenzen für die Soziale Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/334777