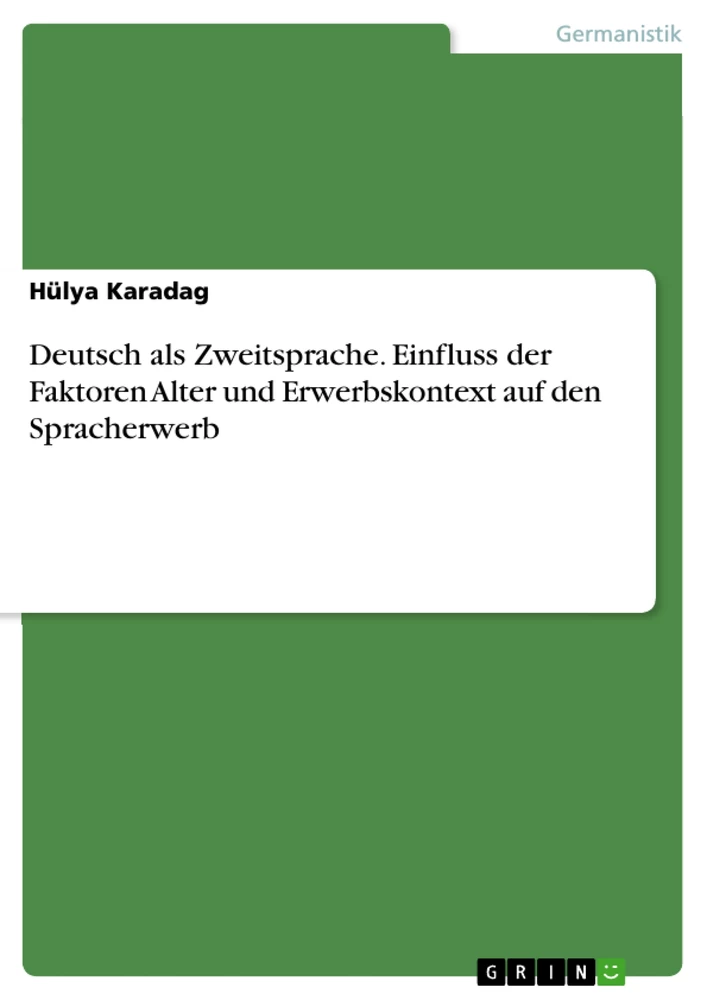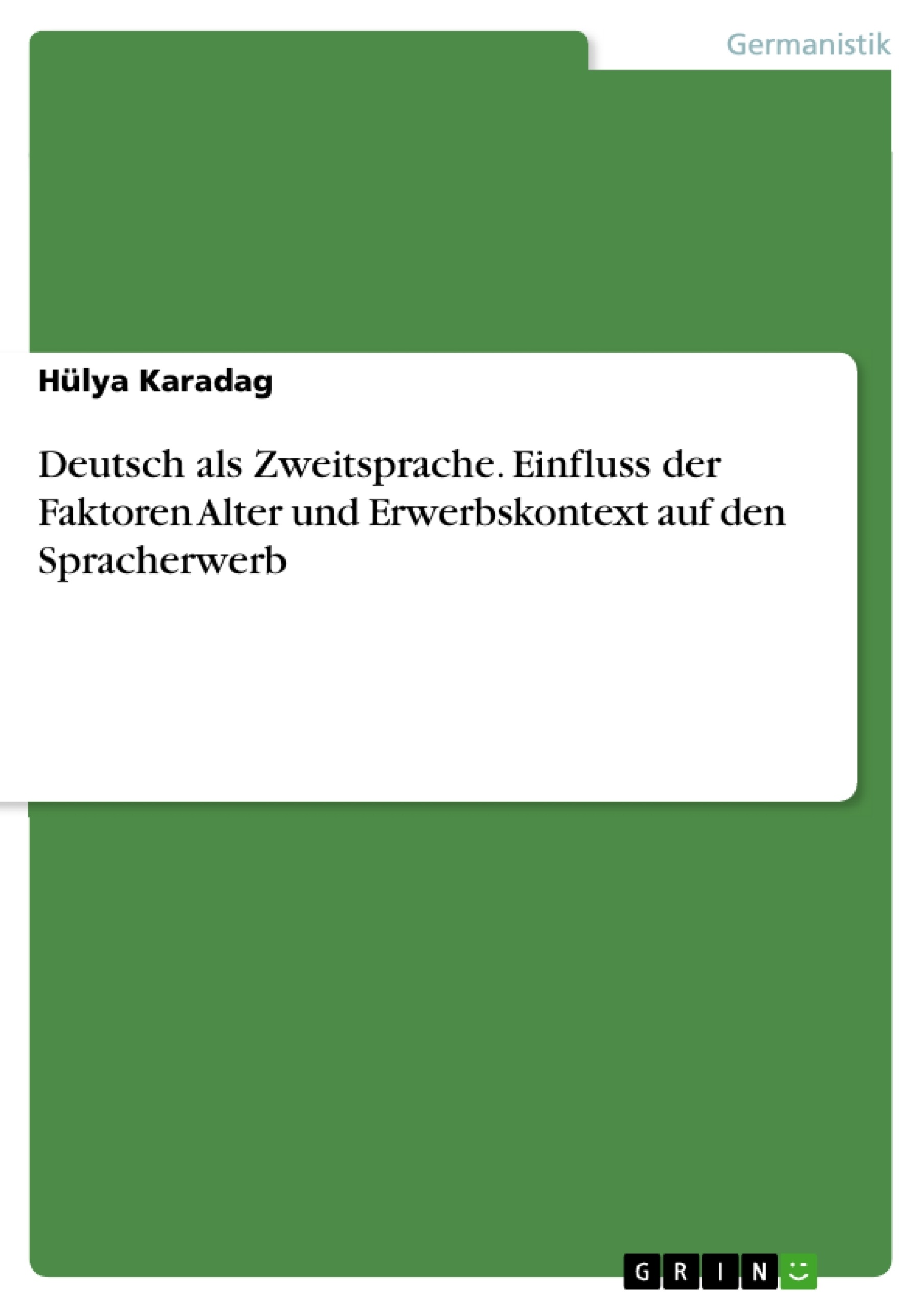Gegenstand der vorliegenden Examensklausur ist das Thema Deutsch als Zweitsprache für Schülerinnen und Schüler (SuS) mit Migrationshintergrund. Die Aneignung der Sprache ist grundlegend für den Schulerfolg und damit bestimmend für die zukünftige Lebensgestaltung in der Gesellschaft. Der Schul(miss-)erfolg von SuS mit Migrationshintergrund wird von PISA und IGLU gezeigt, ebenso wie der Umstand, dass die SuS mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem effektiver gefördert werden sollten, um bessere Erfolge zu erzielen.
Dass Migrantenkinder und – jugendliche überproportional häufig Hauptschulen besuchen, sowie keinen Schulabschluss erreichen, ist damit zu erklären, dass der Bildungserfolg nicht nur von der sozialen Herkunft abhängig ist und ein beträchtlicher Prozentsatz der SuS mit Migrationshintergrund aus niedrigen sozio-ökonomischen Status vertreten sind, sondern auch von ihrer unzureichenden zweitsprachlichen Kompetenz.
Seit Beginn der 1970er Jahre hat sich die Zweitspracherwerbsforschung als wissenschaftliche Disziplin entwickelt, wird in Bildungseinrichtungen, wie etwa in Schulen – wo bisher Sprachproduktionen von SuS mit Migrationshintergrund, die nicht der standardsprachlichen Norm entsprechen, als falsch bzw. fehlerhaft gewertet wurde – eine andere Sichtweise eingenommen. Demnach versucht die Zweitspracherwerbsforschung, die Prinzipien und Mechanismen nachvollzuziehen, welche den Zweitspracherwerb sowie die ihn kennzeichnenden Strukturen bestimmen.
Im Folgenden soll zunächst auf die Definitionen zum Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerb eingegangen werden, damit beim Gebrauch der terminologischen Begriffe die differenzierenden Besonderheiten verdeutlicht werden. Anschließend sollen die Einflussfaktoren des Zweitspracherwerbs dargestellt werden. Hierbei werden die Faktoren „Erwerbskontext“ und das „Alter“ ausführlich diskutiert.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Grundlegende Begriffsbestimmungen
- Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerb
- Bilingualismus
- Grad der Sprachbeherrschung
- Alter und Zweitspracherwerb
- Erwerbskontext – Einflussfaktor auf den ZSE
- Ungesteuerter ZSE
- Gesteuerter ZSE
- Sprachtrennung und Sprachmischung
- Transfer und Interferenz
- Alter – Einflussfaktor auf den ZSE
- Hypothese der kritischen Periode
- Antriebsorientierter Erklärungsansatz
- Motivation und Sprachkompetenz
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Examensklausur befasst sich mit Deutsch als Zweitspracherwerb (DaZ) und analysiert die verschiedenen Einflussfaktoren, die diesen Prozess prägen. Die Arbeit untersucht, wie sich der Erwerbskontext und das Alter auf den Erfolg des DaZ-Erwerbs auswirken und inwiefern diese Faktoren die Entwicklung der sprachlichen Kompetenz beeinflussen.
- Definitionen von Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerb
- Die Rolle des Erwerbskontextes (gesteuerter vs. ungesteuerter ZSE)
- Die Bedeutung des Alters für den ZSE und die Hypothese der kritischen Periode
- Motivation als entscheidender Faktor im DaZ-Erwerb
- Transferphänomene im Zweitspracherwerb, insbesondere Sprachmischung und Sprachwechsel
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt das Thema Deutsch als Zweitspracherwerb vor und erläutert die Relevanz der Sprachaneignung für den Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Anschließend werden in Kapitel 2 grundlegende Begriffsbestimmungen geklärt, wobei die Unterschiede zwischen Erst-, Zweit- und Fremdspracherwerb sowie die verschiedenen Formen des Bilingualismus und die Grade der Sprachbeherrschung behandelt werden. Kapitel 3 konzentriert sich auf den Erwerbskontext und die Unterscheidung zwischen gesteuertem und ungesteuertem ZSE. Dabei werden die spezifischen Merkmale, Schwierigkeiten und Lernstrategien der jeweiligen Erwerbstypen betrachtet. Das Kapitel beleuchtet außerdem die Prozesse der Sprachmischung und des Transfers, die im ZSE eine wichtige Rolle spielen.
Das vierte Kapitel untersucht den Einfluss des Alters auf den ZSE und diskutiert die Hypothese der kritischen Periode. Es werden die verschiedenen Argumente für und gegen diese Hypothese sowie alternative Erklärungsmodelle vorgestellt. Außerdem wird der Einfluss von Motivation auf den DaZ-Erwerb und die Unterscheidung zwischen instrumenteller und integrativer Motivation beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Zweitspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache, Erwerbskontext, ungesteuerter ZSE, gesteuerter ZSE, Sprachmischung, Sprachwechsel, Transfer, Interferenz, Alter, kritische Periode, Motivation, instrumentelle Motivation, integrative Motivation, Sprachlernfähigkeit, Sprachkompetenz, Schulerfolg, Migrationshintergrund.
- Quote paper
- Hülya Karadag (Author), 2016, Deutsch als Zweitsprache. Einfluss der Faktoren Alter und Erwerbskontext auf den Spracherwerb, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/334337