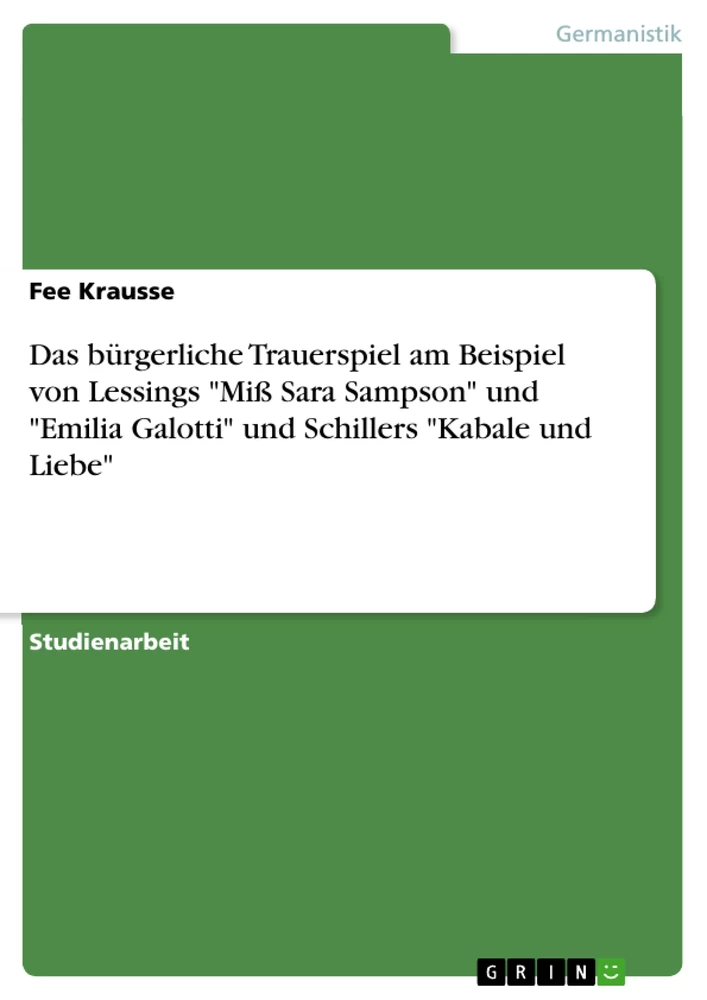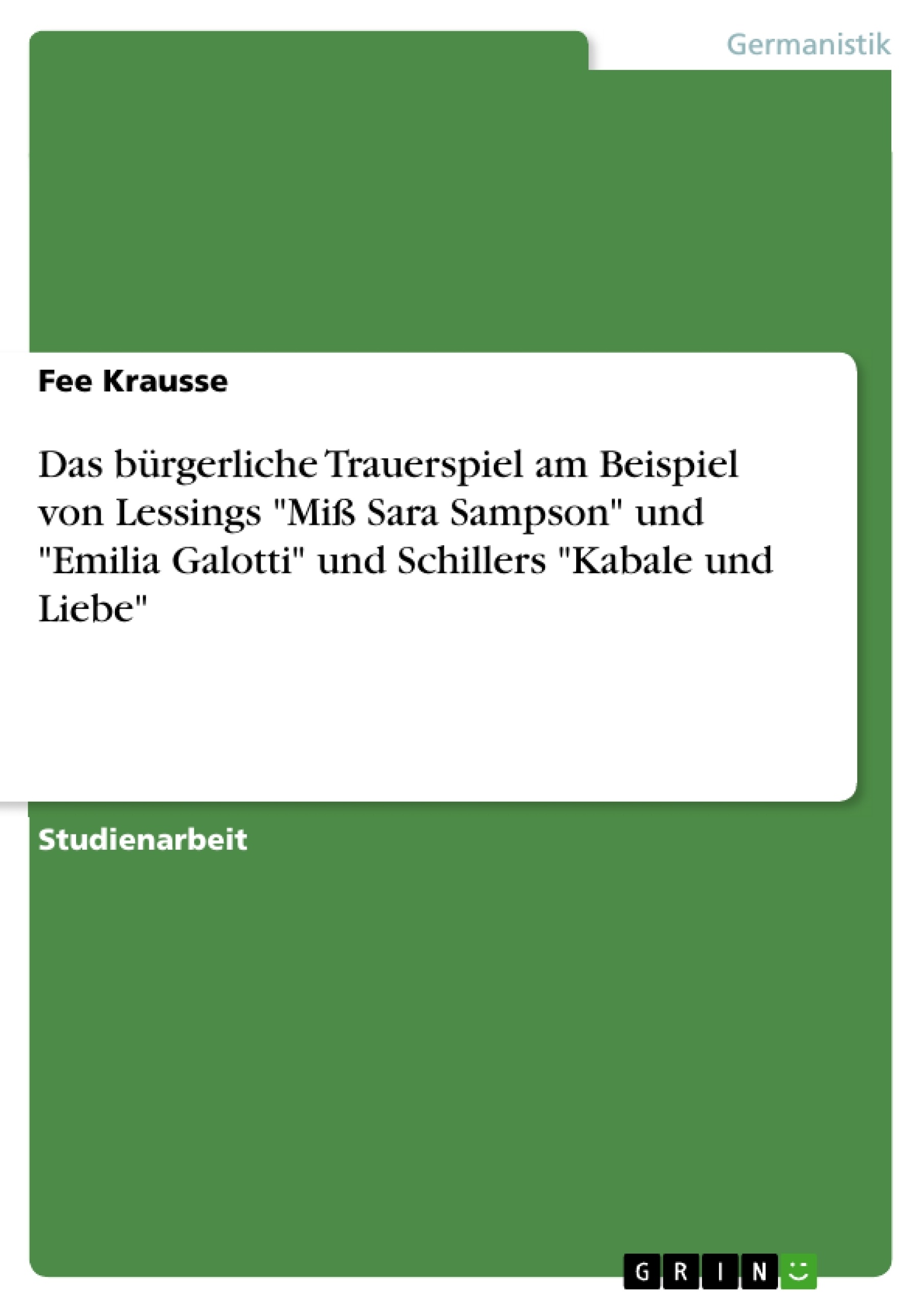Noch im Barock durften, aufgrund der Ständeklausel, nur Personen des höheren Standes in der Tragödie auftreten, während den Menschen des bürgerlichen Standes die Komödie vorbehalten war. Die lächerlichen Bühnenhelden des französischen Komödiendichters Moliere, vom eingebildeten Kranken bis zu Tartuffe, waren Bürger, und die komische Figur der Volkskomödie war ein Bauer. Doch die Tragödie des 17. und frühen 18. Jahrhunderts zeigte im Mittelpunkt der Handlung stets eine Hauptfigur, die der Aristokratie angehörte. Tragische Schicksale - so scheint es - konnten nur Angehörige des ersten Standes erleben, während die Schicksale niederer Standespersonen, also der Bürger und Bauern, als unerheblich galten. Man glaubte den Bürger erhabener Gefühle nicht fähig; zudem fehlte ihm die soziale „Fallhöhe“ (Schopenhauer), die angeblich die tragische Wirkung hervorbringt. Doch mit der Epoche der Aufklärung entstand Mitte des 18. Jahrhunderts das bürgerliche Trauerspiel, das den Bürger in den Mittelpunkt des tragischen Geschehens rückte.
„Der tragische Konflikt wurde [im bürgerlichen Trauerspiel] durch den Gegensatz der sozialen Schichten (Stände) ausgelöst.“ (Mettenleiter/Knöbl 1991, S. 291) Konflikt und Tragik resultierten entweder aus Standesgegensätzen zwischen Adel und Bürgertum (z.B. Lessings „Emilia Galotti“, „Miß Sara Sampson“; Schillers „Kabale und Liebe), aus innerständischen Gegensätzen, die im Bürgertum selbst begründet waren (z.B. Hebbels „Maria Magdalena“) oder „aus der Fragwürdigkeit und Brüchigkeit des Bürgertums selbst gegenüber dem entrechteten Arbeiterstand.“ (Winkler 1986, S. 99)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das bürgerliche Trauerspiel
- Die Entstehung des bürgerlichen Trauerspiels
- Vergleich der ausgewählten Trauerspiele
- Die weiblichen Hauptpersonen
- Nebenpersonen
- Die Handlung
- Bürgerlichkeit der drei Stücke
- Wesentliche Aspekte der ausgewählten Trauerspiele
- Sara als ,,Heilige“
- Der Tod Emilia Galottis
- Gesellschaftskritik in „Kabale und Liebe“
- Abschließender Kommentar
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das bürgerliche Trauerspiel und dessen Entstehung. Im Fokus stehen die Vergleichsanalyse von drei bedeutenden Stücken - „Miß Sara Sampson“, „Emilia Galotti“ und „Kabale und Liebe“ - sowie die Beleuchtung von zentralen Aspekten dieser Dramen.
- Die Entwicklung des bürgerlichen Trauerspiels
- Die Darstellung von Konflikten zwischen Adel und Bürgertum
- Die Rolle von Moral und Tugend in der Tragödie
- Die Bedeutung von Gesellschaft und Standeszugehörigkeit für die Handlung
- Die verschiedenen Arten von Tragik im bürgerlichen Trauerspiel
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt zunächst in die Gattung des bürgerlichen Trauerspiels und seine Entstehung ein. Anschließend werden die drei ausgewählten Trauerspiele - „Miß Sara Sampson“, „Emilia Galotti“ und „Kabale und Liebe“ - im Hinblick auf ihre weiblichen Hauptpersonen, Nebenpersonen, Handlungsstränge und die Frage nach ihrer Bürgerlichkeit miteinander verglichen.
Im dritten Kapitel werden die wichtigen Aspekte der ausgewählten Trauerspiele beleuchtet. Hierbei geht es um die Darstellung Saras als „Heilige“, um den Tod Emilia Galottis und um die Gesellschaftskritik in „Kabale und Liebe“.
Schlüsselwörter
Bürgerliches Trauerspiel, Lessing, Schiller, „Miß Sara Sampson“, „Emilia Galotti“, „Kabale und Liebe“, Standeskonflikte, Gesellschaftskritik, Tugend, Moral, Tragödie, klassische Tragödie.
- Quote paper
- Fee Krausse (Author), 2002, Das bürgerliche Trauerspiel am Beispiel von Lessings "Miß Sara Sampson" und "Emilia Galotti" und Schillers "Kabale und Liebe", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/33262