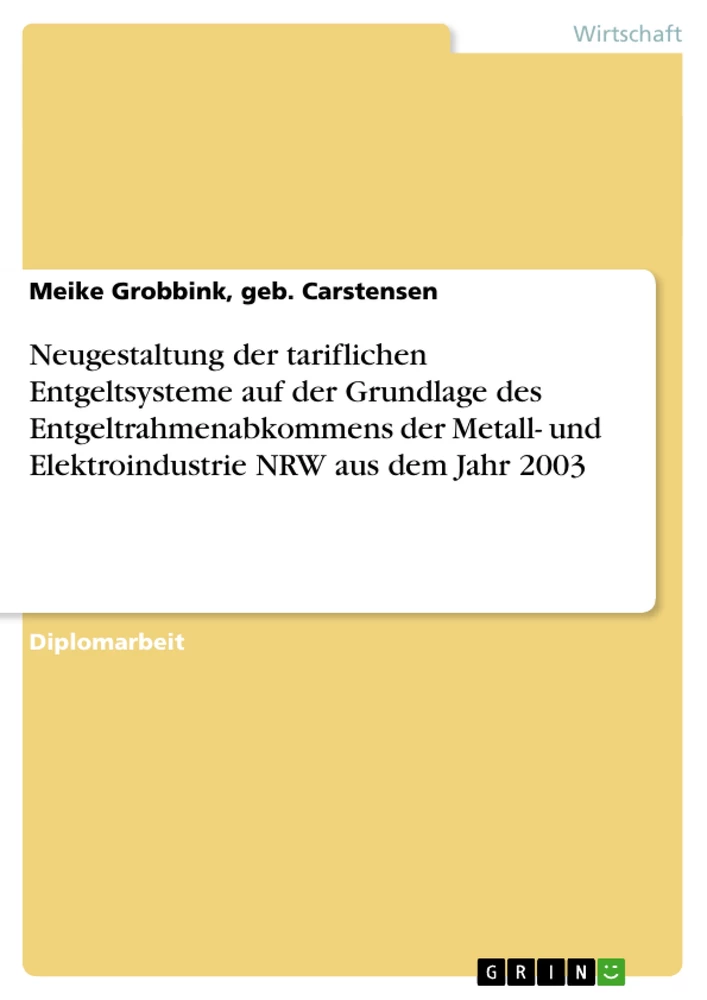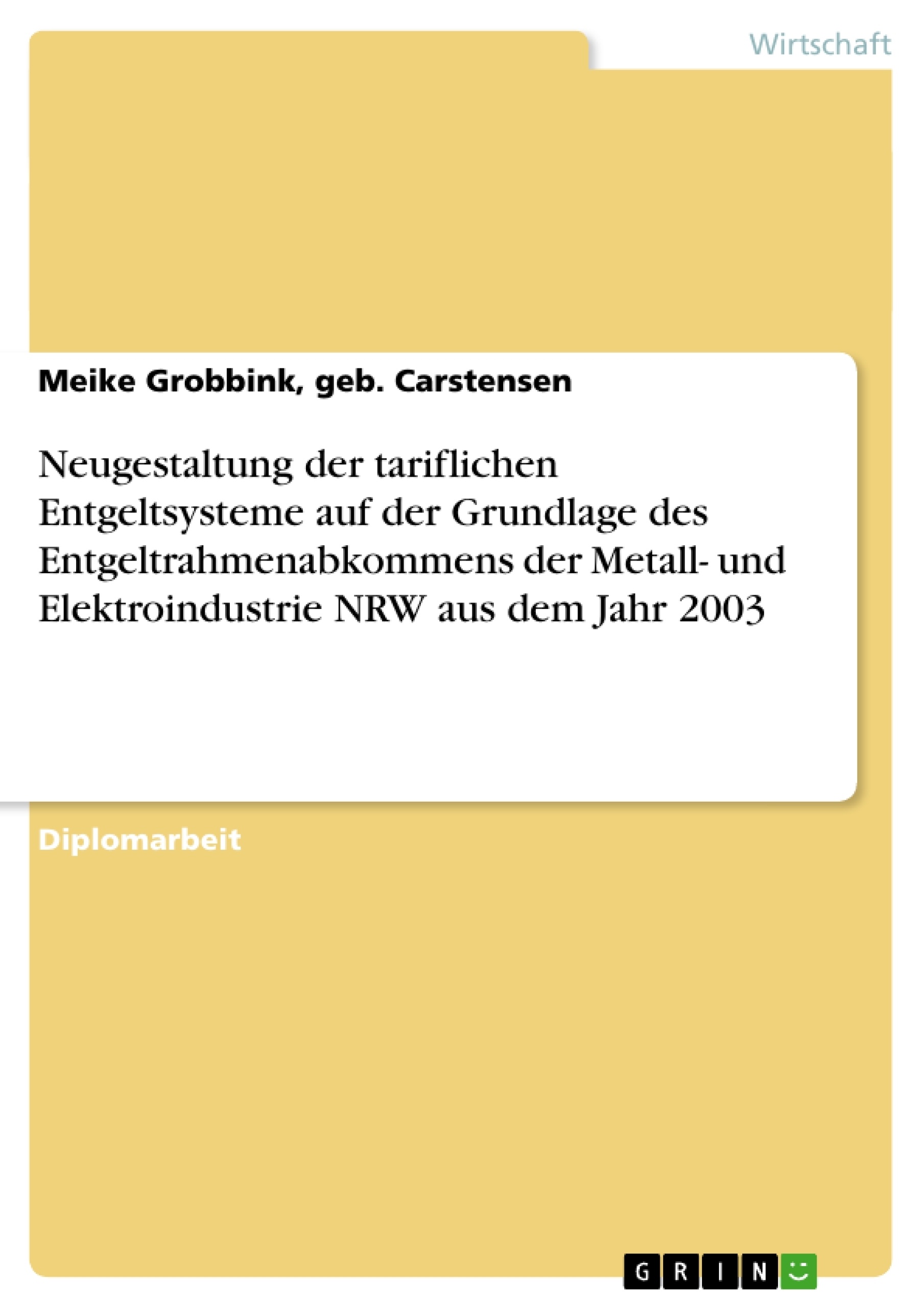„Die [...] Vorstellungen von leistungsgerechtem Arbeitsentgelt schwingen mit, wenn [...] das eigene Arbeitsentgelt mit dem Arbeitsentgelt verglichen wird, das die Arbeitskollegen für Leistungen etwa gleicher Art vergütet erhalten. Besteht begründeter Anlass anzunehmen, dass im Betrieb für Arbeiten etwa gleich großer Beanspruchung der körperlichen und geistigen Kräfte unterschiedliche Vergütungen bezahlt werden, dann wird damit eine Lage geschaffen, die, gemessen an den Vorstellungen leistungerechter Entlohnung, als ungerecht empfunden wird.“
„Tatsächlich hat sich die Situation [...] im letzten Jahrzehnt derart geändert, dass eine gänzlich neue Arbeitswelt und veränderte soziale Lebensbedingungen entstanden sind. Wurde schon die rechtliche Unterscheidung seit Jahrzehnten als fragwürdig angesehen, so hat die inzwischen erfolgte gesellschaftliche Entwicklung einer krassen Unterscheidung von Arbeitern und Angestellten den Boden entzogen.“
Ab März 2005 wird das Entgeltrahmenabkommen der Metall- und Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen (ERA) eingeführt.
Die beiden Zitate von Gutenberg und Zander spiegeln den wesentlichen Grundgedanken des ERA wider. Die Tarifparteien haben erkannt, dass „Tarifpolitik die Pflicht hat, auf die Entwicklung zu schauen und mit ihren Forderungen der erwartbaren Realitäten gerecht zu werden. Tarifpolitik muss sich in der wirtschaftlichen Realität bewegen.“
Der wesentliche Bestandteil des ERA-Vertrages ist, dass durch die darin enthaltenen Regelungen die über Jahrzehnte entstandenen Unterschiede zwischen den Einkommen von Arbeitern und Angestellten ausgeglichen werden sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Grundlagen zum Entgeltrahmenabkommen
- 2.1 Die tarifliche Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten als wesentliche Neuerung des Entgeltrahmenabkommens
- 2.2 Die Chemieindustrie als Vorreiterin
- 2.3 Die Historie des Entgeltrahmenabkommens der Metall- und Elektroindustrie
- 2.4 Die Voraussetzungen zum Übergang eines Entgeltrahmenabkommens
- 2.4.1 Das Instrument der Stellenbeschreibung in seiner Bedeutung für die Entgeltfindung
- 2.4.2 Die Sicherung der betrieblichen und systembedingten Kostenneutralität
- 2.4.3 Der Entgeltrahmenabkommen-Anpassungsfonds
- 2.4.4 Die Angleichung der Ist-Vergütung an die Soll-Vergütung nach dem Entgeltrahmenabkommen
- 2.5 Die Behandlung verschiedener Entgeltarten im neuen Rahmenabkommen
- 3 Die Einführung des Entgeltrahmenabkommens bei ABB Calor Emag Mittelspannung GmbH (CMS) am Standort Ratingen
- 3.1 Die ABB Calor Emag Mittelspannung GmbH als Referenzunternehmen
- 3.2 Vorgehensweise zur Einführung des Entgeltrahmenabkommens
- 3.2.1 Der Punktbewertungsbogen nach ERA-Standard
- 3.2.2 Aufgabenbeschreibung nach ABB-Standard
- 3.2.3 Die Eingruppierung und Reklamation
- 3.3 Die praktische Umsetzung am Beispiel des Bereichs Vakuumschaltkammer-Produktion (CMS/GK) des Standortes Ratingen
- 3.3.1 Das Stellenprofil und die Eingruppierung nach dem Entgeltrahmenabkommen des Bereiches CMS/GK
- 3.3.2 Darstellung und Erläuterung der voraussichtlichen ERA-Entgeltkurve von CMS/GK
- 3.3.3 Darstellung und Erläuterung der Entgeltkurve nach dem alten Tarifvertragsrecht von CMS/GK
- 3.3.4 Vergleich zwischen alter und neuer Entgeltkurve
- 3.4 Problemanalyse bezüglich der praktischen Auswertung
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Neugestaltung der tariflichen Entgeltsysteme auf der Grundlage des Entgeltrahmenabkommens der Metall- und Elektroindustrie NRW aus dem Jahr 2003. Sie untersucht die Einführung dieses neuen Abkommens in einem Referenzunternehmen und analysiert die Auswirkungen auf die Entgeltstruktur und die praktische Umsetzung.
- Die tarifliche Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten
- Die Historie und die Voraussetzungen zum Übergang eines Entgeltrahmenabkommens
- Die Einführung des Entgeltrahmenabkommens in einem Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie
- Die praktische Umsetzung des Entgeltrahmenabkommens am Beispiel eines bestimmten Bereichs
- Die Analyse der Auswirkungen des neuen Entgeltsystems auf die Entgeltstruktur und die praktische Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Thematik des Entgeltrahmenabkommens und stellt die Relevanz der Arbeit dar. Das zweite Kapitel erläutert die Grundlagen des Entgeltrahmenabkommens, indem es die tarifliche Gleichstellung von Arbeitern und Angestellten als wesentliche Neuerung beleuchtet, die Chemieindustrie als Vorreiterin darstellt und die Historie sowie die Voraussetzungen zum Übergang eines Entgeltrahmenabkommens beleuchtet. Dabei werden wichtige Aspekte wie die Stellenbeschreibung, die Sicherung der Kostenneutralität und der Entgeltrahmenabkommen-Anpassungsfonds behandelt. Das zweite Kapitel schließt mit einer Betrachtung der Behandlung verschiedener Entgeltarten im neuen Rahmenabkommen. Das dritte Kapitel fokussiert auf die Einführung des Entgeltrahmenabkommens bei ABB Calor Emag Mittelspannung GmbH (CMS) am Standort Ratingen. Es beschreibt die Vorgehensweise zur Einführung des Entgeltrahmenabkommens, stellt den Punktbewertungsbogen und die Aufgabenbeschreibung nach ABB-Standard vor und beleuchtet die Eingruppierung und Reklamation. Das Kapitel analysiert die praktische Umsetzung des Entgeltrahmenabkommens am Beispiel des Bereichs Vakuumschaltkammer-Produktion (CMS/GK). Es untersucht das Stellenprofil und die Eingruppierung des Bereichs, stellt die ERA-Entgeltkurve und die Entgeltkurve nach altem Tarifvertragsrecht dar und führt einen Vergleich zwischen alter und neuer Entgeltkurve durch. Das Kapitel schließt mit einer Problemanalyse bezüglich der praktischen Auswertung.
Schlüsselwörter
Entgeltrahmenabkommen, Metall- und Elektroindustrie, Tarifliche Gleichstellung, Stellenbeschreibung, Kostenneutralität, Entgeltgruppen, Punktbewertungsbogen, Aufgabenbeschreibung, Eingruppierung, ERA-Entgeltkurve, Praktische Umsetzung, Problemanalyse.
- Quote paper
- Meike Grobbink, geb. Carstensen (Author), 2004, Neugestaltung der tariflichen Entgeltsysteme auf der Grundlage des Entgeltrahmenabkommens der Metall- und Elektroindustrie NRW aus dem Jahr 2003, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/33040