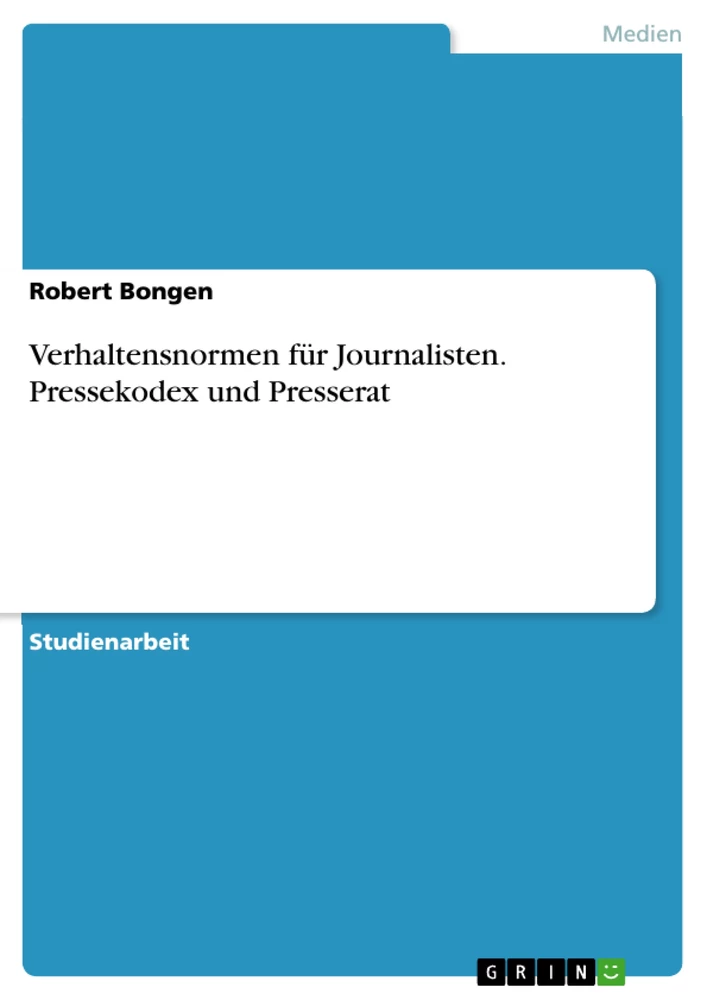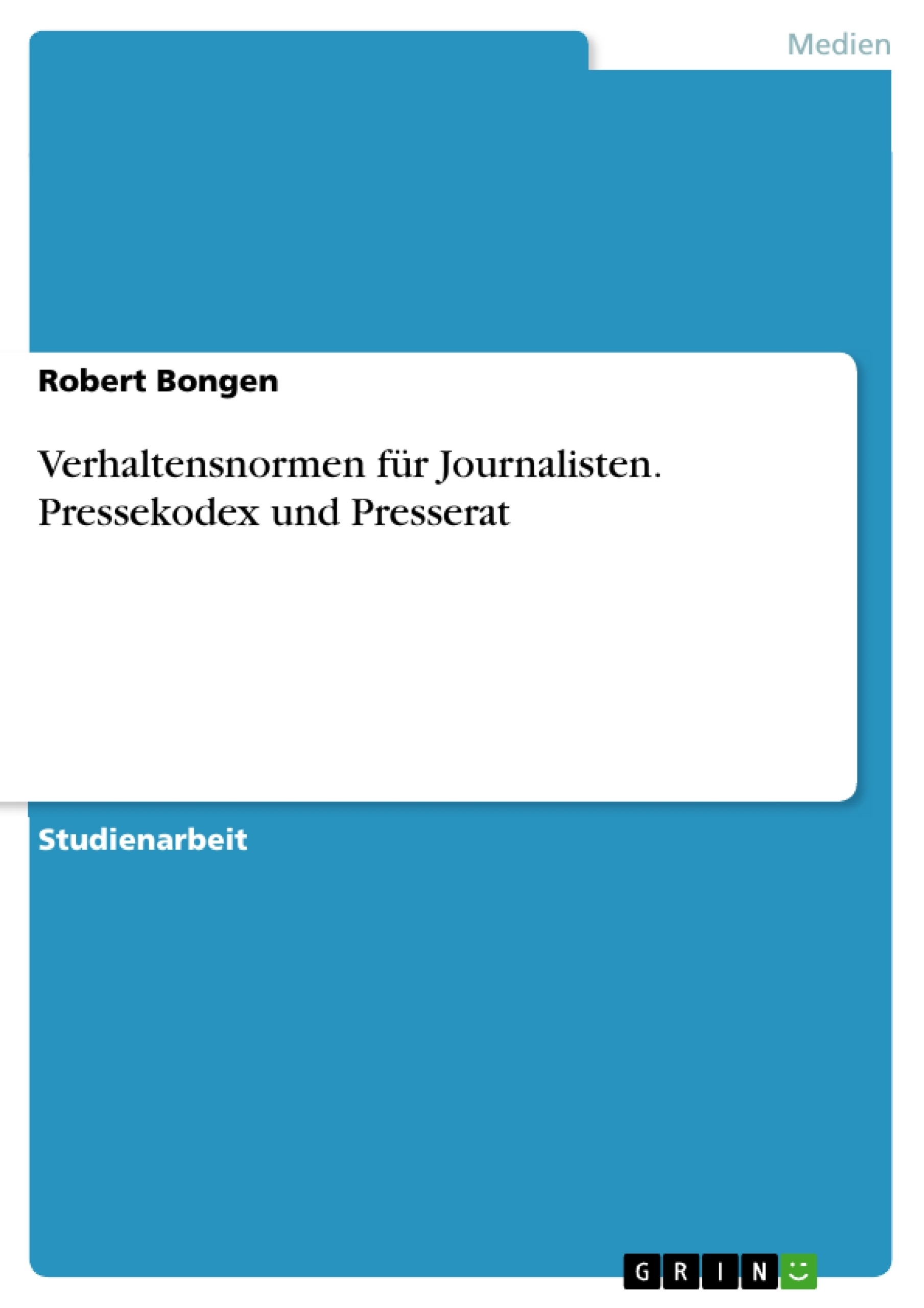“Journalismus zwischen Ist und Soll”: Der Deutsche Presserat markiert wie kein anderer die Schnittstelle zwischen dem Ist-Zustand und dem Soll-Zustand; er bewegt sich wie keine andere Institution oder Organisation auf dem schmalen Grat, sowohl den Ist-Zustand zu beobachten als auch für den Soll-Zustand einzutreten.
Das Ist ist bekannt: Die Medienwelt dreht sich immer schneller, ganz neue Medienzweige kommen hinzu. Paparazzi, Meinungsmanipulation, Scheckbuch- oder Enthüllungsjournalismus markieren immer wieder auftauchende Schlagworte, die nicht unschuldig daran sind, daß in Deutschland in den verschiedensten Medien-Segmenten Vertrauenskrisen aufbrechen - und das vor allem in den Bereichen, die in den heftigsten Konkurrenz-Kampf verwickelt sind - also bei den Boulevard-Blättern und Illustrierten.
“Schneller und sensationeller” lautet die Devise, wo immer mehr Anbieter einen langsam wachsenden Kuchen unter sich aufteilen müssen. “Die Pressemoral ist und bleibt ein Kardinalthema” stellte 1996 der Sprecher des Deutschen Presserats, Robert Schweizer, fest. Und der Berliner Kommunikationswissenschaftler STEPHAN RUSS-MOHL verdeutlicht: “Wenn Marktmechanismen nicht von alleine zu gesellschaftlich erwünschtem Verhalten führen, anderseits gesetzliche Regelungen die Pressefreiheit gefährden, bleibt nur eine schwache Steuerungsmöglichkeit: die (Selbst-)Verpflichtung der Medien auf ethische Normen sowie die Einrichtung von Selbstkontrollinstanzen, die deren Einhaltung überwachen.”
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Struktur, Aufgaben und Arbeitsweise des Deutschen Presserats
- Verständnis des Deutschen Presserats von Selbstkontrolle
- Das Selbstverständnis - Pressefreiheit “über alles”?
- Ein Unabhängigkeitsmodell - und keine Alternativen?
- Keine Zwänge, kein Zunftdenken - auch kein kollegialer Zusammenhalt?
- Fortschritt - Medienschelte, aber keine qualitative Verflachung
- Dezisionismus - problematischer Freiraum für Presse und Justiz
- Publizistische Grundsätze des Deutschen Presserats
- Plenumsarbeit des Deutschen Presserats 1994 und 1996
- Durchsuchungsaktionen - Verstösse gegen das Zeugnisverweigerungsrecht
- Tierärztliches Standesrecht und Pressefreiheit - Schulterschlußgefahr?
- Stichwort “Diskriminierung” - Die Zeichen der Zeit erkannt
- Novellierung des Pressekodex - Konkretisierung der journalistischen Berufsethik
- Spruchpraxis 1994 und 1996
- Wahrheits- und Sorgfaltspflichten (Ziffern 1, 2 und 3)
- Persönlichkeitsbereich (Ziffern 8, 9 und 13)
- Diskriminierung und sittlich / religiöses Empfinden (Ziffern 10 und 12)
- Gewalt und Sensation (Ziffern 11 und 14)
- Trennungsgrundsatz (Ziffer 7)
- Verhaltensgebote (Ziffern 4, 5, 6 und 15)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rolle des Deutschen Presserats als freiwillige Instanz der publizistischen Selbstkontrolle im Spannungsfeld zwischen dem Ist-Zustand der Medienwelt und dem Soll-Zustand, den er zu fördern versucht. Ziel ist es, das Selbstverständnis des Deutschen Presserats zu erforschen und zu analysieren, ob seine Entscheidungen diesem Selbstverständnis entsprechen.
- Das Selbstverständnis des Deutschen Presserats und sein Journalistenbild
- Die Rolle der Selbstkontrolle in der Medienlandschaft
- Die Herausforderungen der Pressefreiheit in einer schnelllebigen Medienwelt
- Die Bedeutung des Pressekodex als ethischer Leitfaden für Journalisten
- Die Spruchpraxis des Deutschen Presserats im Kontext von Einzelfällen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und die Arbeitsweise des Deutschen Presserats. Es werden die grundlegenden Aufgaben und die Struktur des Rats vorgestellt sowie der Pressekodex erläutert. Im Anschluss wird die Plenumsarbeit des Deutschen Presserats im Jahr 1994 und 1996 beleuchtet, insbesondere in Bezug auf die Entscheidungen in einzelnen Fällen (Spruchpraxis). Die Analyse der Spruchpraxis konzentriert sich auf verschiedene Aspekte des Pressekodex, wie z.B. Wahrheits- und Sorgfaltspflichten, Persönlichkeitsrechte, Diskriminierung und Gewalt, sowie den Trennungsgrundsatz.
Schlüsselwörter
Deutscher Presserat, Selbstkontrolle, Pressefreiheit, Pressekodex, Journalismus, Medienethik, Spruchpraxis, Einzelfälle, Medienlandschaft, Medienentwicklung.
- Arbeit zitieren
- Robert Bongen (Autor:in), 1999, Verhaltensnormen für Journalisten. Pressekodex und Presserat, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/32608