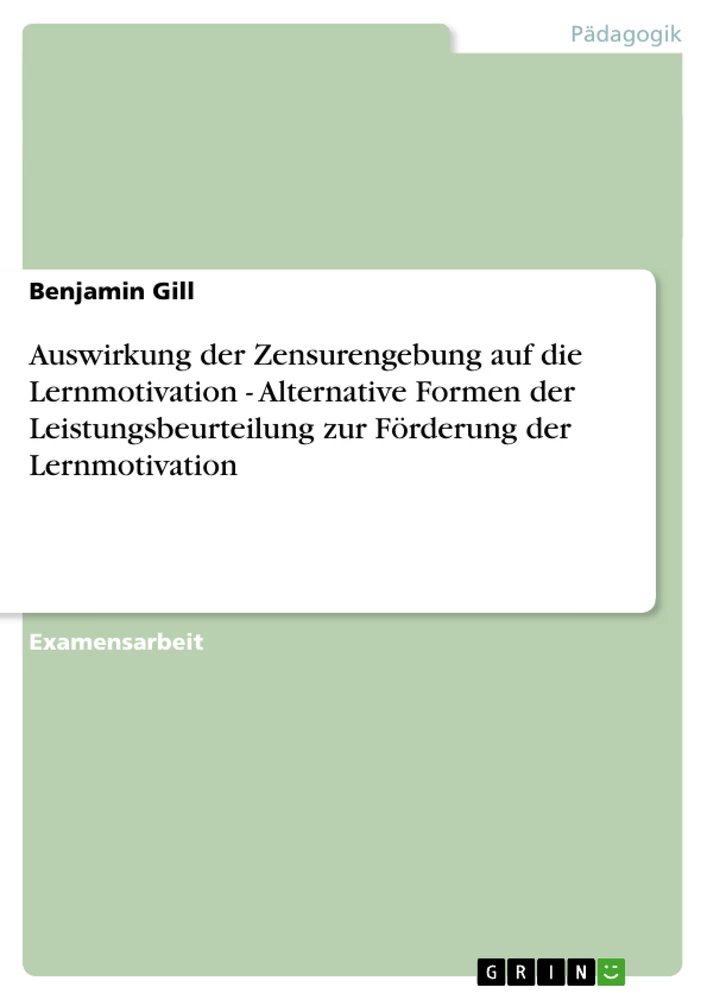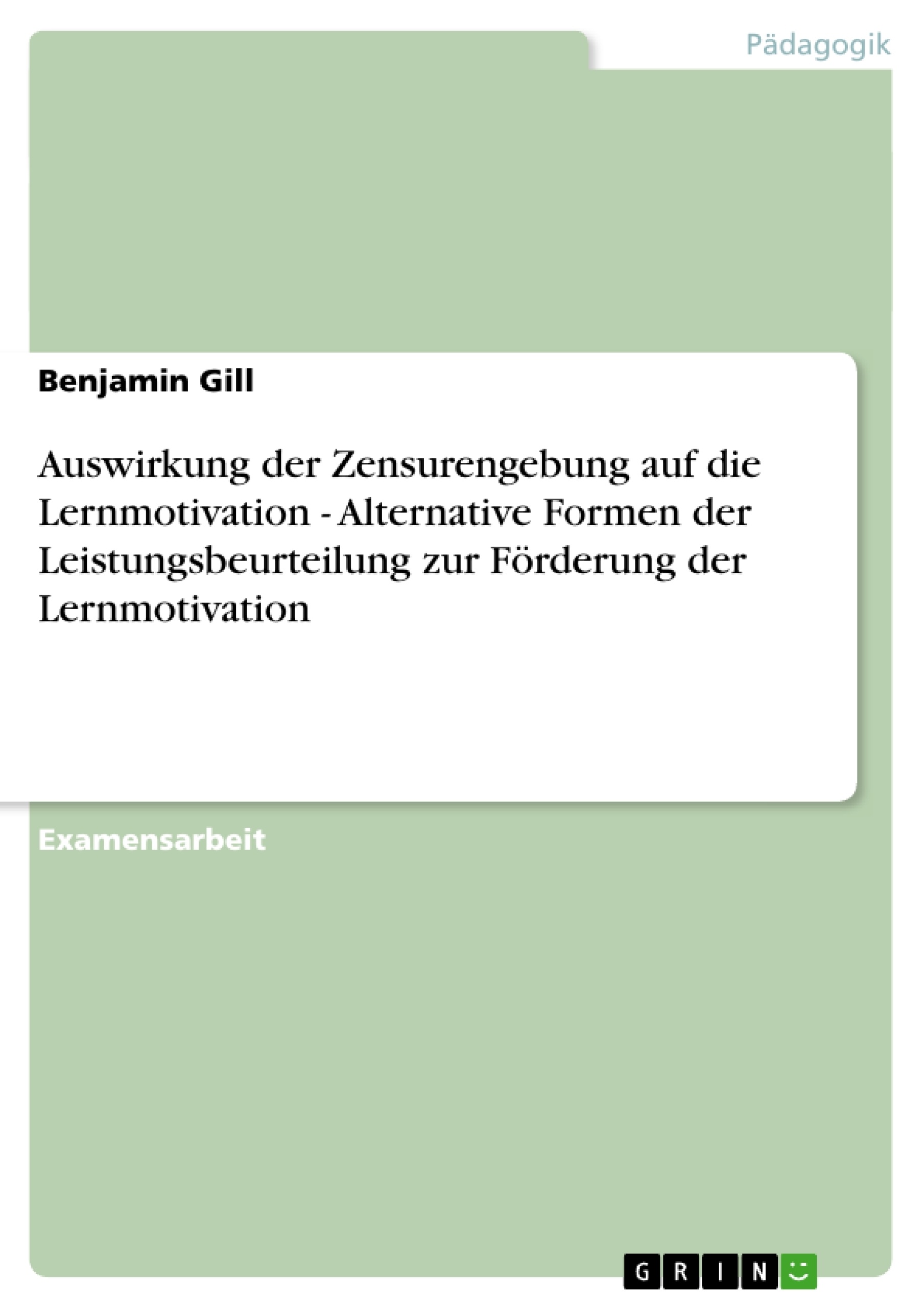Motivation bildet eine entscheidende Grundlage für das Lernen. Ohne Motivation würden wir nicht lernen. Der Mensch besitzt den intrinsischen Wunsch, seine Umwelt zu erforschen und zu verstehen. Er hat die natürliche Anlage, lernen und sich weiterentwickeln zu wollen. Die Motivation zur aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt ist bereits im frühen Stadium der Entwicklung gegeben und braucht keine Anleitungen oder äußere Zwänge. Sie bildet die wesentliche Grundlage für den Erwerb kognitiver Fähigkeiten. Besonders sichtbar wird es bei den jungen Grundschülern, die mit einer immensen Begeisterung und Faszination in die Schule kommen, um Lesen, Schreiben und Rechnen erlernen zu wollen. Das Lernen vollzieht sich von nun an in einer institutionalisierten Form und die Schule wird zum Ort des Lernens. Aus einem begeisterten und motivierten „Lernen-Wollen“ in den Anfangsjahren der Schulzeit wird in der Folge nicht selten ein wenig begeistertes und unmotiviertes „Lernen-Müssen“.
In meiner Arbeit möchte ich einen zentralen Punkt hervorheben, der wesentlichen Einfluss auf die Motivation und somit auch auf das Lernen hat. Leistungsbeurteilung, die sich in den meisten deutschen Schulen in Form einer Zensurengebung vollzieht, spielt meiner Meinung nach eine große Rolle in diesem Prozess. Das Lernen der Schüler wird in der Schule beurteilt und bewertet und mit einer Note dokumentiert.
Die zentrale Frage meiner Arbeit ist, welchen Einfluss diese Bewertung auf die Motivation und somit auf das Lernverhalten nimmt? Inwiefern greifen die Noten in den Lernprozess des Schülers ein? Inwieweit hemmen sie die Motivation und die effektive Lernleistung? Darf man die Zensurengebung absolut verurteilen oder kann sie sogar lernfördernd sein?
Meine persönlichen Erfahrungen mit der Zensurengebung führten im Laufe meiner Schulkarriere zu einer immer stärker werdenden Aversion gegen dieses System. Gerade im Rückblick auf meine Schulzeit hat sich die Schule vielmehr als ein Jagdterritorium nach guten Noten denn als ein Ort lustvollen und begeistert, motivierten Lernens in meiner Erinnerung gefestigt.
Schon Sir Karl POPPER beklagte 1975 die zu Karriereschlüsseln hochstilisierten Noten, weil „... dem Studenten nicht wirkliche Liebe für den Gegenstand und die Forschung eingeflößt wird, sondern weil er angeleitet wird, sich nur so viel an Wissen anzueignen, als zur Bewältigung der (Noten-) Hürden (...) unbedingt notwendig ist“.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. ELEMENTARE MOTIVATIONSPSYCHOLOGIE
- 2.1. Motivationstheoretische Konzepte
- 2.1.1. Triebtheoretische Auffassung von Motivation
- 2.1.2. Neugiermotivation
- 2.1.3. Intrinsische kontra extrinsische Motivation
- 2.1.4. Anreiztheoretischer Ansatz
- 2.1.5. Entscheidungstheoretische Konzepte
- 2.2. Leistungsmotivation
- 2.2.1. Risikowahl- Modell nach ATKINSON
- 2.2.2. Die Attributionstheorie von WEINER
- 2.2.3. Selbstbewertungsmodell nach HECKHAUSEN
- 3. STELLENWert der MotIVATION FÜR DAS LERNEN
- 3.1. Definition Lernmotivation
- 3.1.1. Modell nach HECKHAUSEN
- 3.1.2. Modell nach KRAPP
- 3.2. Abgrenzung der Lernmotivation von der Leistungsmotivation
- 3.3. Intrinsische Lernmotivation
- 3.3.1. Abgrenzung intrinsischer von extrinsischer Motivation
- 3.3.2. Effekte und Vorteile für das Lernen
- 3.4. Konzeptionen der intrinsischen Lernmotivation
- 3.4.1. Triebe ohne Triebreduktion
- 3.4.2. Zweckfreiheit
- 3.4.3. Optimalniveau von Aktivation oder Inkongruenz
- 3.4.4. Selbstbestimmung
- 3.4.5. Freudiges Aufgehen in einer Handlung
- 3.4.6. Handlungsziel
- 3.4.7. Analyse der Selbstbestimmungstheorie
- 4. LEISTUNGSBEURTEILUNG UND ZENSUREN
- 4.5. Geschichtlicher Überblick über den Leistungsbegriff und die Entstehung von Zensuren
- 4.6. Zur Funktion von Zensuren
- 4.6.1. Selektion und Stigmatisierung
- 4.6.2. Sozialisation
- 4.6.3. Kontrolle
- 4.6.4. Prognose
- 4.6.5. Information und Rückmeldung
- 4.6.6. Disziplinierung
- 4.6.7. Motivation/ Anreiz
- 4.6.8. Resümee
- 4.7. Theoretische Grundlagen des Beurteilens
- 4.3.1. Objektivität
- 4.3.2. Reliabilität
- 4.3.3. Validität
- 4.3.4. Resümee
- 4.8. Kritische Stellungnahme
- 5. EINFLUSS DER ZENSUREN AUF DIE LERNMOTIVATION
- 5.1. Zensurengebung und Selbstbestimmung
- 5.2. Korrumpierungseffekt bzw. Überveranlassungseffekt
- 5.3. Leistungsbeurteilung und Kausalattributionen
- 5.4. Zensuren als extrinsisches Motivationsinstrument
- 5.5. Ausblick
- 6. ALTERNATIVE BEURTEILUNGSFORMEN
- 6.1. Lehrerkommentare zu Noten
- 6.1.1. Kritische Stellungnahme
- 6.2. Benotung unter drei Bezugsnormen
- 6.2.1. Die soziale Bezugsnorm
- 6.2.1. Die sachliche Bezugsnorm
- 6.2.2. Die individuelle Bezugsnorm
- 6.2.3. Praktische Konsequenzen
- 6.3. Verbale Beurteilungen
- 6.3.1. Lernentwicklungsbericht
- 6.3.2. Kritische Stellungnahme
- 6.4. Schülerselbstbewertung
- 6.4.1. Formen der Selbstbeurteilung
- 6.4.2. Voraussetzungen für die Selbstbeurteilung
- 6.4.3. Dokumentation von Leistungen als Selbstbeurteilung
- 6.4.4. Grenzen der Selbstbeurteilung
- 6.4.5. Beispiele für Checklisten zur Selbstbeurteilung
- 6.4.6. Kritische Stellungnahme
- 6.5. Umgang mit Fehlern
- 6.5.1. Kritische Stellungnahme
- 6.6. Ausblick
- 7. ABSCHLIEBENDE BEMERKUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Hausarbeit analysiert die Auswirkungen der Zensurengebung auf die Lernmotivation von Schülern und beleuchtet die Möglichkeiten alternativer Leistungsbeurteilungsformen zur Förderung der Lernmotivation. Die Arbeit untersucht, wie sich die Zensurengebung auf die Selbstbestimmung, den Korrumpierungseffekt und die Kausalattributionen von Schülern auswirken kann. Sie befasst sich zudem mit den theoretischen Grundlagen der Leistungsbeurteilung und beleuchtet die Funktionen von Zensuren im Bildungssystem.
- Auswirkungen der Zensurengebung auf die Lernmotivation
- Alternative Leistungsbeurteilungsformen
- Selbstbestimmung, Korrumpierungseffekt und Kausalattributionen
- Theoretische Grundlagen der Leistungsbeurteilung
- Funktionen von Zensuren im Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsgegenstand und die Forschungsfrage der Arbeit einführt. Anschließend wird die elementare Motivationspsychologie behandelt, wobei verschiedene Motivationstheoretische Konzepte und die Leistungsmotivation erläutert werden. Im dritten Kapitel wird die Bedeutung der Motivation für das Lernen beleuchtet, insbesondere die Definition und Abgrenzung der Lernmotivation sowie die Analyse der intrinsischen Lernmotivation.
Kapitel 4 widmet sich der Leistungsbeurteilung und den Zensuren. Es gibt einen geschichtlichen Überblick über den Leistungsbegriff und die Entstehung von Zensuren, erläutert die Funktionen von Zensuren und beleuchtet die theoretischen Grundlagen des Beurteilens. Kapitel 5 analysiert den Einfluss der Zensuren auf die Lernmotivation, wobei die Aspekte Selbstbestimmung, Korrumpierungseffekt und Kausalattributionen im Vordergrund stehen.
Im sechsten Kapitel werden alternative Beurteilungsformen vorgestellt und kritisch beleuchtet, darunter Lehrerkommentare zu Noten, Benotung unter drei Bezugsnormen, verbale Beurteilungen, Schülerselbstbewertung und der Umgang mit Fehlern. Die Arbeit endet mit einer abschließenden Bemerkung, die die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfasst und einen Ausblick auf weitere Forschungsfragen gibt.
Schlüsselwörter
Lernmotivation, Leistungsbeurteilung, Zensuren, Selbstbestimmung, Korrumpierungseffekt, Kausalattributionen, Alternative Beurteilungsformen, Lernentwicklungsbericht, Schülerselbstbewertung, Umgang mit Fehlern.
- Arbeit zitieren
- Benjamin Gill (Autor:in), 2002, Auswirkung der Zensurengebung auf die Lernmotivation - Alternative Formen der Leistungsbeurteilung zur Förderung der Lernmotivation, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/32151