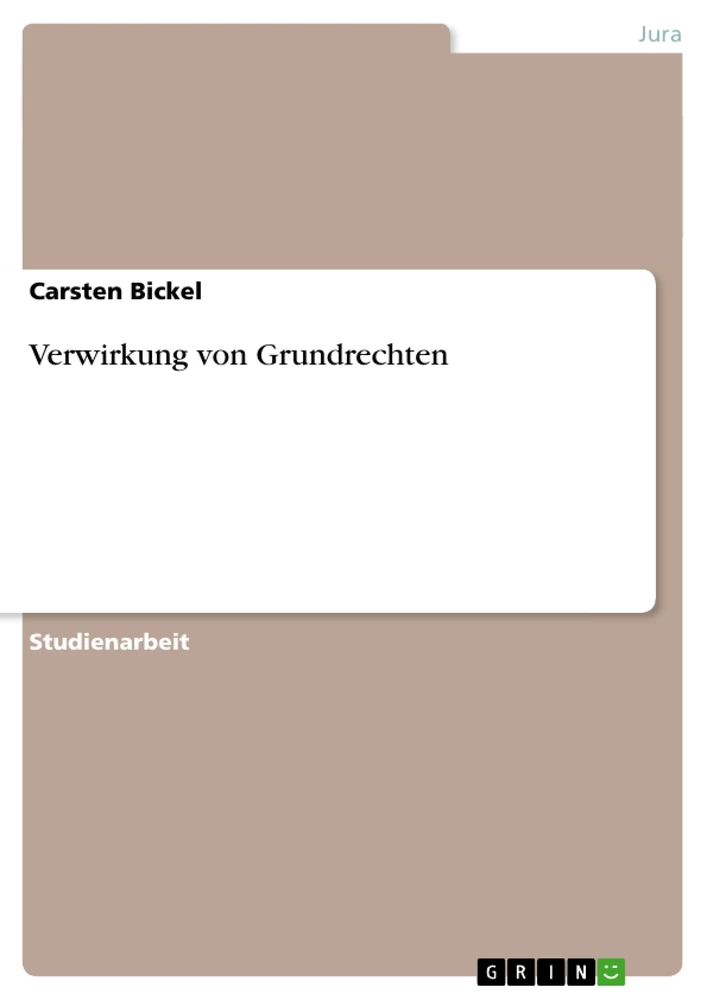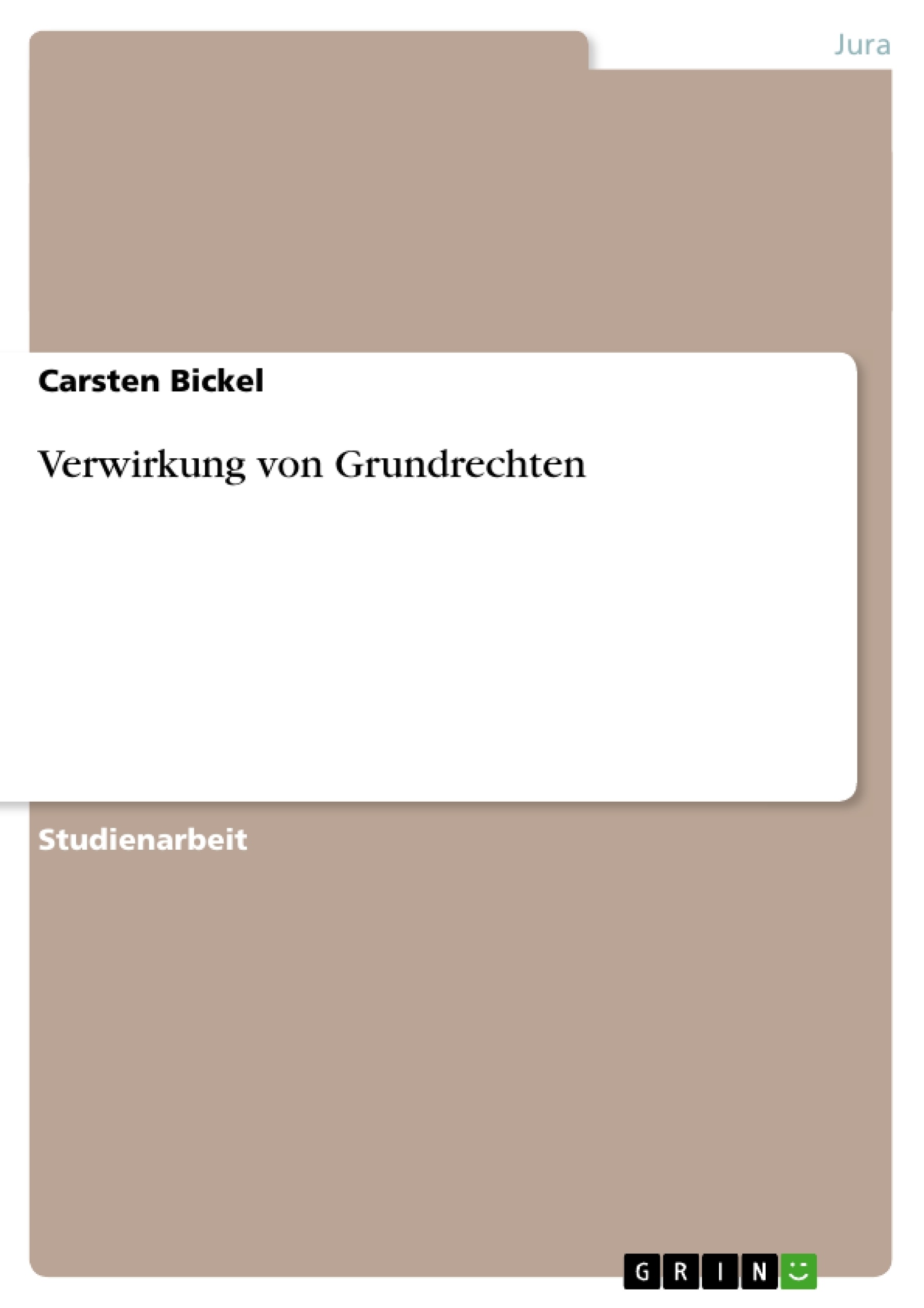Beinhaltet den Begriff der Grundrechte und die Möglichkeit der Verwirkung von Grundrechten. Enthält eine Diskussion über das Sicherheitsrisiko Mensch.
Recht ist ohne seine Geschichte nicht zu verstehen. Rechtliche Regelungen können einen längeren Atem als politischen Ordnungen haben. Die Grundrechte dagegen sind politisches Recht und unterliegen einem Abhängigkeitsverhältnis zur politischen Ordnung, die sie garantiert. Es ist eine Errungenschaft neuzeitlichen Denkens, das Menschenrechte als Grundrechte in einer Verfassung verankert wurden. Die Herausbildung von Grundrechten steht deshalb im Zusammenhang mit dem bürgerlichen Verfassungsstaat der Moderne. Der eigentliche Begriff der Grundrechte entstand als solcher um 1770 in Frankreich als „droits fondamentaux". Als Legitimierung einer bürgerlichen Ordnung wurden neben den natürlichen Menschenrechten auch sogenannte Gesellschaftsrechte in der Verfassung als Grundrechte verbürgt. Die Grundrechte sind Ausdruck individueller Freiheit in einer politischen Ordnung.
Inhaltsverzeichnis
- A. DIE GRUNDRECHTE
- I. ALLGEMEIN
- II. MENSCHENRECHTE
- III. BÜRGERRECHTE
- IV. DER URSPRUNG DER GRUNDRECHTE
- V. DIE GRUNDRECHTE DES GRUNDGESETZES
- B. DIE VERWIRKUNG VON GRUNDRECHTEN
- I. ENTSTEHUNGSGESCHICHTE
- II. SCHUTZGUT DES ART. 18
- III. SINN UND ZWECK DER VERWIRKUNG
- 1. Schutz der Freiheit auch gegenüber dem Bürger
- 2. Die wehrhafte Demokratie als Antwort auf Weimar und die Hitler-Diktatur
- IV. DER TATBESTAND DER VERWIRKUNG
- 1. Enumeration
- 2. Identitätslehre
- 3. Der Begriff der Verwirkung
- 4. Der Verwirkungsgegenstand
- 5. Die Verwirkungsfolge
- 6. Das Verwirkungsmonopol beim Bundesverfassungsgericht
- 7. Nebenfolge der Verwirkungsentscheidung
- 8. Gefährlichkeit
- 9. Verhältnismäßigkeit
- 10. Missbrauch
- 11. Kampf
- V. POLITISCHE UND TATSÄCHLICHE BEDEUTUNG DES ART. 18
- VI. DAS PROBLEM ASYLRECHT
- C. DAS MENSCHENBILD DES GRUNDGESETZES AUS ART. 18 GG
- I. SICHERHEIT BRINGT FREIHEIT?
- II. SICHERHEITSRISIKO MENSCH?
- III. SICHERHEITSFAKTOR MENSCH?
- IV. ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Verwirkung von Grundrechten im Kontext des deutschen Grundgesetzes. Sie beleuchtet die Entstehungsgeschichte dieses Konzepts, analysiert den Schutzbereich des Artikels 18 und erörtert Sinn und Zweck der Verwirkung von Grundrechten im Lichte der Geschichte und der wehrhaften Demokratie. Die Arbeit befasst sich auch mit dem Menschenbild des Grundgesetzes, das durch die Betrachtung des Artikels 18 GG reflektiert wird.
- Entstehungsgeschichte und Entwicklung des Konzepts der Grundrechtsverwirkung
- Schutzgut und Anwendungsbereich von Artikel 18 GG
- Sinn und Zweck der Grundrechtsverwirkung im Kontext der wehrhaften Demokratie
- Analyse des Tatbestands der Verwirkung von Grundrechten
- Das Menschenbild des Grundgesetzes im Spiegel von Artikel 18 GG
Zusammenfassung der Kapitel
A. DIE GRUNDRECHTE: Dieser Abschnitt legt den grundlegenden Rahmen für die spätere Diskussion der Grundrechtsverwirkung. Er behandelt die allgemeinen Prinzipien der Grundrechte, differenziert zwischen Menschen- und Bürgerrechten und beleuchtet ihren Ursprung und ihre Verankerung im Grundgesetz. Es wird eine systematische Einführung in das Thema Grundrechte gegeben, die für das Verständnis des folgenden Abschnitts über die Verwirkung essentiell ist. Die verschiedenen Kategorien und Ebenen der Grundrechte werden hier definiert und abgegrenzt, um eine klare Basis für die weitere Argumentation zu schaffen.
B. DIE VERWIRKUNG VON GRUNDRECHTEN: Dieser zentrale Abschnitt analysiert detailliert das Konzept der Grundrechtsverwirkung. Er beginnt mit der Entstehungsgeschichte, untersucht den Schutzbereich des Artikels 18 GG und erörtert ausführlich Sinn und Zweck dieser Regelung im Kontext der Geschichte und der wehrhaften Demokratie. Der Abschnitt geht dann auf den Tatbestand der Verwirkung ein, beleuchtet die verschiedenen Kriterien und Aspekte, die für die Feststellung einer Verwirkung relevant sind, und diskutiert die damit verbundenen Rechtsfolgen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei dem Verwirkungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts gewidmet.
C. DAS MENSCHENBILD DES GRUNDGESETZES AUS ART. 18 GG: Dieser Abschnitt verbindet die vorangegangenen Analysen mit einer philosophischen Betrachtung des Menschenbildes des Grundgesetzes. Ausgehend von Artikel 18 GG werden verschiedene Perspektiven auf das Verhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit beleuchtet. Es wird erörtert, ob der Mensch als Sicherheitsrisiko oder als Sicherheitsfaktor zu betrachten ist und welche Rolle dies für das Verständnis von Grundrechten und ihrer möglichen Verwirkung spielt. Der Abschnitt integriert die Ergebnisse der vorherigen Kapitel und bietet eine umfassende Synthese der Argumentation.
Schlüsselwörter
Grundrechte, Grundrechtsverwirkung, Artikel 18 GG, Wehrhafte Demokratie, Menschenbild, Grundgesetz, Sicherheit, Freiheit, Bundesverfassungsgericht, Rechtsfolgen, Entstehungsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Verwirkung von Grundrechten im Grundgesetz
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Verwirkung von Grundrechten im deutschen Grundgesetz, insbesondere Artikel 18 GG. Sie untersucht die historische Entwicklung, den Schutzbereich, Sinn und Zweck der Verwirkung sowie das damit verbundene Menschenbild des Grundgesetzes.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit deckt ein breites Spektrum ab: die Entstehungsgeschichte und Entwicklung des Konzepts der Grundrechtsverwirkung; den Schutzbereich und Anwendungsbereich von Artikel 18 GG; Sinn und Zweck der Grundrechtsverwirkung im Kontext der wehrhaften Demokratie; eine detaillierte Analyse des Tatbestands der Verwirkung von Grundrechten (inkl. Kriterien wie Enumeration, Identitätslehre, Verhältnismäßigkeit etc.); und schließlich eine philosophische Betrachtung des Menschenbildes des Grundgesetzes im Spiegel von Artikel 18 GG, beleuchtend das Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: A. DIE GRUNDRECHTE (grundlegende Einführung in Grundrechte, Abgrenzung von Menschen- und Bürgerrechten, Ursprung und Verankerung im Grundgesetz); B. DIE VERWIRKUNG VON GRUNDRECHTEN (detaillierte Analyse der Verwirkung, Entstehungsgeschichte, Schutzbereich von Art. 18 GG, Sinn und Zweck, Tatbestand der Verwirkung, Rolle des Bundesverfassungsgerichts); C. DAS MENSCHENBILD DES GRUNDGESETZES AUS ART. 18 GG (philosophische Betrachtung des Menschenbildes im Grundgesetz im Kontext von Sicherheit und Freiheit).
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Grundrechte, Grundrechtsverwirkung, Artikel 18 GG, Wehrhafte Demokratie, Menschenbild, Grundgesetz, Sicherheit, Freiheit, Bundesverfassungsgericht, Rechtsfolgen, Entstehungsgeschichte.
Welchen Zweck verfolgt die Analyse von Artikel 18 GG?
Die Analyse von Artikel 18 GG dient dazu, das Konzept der Grundrechtsverwirkung umfassend zu verstehen. Es geht darum, die historischen Hintergründe, die rechtlichen Grundlagen und die philosophischen Implikationen dieser wichtigen Regelung im Kontext des deutschen Grundgesetzes zu beleuchten.
Welche Rolle spielt die „wehrhafte Demokratie“?
Die „wehrhafte Demokratie“ spielt eine entscheidende Rolle im Verständnis des Sinns und Zwecks der Grundrechtsverwirkung. Sie liefert den historischen und politischen Kontext, in dem die Möglichkeit der Grundrechtsverwirkung entstanden ist und begründet wird.
Welche Bedeutung hat das Bundesverfassungsgericht?
Das Bundesverfassungsgericht hat ein Monopol auf die Entscheidung über die Verwirkung von Grundrechten. Seine Rolle und Entscheidungsfindung sind daher zentral für die Anwendung von Artikel 18 GG.
Wie wird das Menschenbild des Grundgesetzes dargestellt?
Die Arbeit untersucht das Menschenbild des Grundgesetzes, indem sie das Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit im Kontext von Artikel 18 GG beleuchtet. Es werden verschiedene Perspektiven darauf diskutiert, ob der Mensch als Sicherheitsrisiko oder Sicherheitsfaktor betrachtet werden sollte.
- Arbeit zitieren
- Carsten Bickel (Autor:in), 2004, Verwirkung von Grundrechten, München, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/31983