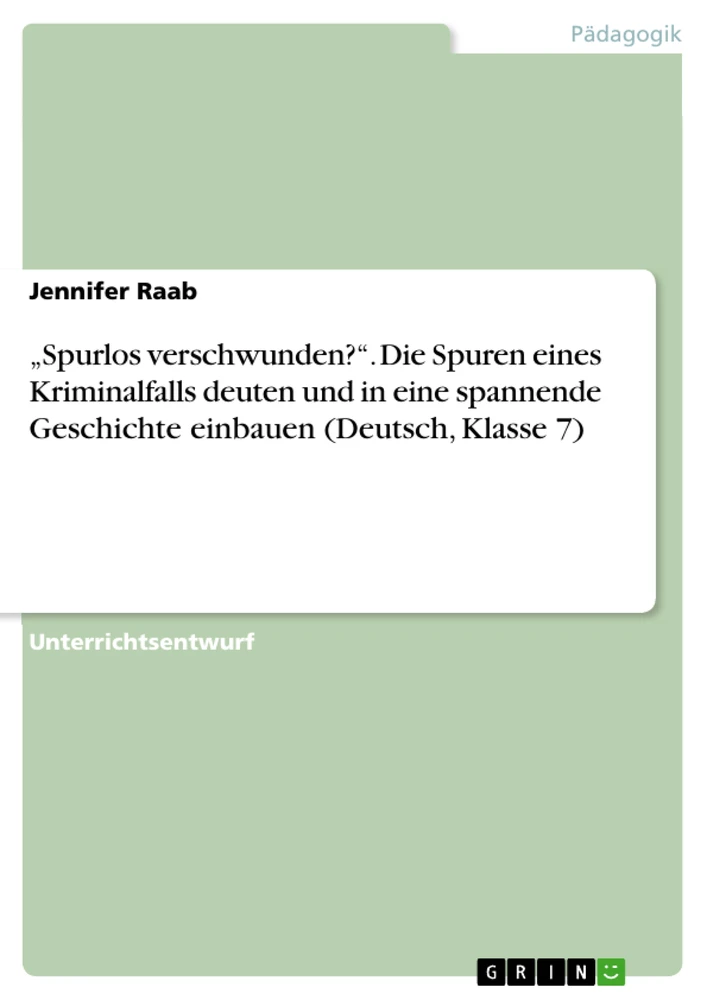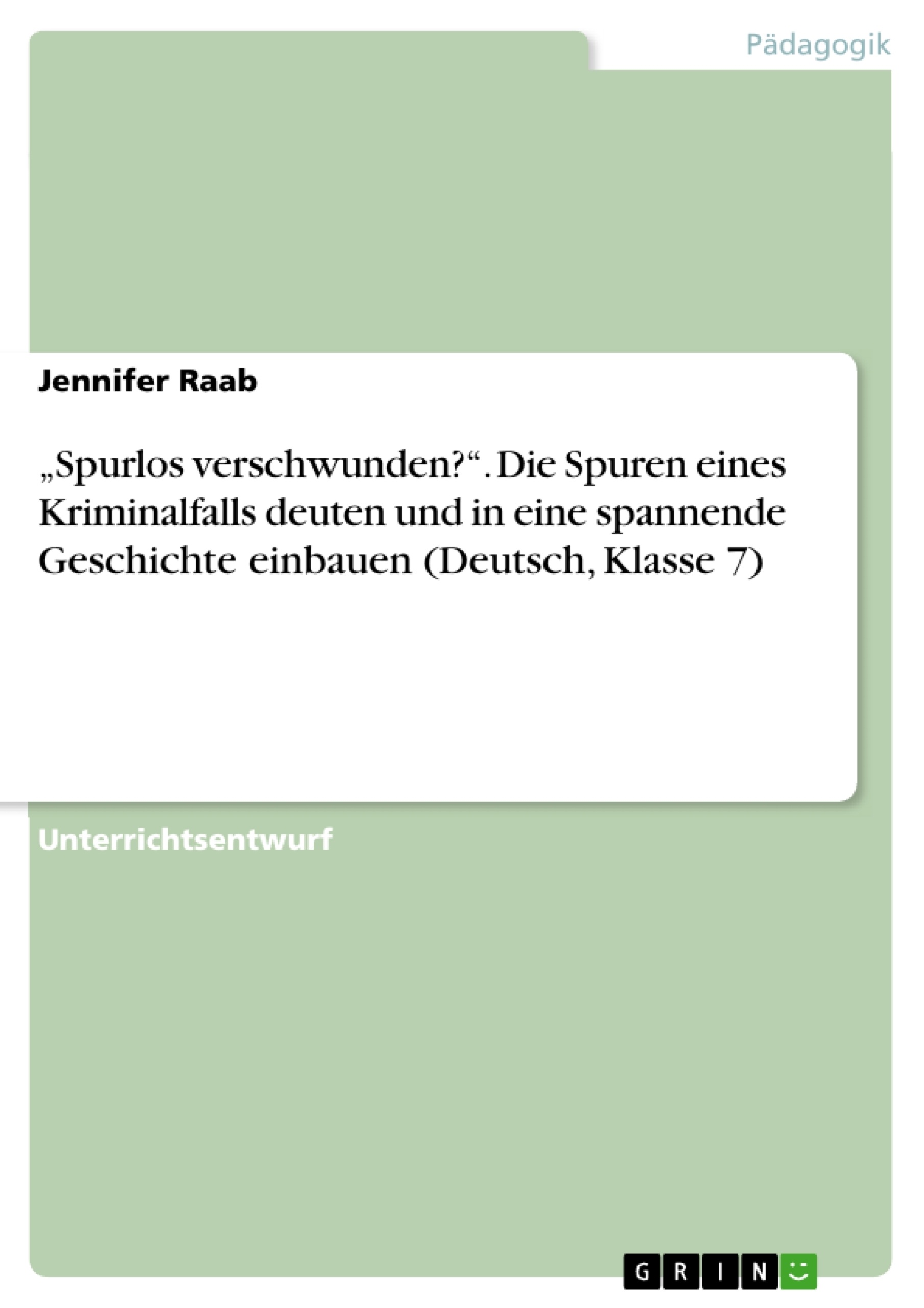Die Lernenden erweitern ihre Lese- und Rezeptionskompetenz, indem sie zu dem Beginn einer Kriminalgeschichte Spuren eines Verschwindens deuten, eigene Vermutungen zum Geschehen entwickeln und auf dieser Grundlage eine spannende Geschichte verfassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit
- 2. Lernvoraussetzungen
- 2.1 Allgemeine Lernvoraussetzungen
- 2.2 Institutionelle Lernvoraussetzungen
- 2.3 Spezielle Lernvoraussetzungen
- 3. Sachanalyse
- 4. Didaktische Überlegungen
- 5. Methodische Überlegungen
- 6. Angestrebter Kompetenzzuwachs
- 7. Verlaufsplan
- 8. Literatur- und Quellenangaben
- 9. Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Unterrichtseinheit ist die Erweiterung der Lese- und Rezeptionskompetenz sowie der Schreibkompetenz der Schüler im Bereich Kriminalgeschichten. Die Schüler sollen lernen, textspezifische Merkmale von Kriminalgeschichten zu erkennen, Indizien zu deuten, Handlungsmotive zu analysieren und eigene Kriminalgeschichten zu verfassen.
- Analyse von Kriminalgeschichten als Textsorte
- Deutung von Spuren und Indizien in Kriminalfällen
- Analyse von Handlungsmotiven der Figuren
- Entwicklung kreativer Schreibkompetenz im Bereich Kriminalgeschichten
- Förderung der kognitiven Fähigkeiten (Hypothesenbildung)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Stellung der Stunde in der Unterrichtseinheit: Diese Einleitung beschreibt den Kontext der Unterrichtsstunde innerhalb der gesamten Einheit "Dem Täter auf der Spur". Sie erläutert, wie die Stunde die zuvor erworbenen Fähigkeiten der Schüler im Umgang mit Kriminalgeschichten erweitert, indem sie die Kompetenz des Deuten von Spuren und des Schreibens einer eigenen Kriminalgeschichte im Fokus hat. Die Stunde baut auf dem bereits erarbeiteten Wissen über Merkmale und Aufbau von Kriminalgeschichten auf und bereitet die Schüler auf das spätere Verfassen eigener Geschichten vor.
2. Lernvoraussetzungen: Dieser Abschnitt analysiert die Lernvoraussetzungen der Schüler, unterteilt in allgemeine, institutionelle und spezielle Voraussetzungen. Die allgemeine Analyse beschreibt die Heterogenität der Lerngruppe in Bezug auf Leistungsfähigkeit und -bereitschaft, das positive Lehrer-Schüler-Verhältnis und das Interesse der Schüler am Fach Deutsch. Die institutionellen Voraussetzungen befassen sich mit dem Klassenraum und den verfügbaren Ressourcen. Die speziellen Voraussetzungen betrachten die bereits erworbenen Kenntnisse der Schüler über Kriminalgeschichten und deren bisherigen Schreibfertigkeiten. Es wird deutlich, dass die Schüler unterschiedliche Lernbedürfnisse haben und eine differenzierte Unterrichtsgestaltung notwendig ist.
3. Sachanalyse: Dieses Kapitel analysiert Kriminalgeschichten als Textsorte und den konkreten Fall des Hörspielanfangs, der als Grundlage für die Schreibaufgabe der Schüler dient. Es werden verschiedene Definitionen von Kriminalgeschichten und deren Merkmale erläutert. Die Schüler sollen eine Geschichte schreiben, die auf dem Hörspielanfang basiert und ihre eigenen Interpretationen der Spuren und möglichen Ursachen des Verschwindens eines Rugbyspielers miteinbezieht. Der Abschnitt erklärt den Ansatz des handlungs- und produktionsorientierten Literaturunterrichts und die Bedeutung der Vorstellungskraft und Kreativität im Prozess der Textanalyse und -produktion.
4. Didaktische Überlegungen: Dieser Abschnitt verbindet die Unterrichtsstunde mit den Bildungsstandards und Inhaltsfeldern des Mittleren Schulabschlusses. Es wird betont, dass die Stunde sowohl Lese- als auch Schreibkompetenzen fördert und somit einen integrativen Deutschunterricht darstellt. Die Relevanz des Themas Kriminalgeschichten für die Schüler wird hervorgehoben und die didaktische Reduktion des Hörspiels zur Fokussierung wichtiger Informationen erläutert. Es werden Möglichkeiten zur Differenzierung der Schreibaufgabe angesprochen.
Schlüsselwörter
Kriminalgeschichten, Textsortenanalyse, Spureninterpretation, Handlungsmotive, Schreibkompetenz, Leseverstehen, Integrativer Deutschunterricht, Produktionsorientierter Unterricht, Hypothesenbildung, Differenzierung
Häufig gestellte Fragen zum Unterrichtsentwurf "Dem Täter auf der Spur"
Was ist der Hauptfokus dieser Unterrichtseinheit?
Die Unterrichtseinheit konzentriert sich auf die Erweiterung der Lese- und Rezeptionskompetenz sowie der Schreibkompetenz der Schüler im Bereich Kriminalgeschichten. Die Schüler sollen lernen, textspezifische Merkmale von Kriminalgeschichten zu erkennen, Indizien zu deuten, Handlungsmotive zu analysieren und eigene Kriminalgeschichten zu verfassen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Einheit behandelt die Analyse von Kriminalgeschichten als Textsorte, die Deutung von Spuren und Indizien, die Analyse von Handlungsmotiven, die Entwicklung kreativer Schreibkompetenz im Bereich Kriminalgeschichten und die Förderung kognitiver Fähigkeiten (Hypothesenbildung).
Wie ist der Unterrichtsentwurf strukturiert?
Der Entwurf gliedert sich in verschiedene Kapitel: Stellung der Stunde in der Einheit, Lernvoraussetzungen (allgemein, institutionell, speziell), Sachanalyse (Kriminalgeschichten als Textsorte), didaktische Überlegungen, methodische Überlegungen, angestrebter Kompetenzzuwachs, Verlaufsplan, Literatur- und Quellenangaben und Anhang. Der Entwurf enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel und Schlüsselwörter.
Welche Lernvoraussetzungen werden berücksichtigt?
Der Entwurf berücksichtigt allgemeine Lernvoraussetzungen (Heterogenität der Lerngruppe, Lehrer-Schüler-Verhältnis, Interesse am Fach), institutionelle Lernvoraussetzungen (Klassenraum, Ressourcen) und spezielle Lernvoraussetzungen (vorherige Kenntnisse über Kriminalgeschichten und Schreibfertigkeiten). Die unterschiedlichen Lernbedürfnisse der Schüler und die Notwendigkeit einer differenzierten Unterrichtsgestaltung werden hervorgehoben.
Wie wird die Sachanalyse durchgeführt?
Die Sachanalyse untersucht Kriminalgeschichten als Textsorte und einen konkreten Fall (Hörspielanfang), der als Grundlage für eine Schreibaufgabe dient. Verschiedene Definitionen und Merkmale von Kriminalgeschichten werden erläutert. Der handlungs- und produktionsorientierte Literaturunterricht und die Bedeutung von Vorstellungskraft und Kreativität werden betont.
Welche didaktischen Überlegungen stehen im Mittelpunkt?
Die didaktischen Überlegungen verbinden die Unterrichtsstunde mit den Bildungsstandards und Inhaltsfeldern des Mittleren Schulabschlusses. Die Förderung von Lese- und Schreibkompetenzen und die Relevanz des Themas für die Schüler werden hervorgehoben. Die didaktische Reduktion des Hörspiels und Möglichkeiten zur Differenzierung der Schreibaufgabe werden angesprochen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Unterrichtsentwurf?
Schlüsselwörter sind: Kriminalgeschichten, Textsortenanalyse, Spureninterpretation, Handlungsmotive, Schreibkompetenz, Leseverstehen, integrativer Deutschunterricht, produktionsorientierter Unterricht, Hypothesenbildung und Differenzierung.
Welchen Kompetenzzuwachs soll die Einheit bewirken?
Die Einheit zielt auf einen Kompetenzzuwachs in der Analyse von Kriminalgeschichten, der Deutung von Indizien, der Analyse von Handlungsmotiven und der Entwicklung kreativer Schreibkompetenzen ab. Die Schüler sollen ihre Lese- und Rezeptionskompetenz verbessern und eigene Kriminalgeschichten verfassen können.
- Quote paper
- Jennifer Raab (Author), 2014, „Spurlos verschwunden?“. Die Spuren eines Kriminalfalls deuten und in eine spannende Geschichte einbauen (Deutsch, Klasse 7), Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/319615