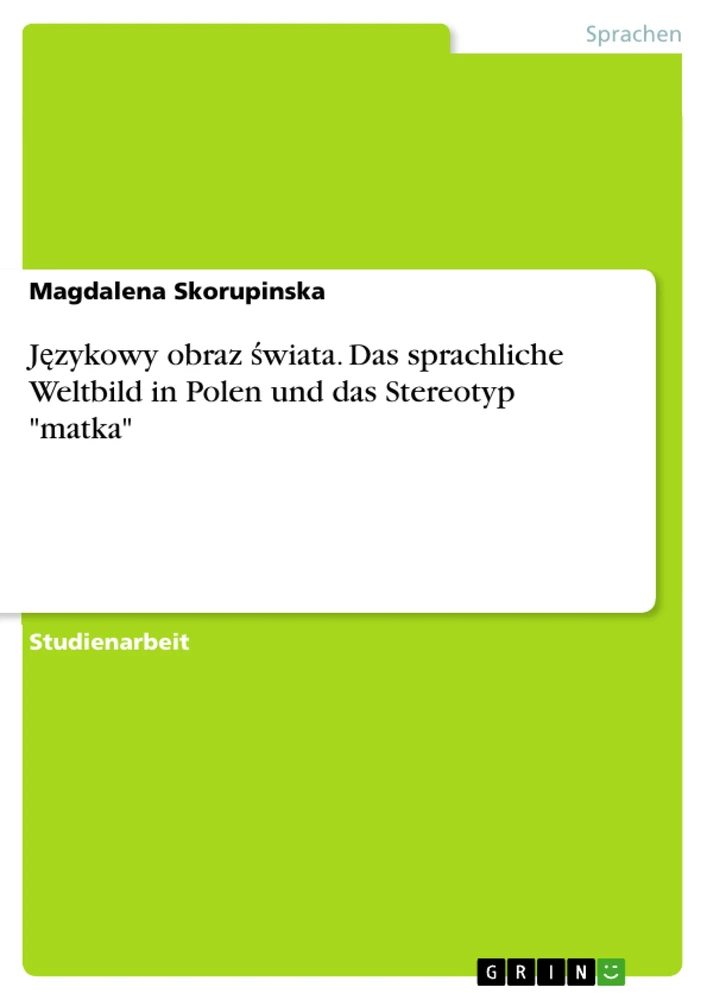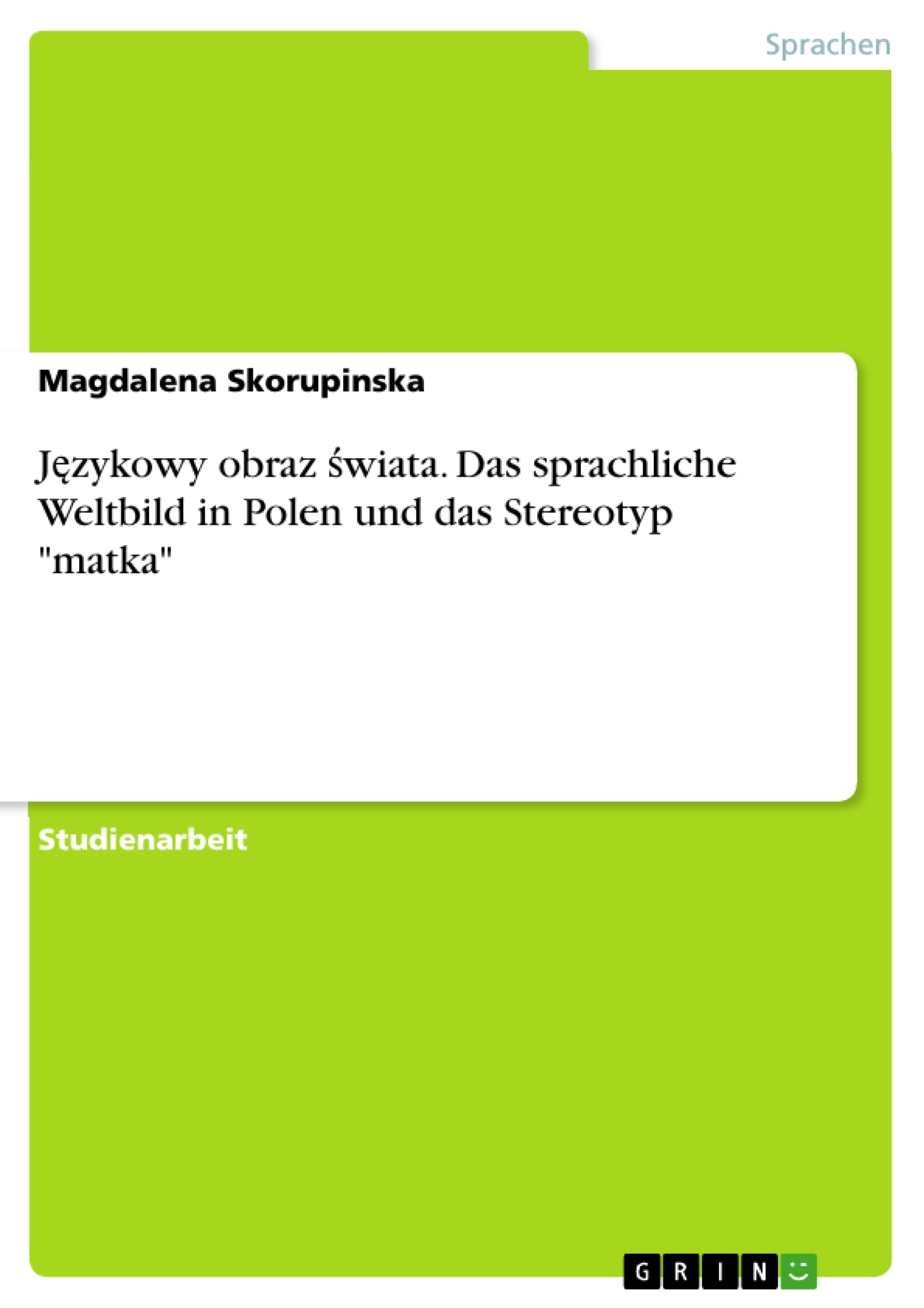Die Theorie von dem sprachlichen Weltbild hat eine langjährige Geschichte hinter sich, Gelehrte und Linguisten der letzten Jahrhunderte setzten sich mit der Auffassung von der sprachlichen Weltansicht auseinander. Die folgende Arbeit behandelt diese Thematik, indem sie an den linguistischen Ideen von Wilhelm von Humboldt und den Inhalten der Sapir-Whorf-Hypothese ansetzt und über die linguistische Semantik und ihre kulturellen Aspekte zu dem Konzept des sprachlichen Weltbildes in Polen gelangt.
Im Rahmen der Auseinandersetzung mit den Zusammenhängen, die zwischen der Sprache und Kultur bestehen, werden Methoden und Aspekte der Kultursemantik vorgestellt. Des Weiteren wird das polnische Konzept von "Językowy obraz świata", also dem sprachlichen Weltbild, mit seinen Grundlagen und Erkenntnissen, dargelegt. Schließlich wendet sich die Arbeit der polnischen sprachlichen Weltsicht zu und setzt sich mit dem Stereotyp von „matka“ in der polnischen Kultur auseinander.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehungsgeschichte
- Wilhelm von Humboldt
- Sapir-Whorf-Hypothese
- Die linguistische Semantik und ihre kulturellen Aspekte
- Semantisches Primitivum
- Natürlichsprachliche Metasprache
- Das Konzept „soul“, „mind“, „heart“, „duša“
- Das sprachliche Weltbild - Językowy obraz świata
- Sprachliche Stereotype
- Das polnische Stereotyp „matka“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Theorie des sprachlichen Weltbildes, indem sie die linguistischen Ideen von Wilhelm von Humboldt und die Sapir-Whorf-Hypothese analysiert und diese mit dem polnischen Konzept von „Językowy obraz świata“ verbindet. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur und präsentiert Aspekte der Kultursemantik.
- Die Entwicklung des Konzepts des sprachlichen Weltbildes
- Der Einfluss von Humboldt und der Sapir-Whorf-Hypothese
- Die Rolle der linguistischen Semantik in der Kultur
- Das polnische Verständnis des sprachlichen Weltbildes
- Analyse eines sprachlichen Stereotyps im Polnischen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des sprachlichen Weltbildes ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie erwähnt die langjährige Beschäftigung von Gelehrten und Linguisten mit diesem Thema und kündigt die Auseinandersetzung mit den Ideen von Wilhelm von Humboldt, der Sapir-Whorf-Hypothese und dem polnischen Konzept des sprachlichen Weltbildes an. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur, sowie der Vorstellung von Methoden und Aspekten der Kultursemantik und der Analyse des polnischen Stereotyps "matka".
2. Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln des Konzepts des sprachlichen Weltbildes, beginnend mit möglichen Ansätzen in der Rhetorik des Aristoteles bis hin zur französischen und italienischen Aufklärung. Es hebt die entscheidende Rolle Wilhelm von Humboldts bei der Prägung des Begriffs "Weltansicht" hervor und betont den Einfluss auf Leon Weisgerber. Der Beitrag der Sapir-Whorf-Hypothese wird als wesentlicher Bestandteil der Theorie des sprachlichen Weltbildes dargestellt, wobei die bedeutende Rolle deutscher linguistischer und philosophischer Ideen im Kontext des Verhältnisses von Sprache und Kultur herausgestellt wird. Die deutschen Sprachforscher Herder, Weisgerber, Gipper und insbesondere Humboldt werden als Schlüsselfiguren genannt. Der Einfluss Humboldts auf die Sapir-Whorf-Hypothese wird detailliert erläutert.
2.1. Wilhelm von Humboldt: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Wilhelm von Humboldts Beitrag zur Theorie des sprachlichen Weltbildes. Es beschreibt Humboldt's Vorstellung von Sprache als geistigen Organismus, der menschliche Erfahrungen vereint und zu Gedanken formt. Die Betonung liegt auf dem Unterschied der Weltansichten, die durch die Verschiedenheit der Sprachen entstehen. Humboldts Konzepte der inneren und äußeren Sprachform werden erklärt, sowie der Einfluss von Kant und Hegel auf seine Theorien. Humboldt’s Betonung des dynamischen, energetischen Charakters der Sprache und der Vorstellung, dass die Spracherwerbung beim Kind die Weltsicht prägt, sind zentrale Punkte dieses Kapitels. Die kulturbedingte Natur der Sprache und ihre Rolle bei der Erschaffung der Welt werden diskutiert.
2.2. Sapir-Whorf-Hypothese: Dieses Kapitel beschreibt die Forschungsarbeiten von Edward Sapir und Benjamin Lee Whorf und deren Korrespondenz mit Humboldts Auffassungen. Es betont die interdisziplinäre Natur ihrer Arbeit, die Anthropologie und Linguistik vereint. Die Sprache wird als kulturelles Mittel zur Kommunikation verstanden, welches die Erkennungsprozesse formt und ein bestimmtes Weltbild prägt. Die Sapir-Whorf-Hypothese wird als eine der größten Errungenschaften der Anthropolinguistik und Kulturlinguistik bezeichnet. Die Kapitel erläutert die zentralen Aussagen der Hypothese, nämlich die sprachliche Relativität und den sprachlichen Determinismus, und diskutiert die wissenschaftlichen Kontroversen um diese Aussagen. Der Einfluss der Muttersprache auf das Verhalten und die Wahrnehmung der Sprecher wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Sprachliches Weltbild, Językowy obraz świata, Wilhelm von Humboldt, Sapir-Whorf-Hypothese, linguistische Semantik, Kultursemantik, Sprachliche Relativität, Sprachlicher Determinismus, polnische Sprache, kulturelle Stereotype, „matka“.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Sprachliches Weltbild
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text befasst sich umfassend mit dem Konzept des „sprachlichen Weltbildes“, insbesondere im Kontext der polnischen Sprache und Kultur. Er analysiert die Entstehung und Entwicklung dieses Konzepts, die Beiträge von Wilhelm von Humboldt und der Sapir-Whorf-Hypothese, und untersucht den Zusammenhang zwischen Sprache, Kultur und der Formierung von Weltbildern.
Welche zentralen Theorien werden behandelt?
Die Arbeit analysiert die Theorie des sprachlichen Weltbildes, indem sie die linguistischen Ideen von Wilhelm von Humboldt und die Sapir-Whorf-Hypothese untersucht. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem polnischen Verständnis des sprachlichen Weltbildes („Językowy obraz świata“).
Welche Rolle spielt Wilhelm von Humboldt?
Wilhelm von Humboldt wird als Schlüsselfigur für die Entwicklung des Konzepts des sprachlichen Weltbildes dargestellt. Seine Vorstellung von Sprache als geistigem Organismus, der menschliche Erfahrungen formt und zu Gedanken führt, sowie seine Konzepte der inneren und äußeren Sprachform werden detailliert erläutert. Sein Einfluss auf spätere Theorien, insbesondere die Sapir-Whorf-Hypothese, wird hervorgehoben.
Was ist die Bedeutung der Sapir-Whorf-Hypothese im Kontext des Textes?
Die Sapir-Whorf-Hypothese wird als ein wesentlicher Bestandteil der Theorie des sprachlichen Weltbildes präsentiert. Der Text erläutert die zentralen Aussagen der Hypothese (sprachliche Relativität und sprachlicher Determinismus) und diskutiert die wissenschaftlichen Kontroversen darum. Der Einfluss der Muttersprache auf das Verhalten und die Wahrnehmung der Sprecher wird hervorgehoben, wobei der Zusammenhang mit Humboldts Ideen betont wird.
Wie wird das polnische Konzept „Językowy obraz świata“ behandelt?
Der Text verbindet die allgemeinen Theorien des sprachlichen Weltbildes mit dem spezifischen polnischen Kontext („Językowy obraz świata“). Er untersucht, wie das polnische Verständnis des sprachlichen Weltbildes die kulturellen Aspekte der Sprache widerspiegelt und analysiert ein polnisches sprachliches Stereotyp ("matka").
Welche Aspekte der linguistischen Semantik werden behandelt?
Der Text beleuchtet den Zusammenhang zwischen linguistischer Semantik und kulturellen Aspekten. Konzepte wie semantische Primitiva, natürlichsprachliche Metasprachen und die Analyse von Begriffen wie „soul“, „mind“, „heart“, „duša“ werden im Kontext des sprachlichen Weltbildes untersucht.
Welche Kapitel umfasst der Text und worum geht es in jedem Kapitel?
Der Text gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Entstehungsgeschichte (mit Unterkapiteln zu Humboldt und der Sapir-Whorf-Hypothese), ein Kapitel zur linguistischen Semantik und kulturellen Aspekten, ein Kapitel zum sprachlichen Weltbild und seinen Manifestationen im Polnischen und ein Fazit. Die Kapitelzusammenfassungen liefern detaillierte Informationen zu den jeweiligen Inhalten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Text?
Schlüsselwörter sind: Sprachliches Weltbild, Językowy obraz świata, Wilhelm von Humboldt, Sapir-Whorf-Hypothese, linguistische Semantik, Kultursemantik, Sprachliche Relativität, Sprachlicher Determinismus, polnische Sprache, kulturelle Stereotype, „matka“.
Für wen ist dieser Text gedacht?
Der Text ist für ein akademisches Publikum konzipiert, das sich für Linguistik, Kulturwissenschaften und die Theorie des sprachlichen Weltbildes interessiert. Die umfassende Darstellung der Theorie und die Analyse des polnischen Kontextes machen ihn besonders relevant für Linguisten und Kulturwissenschaftler.
- Quote paper
- Magdalena Skorupinska (Author), 2012, Językowy obraz świata. Das sprachliche Weltbild in Polen und das Stereotyp "matka", Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/317289