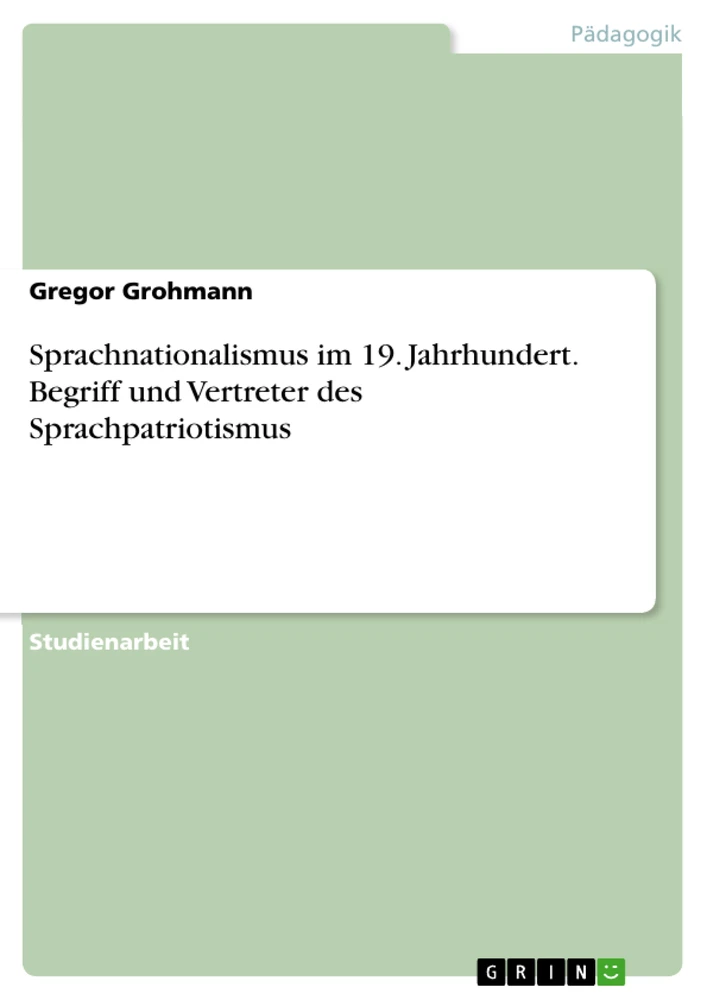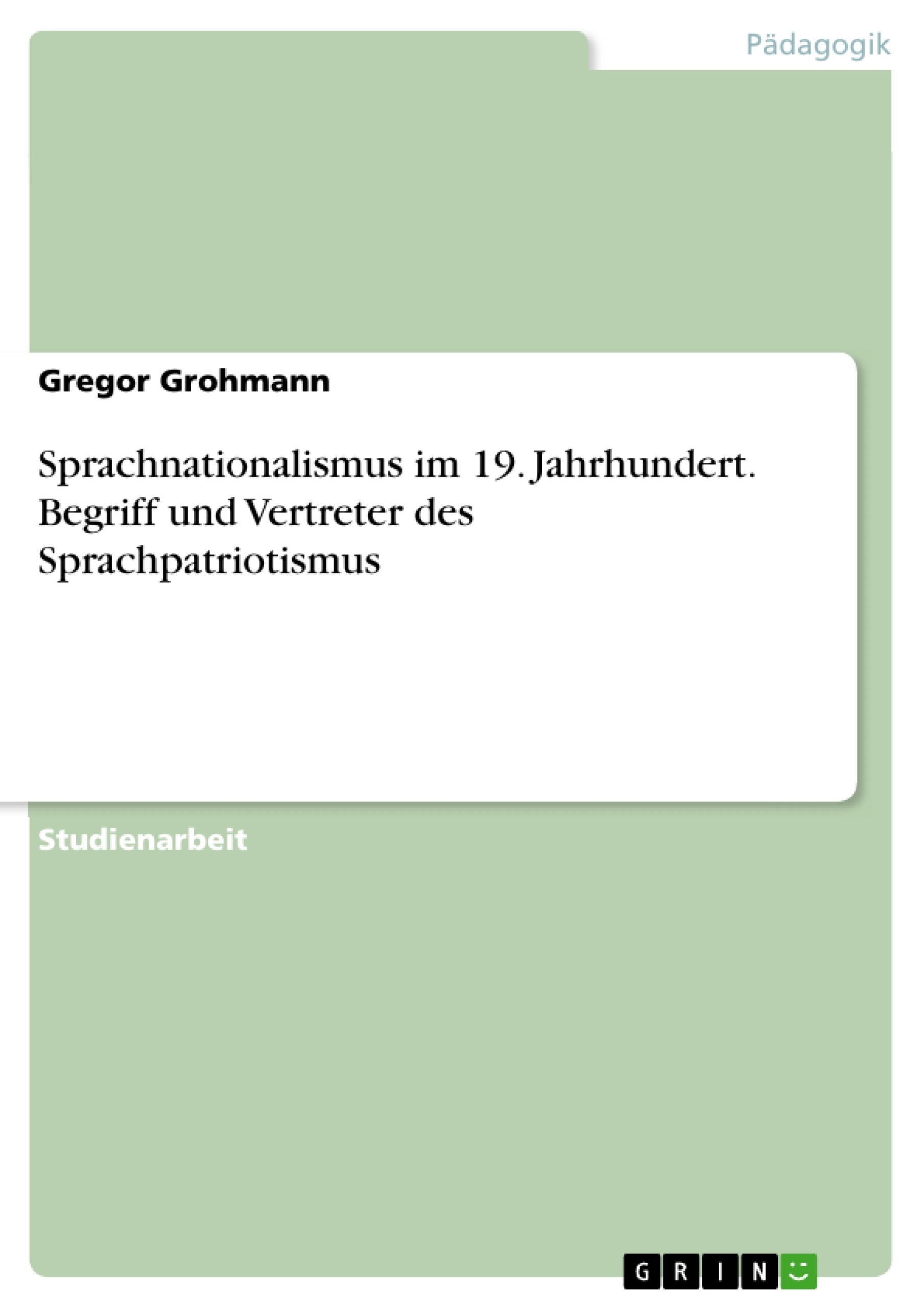Die folgende Arbeit widmet sich der Sprachkritik und dem damit einhergehenden Sprachnationalismus. Was versteht man unter diesen beiden Begriffen? Welche äußeren Umstände führten zu den Beweggründen, Sprache mit nationalistischem Eifer vertreten zu müssen?
Diese Fragestellungen sollen im Verlauf der Arbeit unter besonderer Berücksichtigung des historischen Kontextes in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts behandelt werden. Anhand der Begrifflichkeiten Sprachnationalismus und Sprachpatriotismus sollen weitere Vertreter dieser Strömung zum genannten Zeitraum behandelt werden.
Zu Beginn der Arbeit wird zuerst der Forschungsstand kurz aus der Sicht der germanistischen Sprachwissenschaft offengelegt, dessen Erkenntnisse die Grundlage der in Kapitel 2 folgenden Textanalyse bilden. Neben Ernst Moritz Arndt werden dabei zum Vergleich Texte von Johann Gottlieb Fichte sowie Friedrich Ludwig Jahn herangezogen. Anschließend erfolgt die zeitliche Einordnung der Betrachtung in den historischen Kontext für mögliche Gründe, die zu einer Nationalisierung der Sprache geführt haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Sprachnationalismus als Begriff und Arbeitsausblick
- Forschungsstand der gegenwärtigen Arbeit
- Umgang mit den fachsprachlichen Termini – Merkmale
- Beeinflussung der Sprache auf den Menschen
- Das lange 19. Jh. kurz erfasst – Revolution, Industrialisierung, Vormärz ...
- Der Sprachnationalismus anhand ausgewählter Vertreter
- Ernst Moritz Arndt – über Volk, Nation, Hass und Sprache
- Ein kurzer Blick zu Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Ludwig Jahn
- Zusammenfassung: langfristige Auswirkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung des Sprachnationalismus im frühen 19. Jahrhundert, insbesondere im Kontext der Befreiungskriege von 1813-1815. Sie untersucht, wie die Verbindung von Volk und Sprache von den Protagonisten dieser Zeit wahrgenommen und interpretiert wurde, und welche Auswirkungen diese Ideologie auf die Sprachentwicklung hatte.
- Die Verbindung zwischen Sprache und nationaler Identität
- Die Rolle des Sprachnationalismus in der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts
- Die Bedeutung von Sprache als Ausdruck von Kultur und Identität
- Die Auswirkungen von Sprachnationalismus auf die Entwicklung der deutschen Sprache
- Der Einfluss von Schlüsselpersonen wie Ernst Moritz Arndt, Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Ludwig Jahn auf den Sprachnationalismus
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Sprachnationalismus als Begriff und Arbeitsausblick
Die Einleitung stellt den Begriff „Sprachnationalismus“ vor und gibt einen Überblick über den Forschungsstand. Das Zitat von Ernst Moritz Arndt über die Bedeutung der Sprache für die nationale Identität bildet den Ausgangspunkt der Analyse. Die Arbeit untersucht die Verbindung von Sprache und nationaler Identität im Kontext der deutschen Geschichte des frühen 19. Jahrhunderts.
2. Das lange 19. Jh. kurz erfasst – Revolution, Industrialisierung, Vormärz ...
Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über das 19. Jahrhundert und beleuchtet wichtige Ereignisse wie die Revolution, die Industrialisierung und den Vormärz. Der Zusammenhang zwischen diesen historischen Entwicklungen und der Entstehung des Sprachnationalismus wird dargestellt.
3. Der Sprachnationalismus anhand ausgewählter Vertreter
Dieses Kapitel analysiert das Werk von Ernst Moritz Arndt und setzt es in Bezug zu den Werken von Johann Gottlieb Fichte und Friedrich Ludwig Jahn. Die Arbeit geht dabei auf die Argumentationsmuster und die zentralen Thesen dieser Vertreter des Sprachnationalismus ein.
- Quote paper
- Gregor Grohmann (Author), 2015, Sprachnationalismus im 19. Jahrhundert. Begriff und Vertreter des Sprachpatriotismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/316437