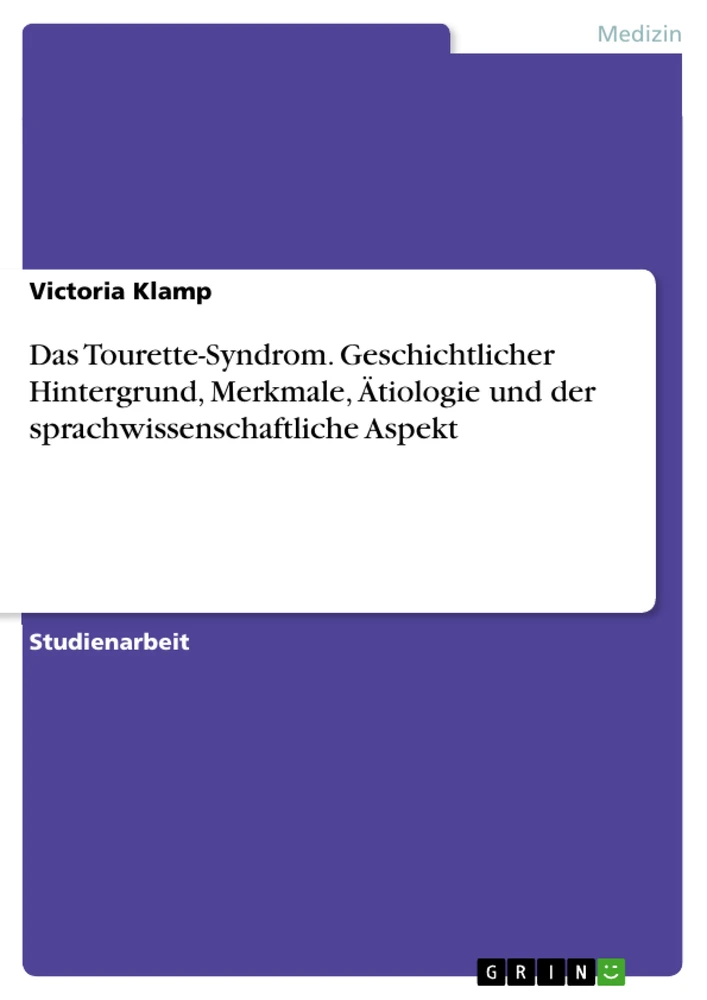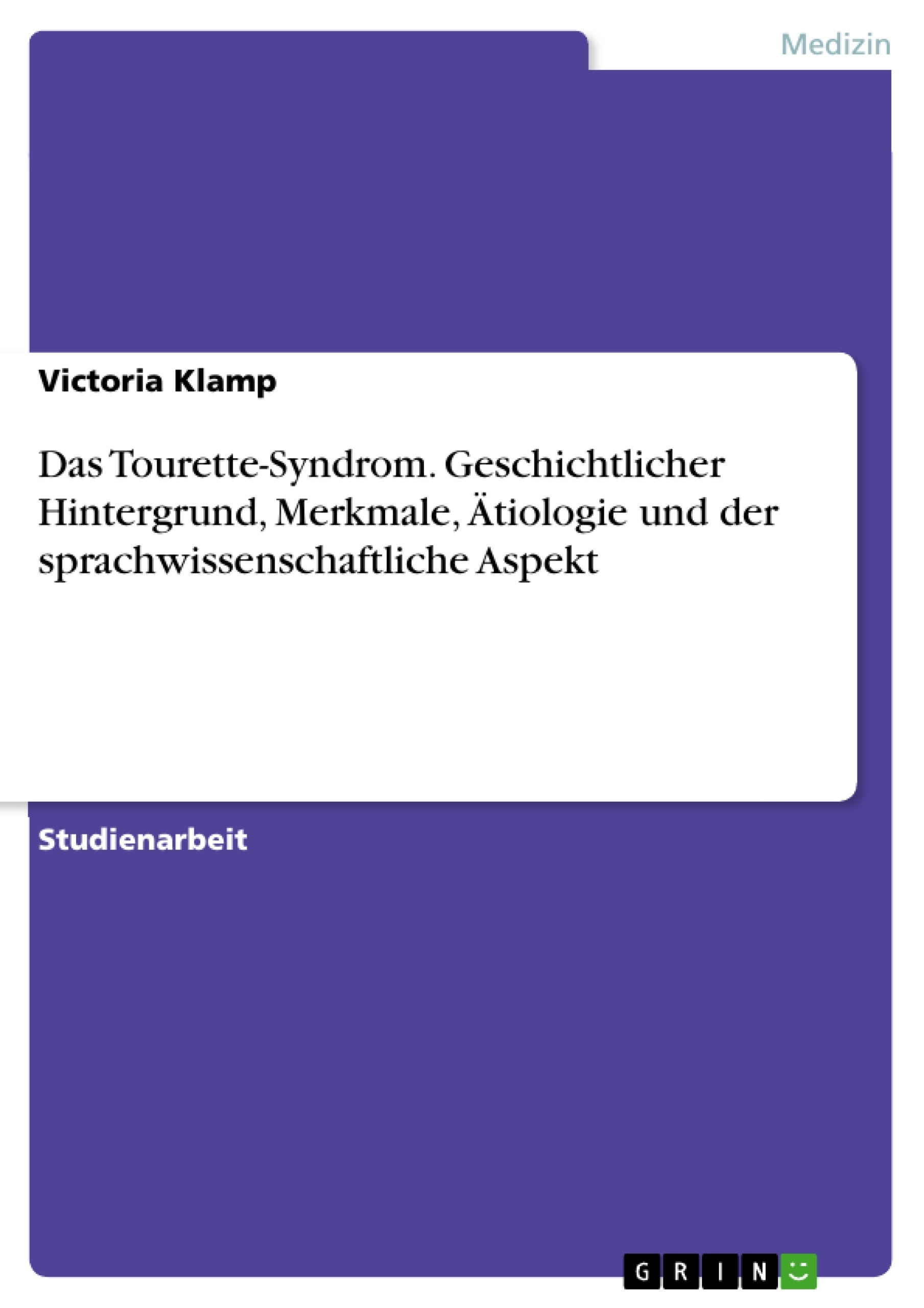Als eine gemeinhin bekannte Krankheitsbezeichnung leidet das Tourette-Syndrom häufig unter einer Klischeevorstellung, die durch die Uninformiertheit vieler Menschen über die eigentlichen Ausmaße dieser Erkrankung zustande kommt. Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) zufolge litten im Jahr 2012 300.000 bis 500.000 Menschen in Deutschland unter dieser Krankheit, von denen die wenigsten „Obszönitäten schreiend“ (Kostarellos 2015: 3) durch die Gegend laufen (Podbregar, 2012).
Weltweit liegt der Annäherungswert bei 0,05-3 %, jedoch ist es nahezu unmöglich genaue Zahlen zu nennen, da bei vielen Betroffenen noch keine Diagnose gestellt worden ist (Rothenberger et al. 2001, zit. nach Viert, T. 2005: S. 10). Es hat auch nicht jeder, am Tourette-Syndrom Erkrankte, automatisch sichtbare Zuckungen. Auch fällt die Krankheit, entgegen der landläufigen Meinung vieler Menschen, nicht in den Bereich der psychischen Erkrankungen (Kostarellos 2015: 4). Diese Missverständnisse führen dazu, dass Tourette-Kranke oftmals ausgegrenzt werden und ihnen mit Unverständnis begegnet wird. Das wiederum ist eine ganz natürliche Reaktion eines unwissenden Menschen auf etwas Unbekanntes, nicht regelkonformes und vor allem nicht den konventionellen Erwartungen entsprechendes. Die Abweichung von der Norm und das Ausbrechen aus einer allgemeingültigen Moralvorstellung macht Nicht-Betroffenen Angst und das Unwissen eben dieser Menschen führt zu einer Stigmatisierung der Tourette-Kranken in vielen Lebensbereichen (Viert 2005: 44f.).
Aufgrund dieses, noch nicht ausreichend gedeckten, Bedarfs an Information über das Tourette-Syndrom werden im Folgenden, nach einer Definition des Begriffs, der historische Hintergrund, die der Krankheit zugehörigen Merkmale und ätiologische Annahmen erläutert. Abschließend soll noch auf einen Teil des sprachwissenschaftlichen Aspekts dieser Erkrankung eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Tourette-Syndrom
- Geschichtlicher Hintergrund
- Merkmale
- Motorische Tics
- Vokale Tics
- Zwangsstörungen
- Hyperkinetisches Syndrom
- Ätiologie
- Sprachwissenschaftlicher Aspekt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Tourette-Syndrom und zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis dieser neuropsychiatrischen Erkrankung zu vermitteln. Dabei werden die historischen Wurzeln, die charakteristischen Merkmale, die Ursachen und die sprachwissenschaftlichen Aspekte beleuchtet.
- Geschichtlicher Überblick und Entwicklung des Verständnisses des Tourette-Syndroms
- Erläuterung der verschiedenen Symptome, insbesondere motorische und vokale Tics
- Untersuchung der möglichen Ursachen und ätiologischen Faktoren des Tourette-Syndroms
- Analyse des Einflusses des Tourette-Syndroms auf Sprache und Kommunikation
- Aufzeigen der sozialen Herausforderungen und Stigmatisierung, denen Tourette-Kranke begegnen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema des Tourette-Syndroms ein und beleuchtet die weit verbreiteten Missverständnisse und die daraus resultierende Stigmatisierung von Betroffenen. Das Kapitel „Das Tourette-Syndrom“ definiert den Begriff, präsentiert den historischen Hintergrund und beschreibt die charakteristischen Merkmale, einschließlich motorischer und vokaler Tics. Es werden auch die ätiologischen Annahmen und der sprachwissenschaftliche Aspekt der Erkrankung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Tourette-Syndrom, Tics, motorische Tics, vokale Tics, Zwangsstörungen, Hyperkinetisches Syndrom, Ätiologie, Sprachwissenschaft, Stigmatisierung, neuropsychiatrische Erkrankung
- Quote paper
- Victoria Klamp (Author), 2015, Das Tourette-Syndrom. Geschichtlicher Hintergrund, Merkmale, Ätiologie und der sprachwissenschaftliche Aspekt, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/316431