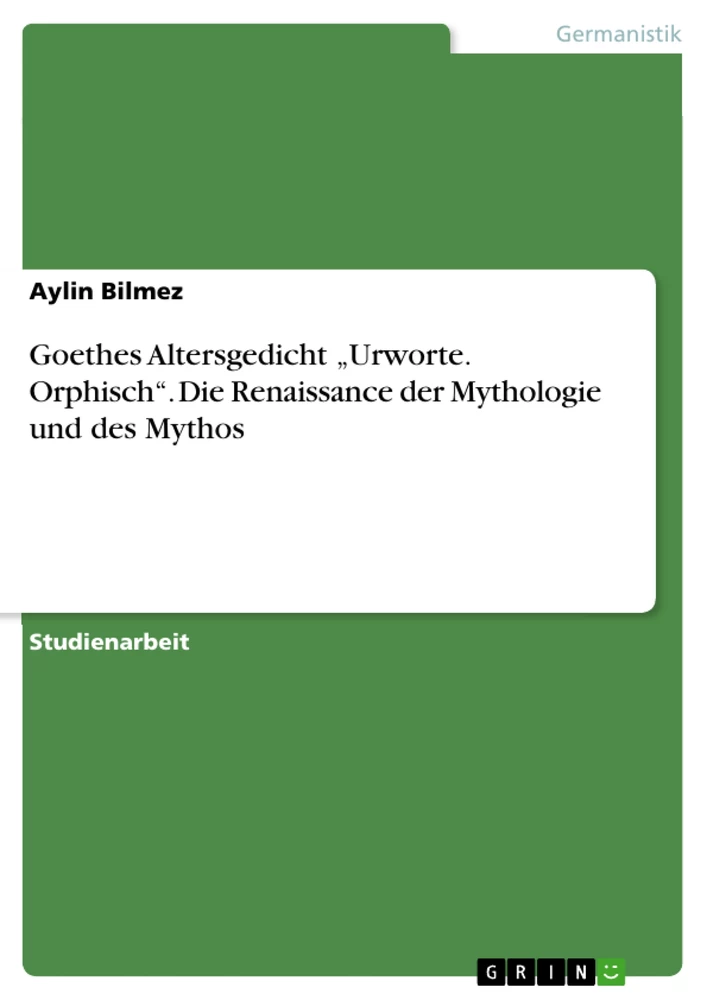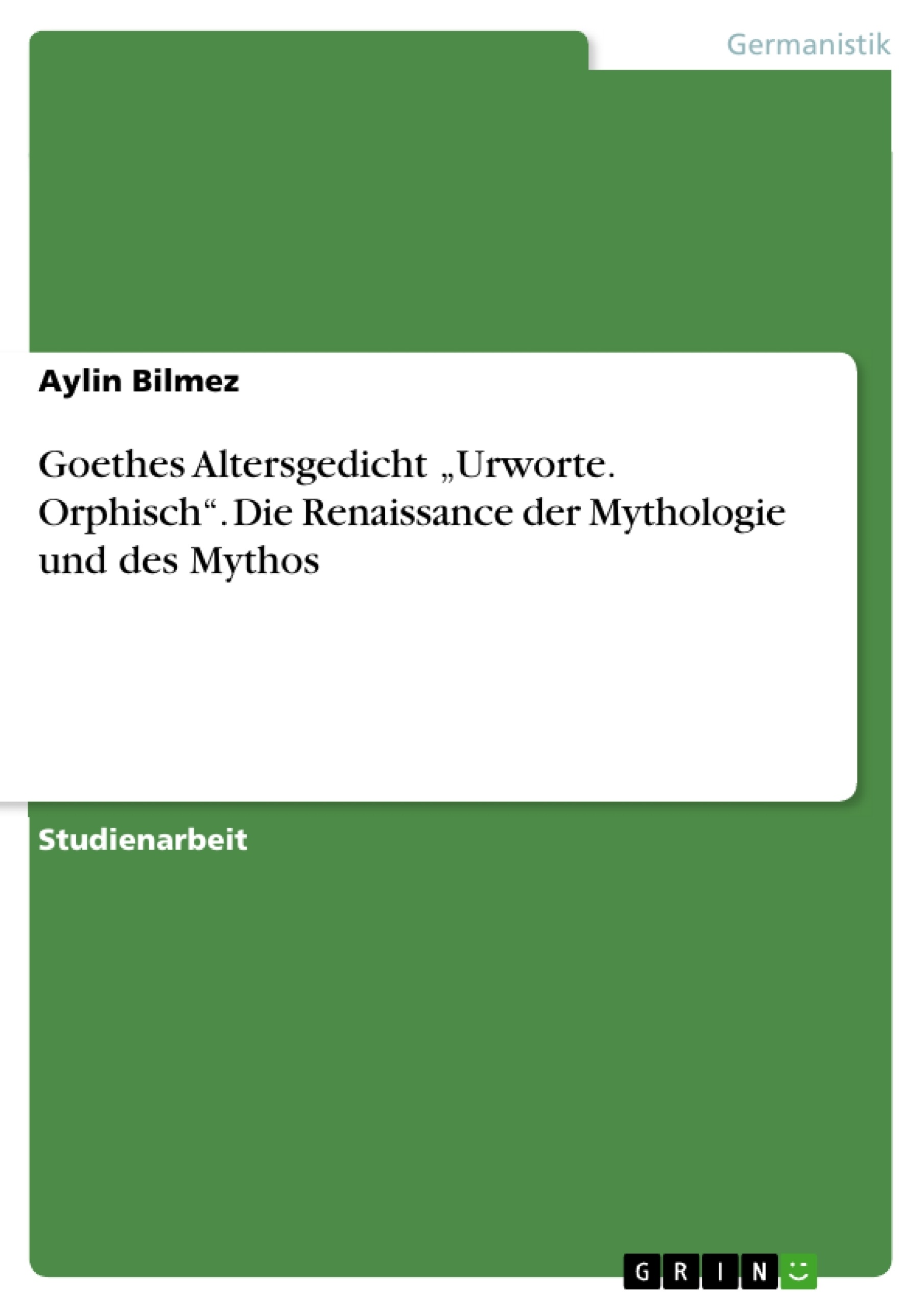Die vorliegende Hausarbeit behandelt das Gedicht „Urworte. Orphisch“ von Johann Wolfgang Goethe, welches zu einem der vielen mannigfaltigen Meisterwerke seiner Zeit wurde. Neben seiner vielen kulturellen Interessen, welche vor allem hinsichtlich der griechischen Mythologie ausgeprägt waren, nimmt Goethe in diesem Gedicht Fühlung mit dem Geist einer Epoche des Griechentums. Anhand dieses Interesse werden die Elemente in seinem Werk durch sein breites Ausdrucksspektrum von einer erfahrungsgeleiteten Weltweisheit wiederbelebt, welche zu erkenntnisvollen Lebensgesetzen formuliert werden.
Es ist der 8. Oktober 18171 und Goethe hat soeben das Gedicht „Urworte. Orphisch“ ausgeschrieben und beendet seine Arbeit mit einem kurzen Brief an seinen Freund Knebel. In diesem Brief teilt Goethe ihm mit, dass er durch die Mythologen Hermann, Creuzer, Zoega und Welcker bis in die orphischen Finsternisse geraten sei, nachdem er zuvor in seinem Brief an den Mythologen Professor Creuzer geschrieben hatte: „Sie haben mich genötigt, in eine Region hineinzuschauen, vor der ich mich sonst ängstlich zu hüten pflege.“
Anhand der Analyse des vorliegenden Gedichts werde ich zu dem Grund gelangen, warum Goethe es dennoch gewagt hat, in diese Region hineinzuschauen und warum er sich gerade für diese fünf Urworte entschieden hat. Als Mittel dafür, werde ich unter anderem den obigen Tagebucheintrag miteinbeziehen, um eine Ruckkopplung zum Gedicht herstellen zu können. Anschließend gehe ich auf den Inhalt des Gedichts ein, wobei ergänzend biografische Aspekte mitbetrachtet werden, und fasse abschließend meine Erkenntnisse und Resultate zu den Leitfragen im Fazit zusammen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gedichtsanalyse
- 2.1 ΔΑΙΜΩΝ, Dämon
- 2.2 TYXH, das Zufällige
- 2.3 EPΩΣ, Liebe
- 2.4 ANAΓKH, Nöthigung
- 2.5 ΕΛΠΙΣ, Hoffnung
- 3. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Goethes Altersgedicht „Urworte. Orphisch“ im Kontext der Weimarer Klassik und der Renaissance der Mythologie um 1800. Sie analysiert die fünf zentralen Urworte und deren Funktion im Gedicht, beleuchtet Goethes Auseinandersetzung mit der griechischen Mythologie und den Einfluss von Mythologen wie Creuzer auf sein Werk. Die Arbeit zielt darauf ab, Goethes Motiv für die Beschäftigung mit dieser Thematik und seine Auswahl der spezifischen Urworte zu verstehen.
- Goethes Auseinandersetzung mit der griechischen Mythologie
- Die Bedeutung der fünf Urworte (ΔΑΙΜΩΝ, TYXH, EPΩΣ, ANAΓKH, ΕΛΠΙΣ) in „Urworte. Orphisch“
- Der Einfluss von Mythologen wie Creuzer auf Goethes Werk
- Die Verbindung zwischen Mythos und Dichtung bei Goethe
- Biografische Aspekte im Kontext der Gedichtanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Entstehungsgeschichte von Goethes Gedicht „Urworte. Orphisch“ im Jahr 1817 ein und beschreibt den Kontext der Weimarer Klassik und die Renaissance der griechischen Mythologie. Sie verweist auf den Einfluss von Mythologen wie Creuzer auf Goethe und dessen anfängliche Scheu vor dieser Thematik. Die zentrale Fragestellung der Arbeit wird formuliert: Warum hat sich Goethe mit der griechischen Mythologie auseinandergesetzt und warum wählte er gerade diese fünf Urworte? Die Methodik der Arbeit wird skizziert, die auf einer Gedichtsanalyse mit Einbezug biografischer Aspekte beruht.
2. Gedichtsanalyse: Dieser Abschnitt analysiert die fünf Strophe des Gedichts "Urworte. Orphisch", wobei jede Strophe einem der fünf Urworte (ΔΑΙΜΩΝ, TYXH, EPΩΣ, ANAΓKH, und ΕΛΠΙΣ) gewidmet ist. Die Analyse untersucht die semantische Bedeutung jedes Urworts, seine poetische Funktion im Gedicht und seinen Bezug zu Goethes Weltbild und Lebensphilosophie. Durch die detaillierte Betrachtung der sprachlichen Gestaltung und des metaphorischen Gebrauchs wird die zentrale Aussage des Gedichts erschlossen. Die einzelnen Strophen werden nicht isoliert betrachtet, sondern als zusammenhängende Einheit des Gesamtwerks verstanden, um Goethes intendierte Botschaft zu ergründen. Der Bezug zu Goethes Tagebucheinträgen wird hergestellt, um die persönliche und zeitgeschichtliche Einbettung des Gedichts zu verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Goethe, Urworte. Orphisch, Weimarer Klassik, Griechische Mythologie, Mythos, Gedichtanalyse, ΔΑΙΜΩΝ, TYXH, EPΩΣ, ANAΓKH, ΕΛΠΙΣ, Creuzer, Symbol, Interpretation.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Urworte. Orphisch"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert Goethes Gedicht "Urworte. Orphisch" aus dem Jahr 1817 im Kontext der Weimarer Klassik und der Renaissance der griechischen Mythologie um 1800. Der Fokus liegt auf der Analyse der fünf zentralen Urworte (ΔΑΙΜΩΝ, TYXH, EPΩΣ, ANAΓKH, ΕΛΠΙΣ) und ihrer Funktion im Gedicht. Die Arbeit untersucht Goethes Auseinandersetzung mit der griechischen Mythologie, den Einfluss von Mythologen wie Creuzer und die Verbindung zwischen Mythos und Dichtung bei Goethe. Biografische Aspekte werden ebenfalls in die Analyse einbezogen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Goethes Auseinandersetzung mit der griechischen Mythologie; die Bedeutung der fünf Urworte (ΔΑΙΜΩΝ, TYXH, EPΩΣ, ANAΓKH, ΕΛΠΙΣ) in "Urworte. Orphisch"; den Einfluss von Mythologen wie Creuzer auf Goethes Werk; die Verbindung zwischen Mythos und Dichtung bei Goethe; und biografische Aspekte im Kontext der Gedichtanalyse.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, die den Kontext des Gedichts und die Forschungsfrage etabliert; eine Gedichtsanalyse, die jede Strophe des Gedichts im Detail untersucht und die Urworte semantisch und poetisch deutet; und ein Fazit (nicht explizit im bereitgestellten HTML, aber implizit durch die Struktur).
Wie wird die Gedichtsanalyse durchgeführt?
Die Gedichtsanalyse untersucht jede der fünf Strophen von "Urworte. Orphisch", die jeweils einem der fünf Urworte gewidmet sind. Die Analyse berücksichtigt die semantische Bedeutung der Urworte, ihre poetische Funktion im Gedicht, ihren Bezug zu Goethes Weltbild und Lebensphilosophie sowie die sprachliche Gestaltung und den metaphorischen Gebrauch. Die Strophen werden nicht isoliert, sondern als zusammenhängende Einheit betrachtet, um Goethes intendierte Botschaft zu ergründen. Goethes Tagebucheinträge werden herangezogen, um den persönlichen und zeitgeschichtlichen Kontext zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Urworte. Orphisch, Weimarer Klassik, Griechische Mythologie, Mythos, Gedichtanalyse, ΔΑΙΜΩΝ, TYXH, EPΩΣ, ANAΓKH, ΕΛΠΙΣ, Creuzer, Symbol, Interpretation.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist: Warum hat sich Goethe mit der griechischen Mythologie auseinandergesetzt und warum wählte er gerade diese fünf Urworte für sein Gedicht?
Welche Methodik wird angewendet?
Die Methodik basiert auf einer detaillierten Gedichtsanalyse, die biografische Aspekte und den historischen Kontext einbezieht.
- Quote paper
- Aylin Bilmez (Author), 2015, Goethes Altersgedicht „Urworte. Orphisch“. Die Renaissance der Mythologie und des Mythos, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/316306