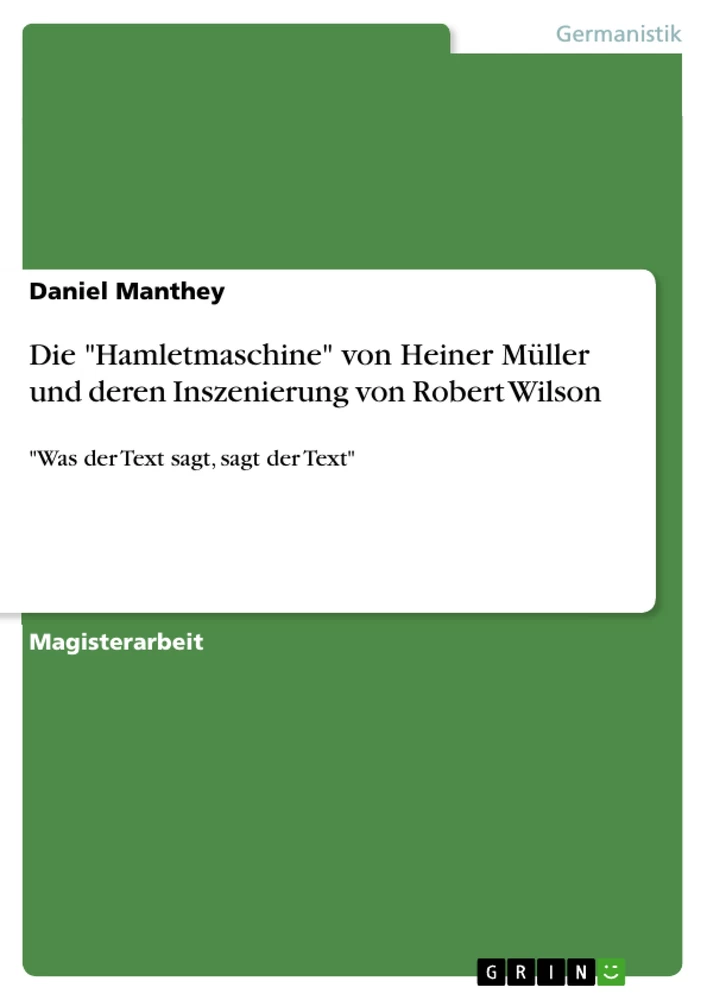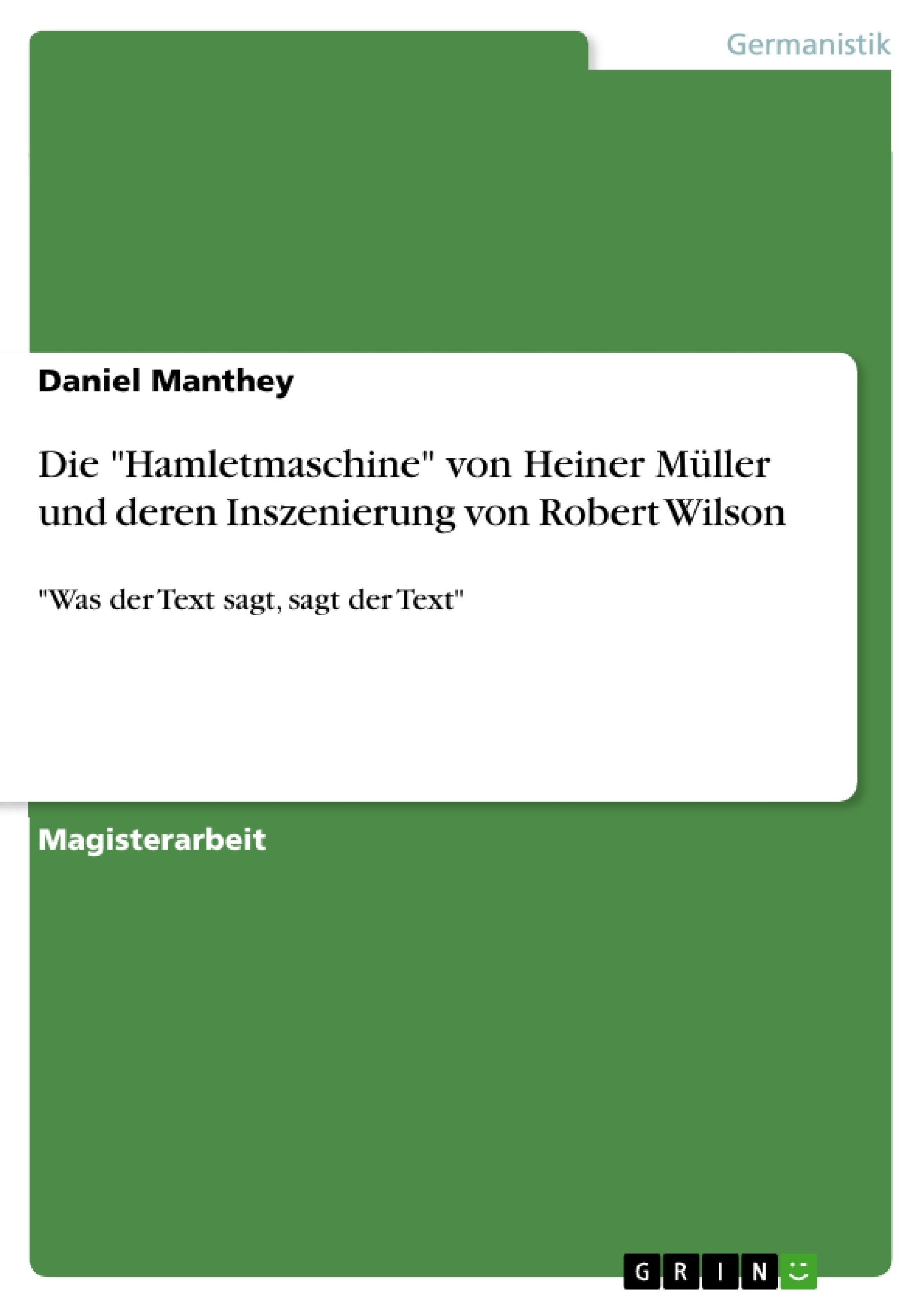„Am Ende standen sie Hand in Hand an der Rampe, das wohl seltsamste Paar des zeitgenössischen Theaters: der schmächtige Dichter aus Eppendorf/Sachsen und der baumlange Mann aus Waco/Texas.“ Der Kritiker der „Zeit“, Benjamin Henrichs, schreibt über die Zusammenarbeit des deutschen Dramatikers Heiner Müller und Robert Wilson anläßlich der Inszenierung der HAMLETMASCHINE2 in Hamburg, auf der Werkstatt-Bühne des Thalia Theaters. Nicht nur äußerlich bestehen große Unterschiede zwischen den beiden Theaterschaffenden, ihre Zusammenarbeit ist von gegensätzlichen Voraussetzungen geprägt. Laurence Shyer schreibt darüber: „A more unlikely and mutually contradictory collaboration could hardly be imagined than that of Robert Wilson and the East German playwright Heiner Müller.“
Der Regisseur aus Amerika, „political naif“, inszeniert das Stück eines „Marxist poet“. Während Müller in historischen Zusammenhängen verwurzelt ist, unter zwei Diktaturen in Deutschland leben mußte, ist Wilson in der vergleichsweise heilen Welt einer amerikanischen Kleinstadt aufgewachsen. Wilsons Theaterkonzeption ist die Gleichberechtigung der einzelnen Theaterkünste, der Text tritt also aus seiner Hauptrolle zurück, der Autor Müller verliert an Wichtigkeit gegenüber den anderen Elementen des Theaters. Trotzdem ist Müller mit der Inszenierung durch den amerikanischen Regisseur sehr zufrieden. Wilson reüssiert mit einem Stück, an dem vor ihm viele Regisseure gescheitert sind. Heiner Müller selbst bezeichnete die HAMLETMASCHINE als unspielbar.
Unter literaturwissenschaftlichen Aspekten interessiert zunächst einmal der Text des Stückes, von Heiner Müller 1977 fertiggestellt, der sich einer oberflächlichen, rein unterhaltsamen Lektüre sperrt, oder wie Marie-Louisa Kobus schreibt: „Der erste Eindruck hinterläßt ein Gefühl des Nichtverstehens.“
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Der Text
- II.1 Vorbemerkungen zu Heiner Müllers Theaterkonzeption
- II.1.1 Interpretierbarkeit der HAMLETMASCHINE
- II.1.2 „Emanzipieren vom diktierten Ergötzen“
- II.1.3 „Vom Welterretter zum Apokalyptiker“: Heiner Müllers Reaktion auf die Stagnation der DDR-Politik
- II.2 Interpretation
- II.2.1 „Hamlet“: Müllers Zerstörung eines Klassikers
- II.2.2 Fragmentarische Form, Monologe und Metaphern
- II.2.3 Szene 1: „FAMILIENALBUM“
- II.2.4 Szene 2: „DAS EUROPA DER FRAU“
- II.2.5 Exkurs 1: Zur Geschlechterdifferenz bei Heiner Müller
- II.2.6 Szene 3: „SCHERZO“
- II.2.7 Exkurs 2: Anmerkungen zum Geschichtsbild Heiner Müllers
- II.2.8 Szene 4: „PEST IN BUDA SCHLACHT UM GRÖNLAND“
- II.2.9 Szene 5: „WILDHARREND/IN DER FURCHTBAREN RÜSTUNG/JAHRTAUSENDE“
- II.2.10 Exkurs 3: „DAMIT ETWAS KOMMT MUSS ETWAS GEHEN“
- II.2.11 „Das Denkmal liegt am Boden“
- II.1 Vorbemerkungen zu Heiner Müllers Theaterkonzeption
- III. Die Hamburger Inszenierung von Robert Wilson
- III.1 Weder Sozialistischer noch Psychologischer Realismus
- III.2 Exkurs: Robert Wilsons „theatre of visions“
- III.2.1 Robert Wilson und traditionelles Theater
- III.2.2 Die Bühne in Wilsons Bildertheater
- III.2.3 Wilsons Lichtgestaltung
- III.2.4 Kombination Hören und Sehen
- III.2.5 Die Zuschauer
- III.2.6 Die Schauspieler
- III.2.7 Text und Sprache, Inhalt und Illustration
- III.2.8 Die Zeit
- III.2.9 Medien und Motive
- III.2.10 Hermeneutik der Sinne
- III.3 Eine texanisch-sächsische Kollaboration
- III.4 Wilsons Arbeitsweise am Beispiel HAMLETMASCHINE
- III.5 Visuelle und sonore Parallelwelten
- III.6 „Hohle Bombastik der Metaphern“ oder „theatrical masterpiece“: Wilsons Inszenierung in der Kritik
- III.7 Mehr als nur ergänzende Teile
- IV. Fazit: „Interpretation violates art“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Zusammenarbeit zwischen Heiner Müller und Robert Wilson bei der Inszenierung der „Hamletmaschine“. Ziel ist es, die spezifischen Herausforderungen und Erfolge dieser ungewöhnlichen Kooperation zu analysieren, indem der Text von Müllers Stück und die Inszenierung Wilsons im Kontext der jeweiligen künstlerischen Konzeptionen betrachtet werden. Die Arbeit beleuchtet auch den Einfluss des historischen und politischen Umfelds auf Müllers Werk.
- Heiner Müllers Theaterkonzeption und seine Interpretation von Hamlet
- Die spezifischen Merkmale von Müllers „Hamletmaschine“ (z.B. Fragmentarität, Monologe, Metaphern)
- Robert Wilsons „theatre of visions“ und seine Inszenierungsmethoden
- Der Kontrast zwischen Müllers historisch-politischem Kontext und Wilsons amerikanischer Perspektive
- Die Rezeption der Inszenierung in der Kritik
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die ungewöhnliche Zusammenarbeit zwischen Heiner Müller und Robert Wilson bei der Inszenierung der „Hamletmaschine“ vor und hebt die gegensätzlichen Hintergründe und künstlerischen Ansätze beider Künstler hervor. Sie deutet auf die Komplexität des Textes und die Herausforderungen seiner Interpretation hin und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
II. Der Text: Dieses Kapitel bietet eine tiefgehende Analyse des Textes der „Hamletmaschine“. Es untersucht Müllers Theaterkonzeption, die Herausforderungen der Interpretierbarkeit des Textes und den Einfluss des politischen und historischen Kontextes der DDR auf Müllers Werk. Der Hauptteil des Kapitels widmet sich einer detaillierten Interpretation der einzelnen Szenen des Stückes, wobei die fragmentarische Struktur, die Monologe und die Metaphern im Mittelpunkt stehen. Exkurse beleuchten die Geschlechterdifferenz in Müllers Werk und sein Geschichtsbild.
III. Die Hamburger Inszenierung von Robert Wilson: Dieses Kapitel analysiert Robert Wilsons Inszenierung der „Hamletmaschine“ in Hamburg. Es vergleicht Wilsons Ansatz mit dem traditionellen Theater und untersucht seine „theatre of visions“, seine Arbeitsweise und die spezifischen visuellen und auditiven Elemente seiner Inszenierung. Die Rezeption der Inszenierung durch die Kritik wird ebenfalls beleuchtet, wobei die unterschiedlichen Perspektiven und Interpretationen der Aufführung im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Heiner Müller, Robert Wilson, Hamletmaschine, Theater, Inszenierung, Interpretation, DDR, Geschichtsbild, Geschlechterdifferenz, politischer Kontext, visuelles Theater, fragmentarische Form, Monolog, Metapher.
Häufig gestellte Fragen zur Hamletmaschine von Heiner Müller und Robert Wilson
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Zusammenarbeit zwischen dem Dramatiker Heiner Müller und dem Regisseur Robert Wilson bei der Inszenierung der „Hamletmaschine“. Sie untersucht die spezifischen Herausforderungen und Erfolge dieser ungewöhnlichen Kooperation, indem der Text des Stücks und die Inszenierung im Kontext der jeweiligen künstlerischen Konzeptionen betrachtet werden. Der Einfluss des historischen und politischen Umfelds auf Müllers Werk wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Heiner Müllers Theaterkonzeption und seine Interpretation von Hamlet; die spezifischen Merkmale der „Hamletmaschine“ (Fragmentarität, Monologe, Metaphern); Robert Wilsons „theatre of visions“ und seine Inszenierungsmethoden; den Kontrast zwischen Müllers historisch-politischem Kontext und Wilsons amerikanischer Perspektive; und die Rezeption der Inszenierung in der Kritik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Eine Einleitung, die die Zusammenarbeit zwischen Müller und Wilson vorstellt und den methodischen Ansatz der Arbeit skizziert; ein Kapitel zur detaillierten Textanalyse der „Hamletmaschine“, einschließlich Interpretation der einzelnen Szenen und Exkurse zu Müllers Geschichtsbild und der Geschlechterdifferenz in seinem Werk; ein Kapitel zur Analyse von Wilsons Inszenierung in Hamburg, einschließlich einer Betrachtung seines „theatre of visions“ und der Rezeption der Inszenierung; und abschließend ein Fazit.
Welche Aspekte von Heiner Müllers „Hamletmaschine“ werden analysiert?
Die Analyse von Müllers „Hamletmaschine“ konzentriert sich auf Müllers Theaterkonzeption, die Interpretierbarkeit des Textes, den Einfluss des politischen und historischen Kontextes der DDR, die fragmentarische Struktur, die Monologe und die Metaphern des Stücks. Die einzelnen Szenen werden detailliert interpretiert.
Wie wird Robert Wilsons Inszenierung beschrieben und analysiert?
Die Arbeit analysiert Wilsons Inszenierung im Kontext seines „theatre of visions“, seiner Arbeitsweise und der spezifischen visuellen und auditiven Elemente. Es wird ein Vergleich zu traditionellen Theaterformen gezogen und die Rezeption der Inszenierung in der Kritik beleuchtet.
Welche Rolle spielt der historische und politische Kontext?
Der historische und politische Kontext, insbesondere die Situation in der DDR, spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Müllers Werk und seiner „Hamletmaschine“. Der Kontrast zu Wilsons amerikanischer Perspektive wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Heiner Müller, Robert Wilson, Hamletmaschine, Theater, Inszenierung, Interpretation, DDR, Geschichtsbild, Geschlechterdifferenz, politischer Kontext, visuelles Theater, fragmentarische Form, Monolog, Metapher.
- Quote paper
- Daniel Manthey (Author), 1999, Die "Hamletmaschine" von Heiner Müller und deren Inszenierung von Robert Wilson, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/31626