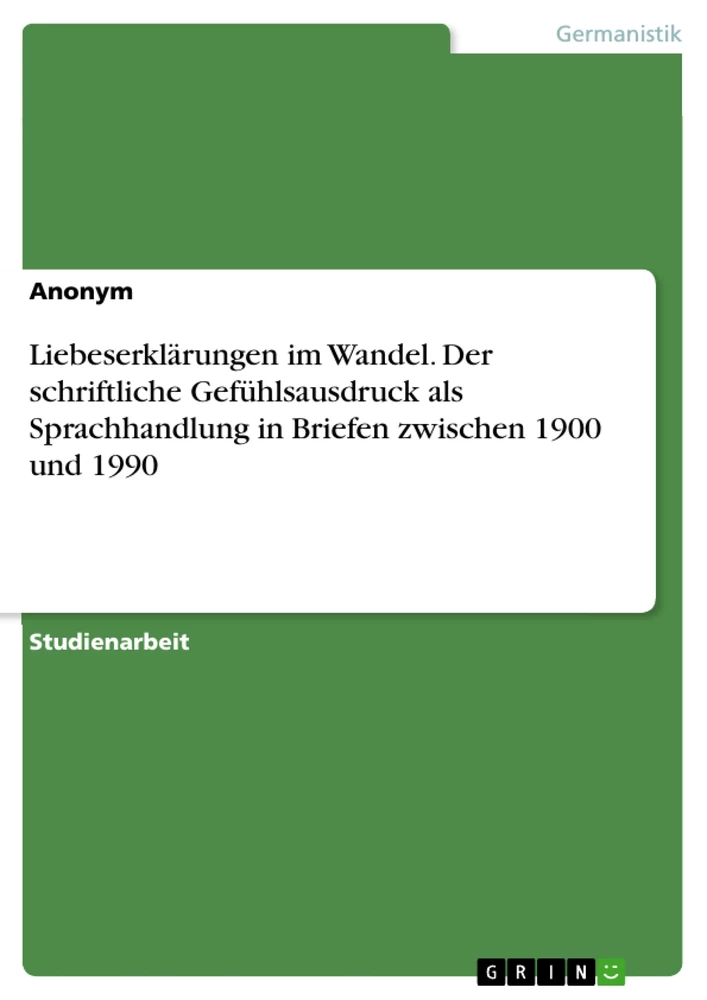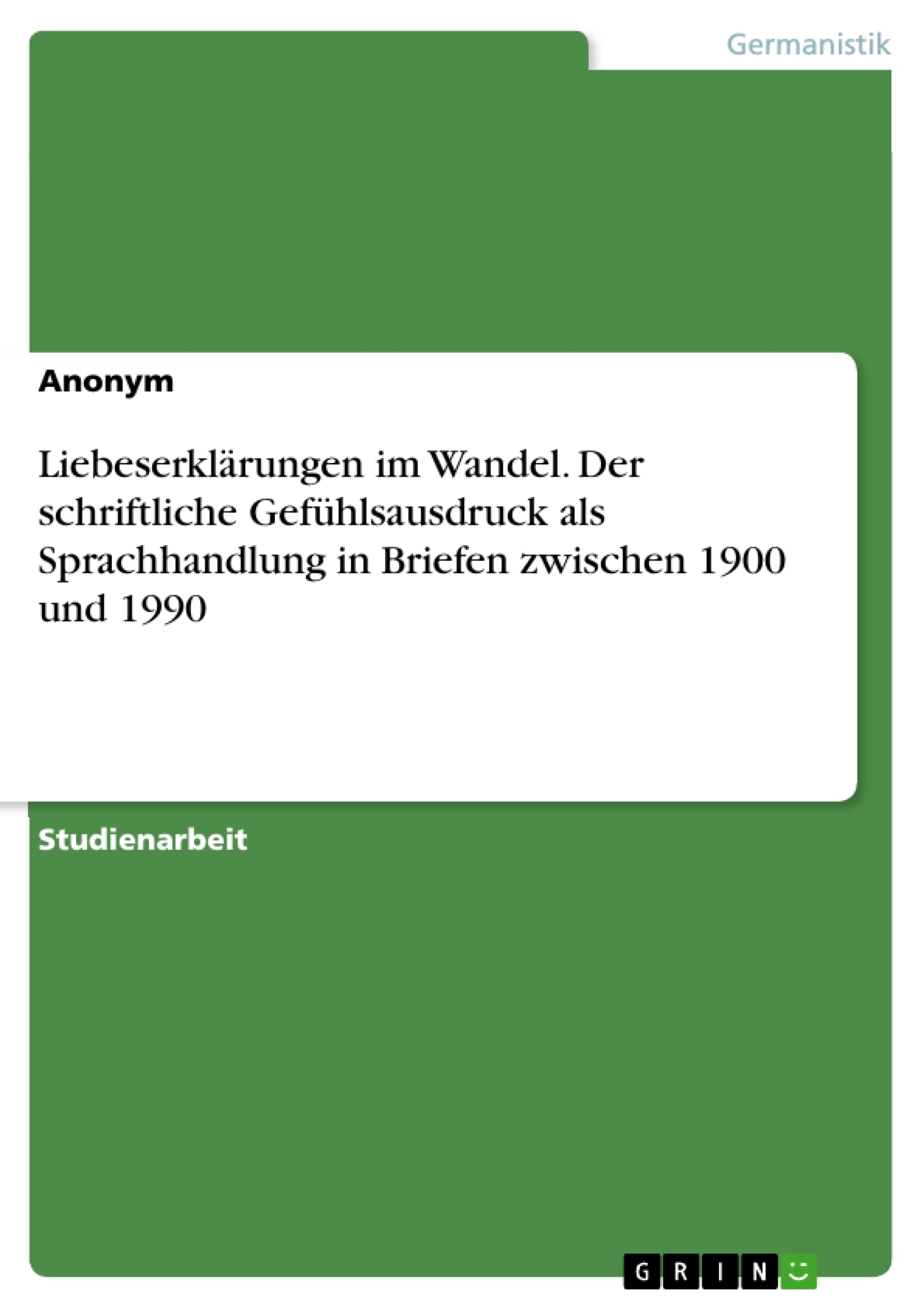Im Fokus der folgenden Arbeit steht die Analyse von Liebeserklärungen in Briefen. Der Brief als schriftliches Kommunikationsmedium bietet eine konservierte Grundlage, um sich der Kommunikation zwischen Liebenden anzunähern. Anhand eines Korpus bestehend aus dreißig Liebesbriefen des Koblenzer Liebesbriefarchives wird die sprachliche Realisierung von Liebe analysiert. Dabei stellt sich die Frage, wie eine Liebeserklärung definiert werden kann und was für ein Sprechakt sie ist.
Nachdem diese Frage geklärt ist, soll die Verwirklichung dieses Sprechaktes in der Zeitspanne von 1900 – 1990 analysiert werden. Deutlich im Fokus der Analyse steht der Wandel. Diese Arbeit stellt die These auf, dass die Kommunikation zwischen Liebenden sich einem wandelnden Konzept der Liebe anpasst und somit die Sprache in Liebesbriefen rückschließend etwas über das gesellschaftliche Bild von Liebe aussagen kann. Darüber hinaus versucht die Analyse festzustellen, dass Liebeserklärungen Mustern folgen, die über die Zeit wiederzuerkennen sind und somit einen Sprechakt darstellen, der eventuell modifiziert in dem semantischen Feld des Liebesbriefes verankert ist. So wird eine Brücke geschlagen zwischen der historischen Pragmatik und der Soziolinguistik.
Diese Hausarbeit bewegt sich im Feld der historischen Pragmatik. Sie stellt die Frage, wie ein spezieller Sprechakt im Laufe einer Zeitspanne verwirklicht wurde. Das Feld der Pragmatik steckt Aspekte der Interpretation von sprachlichen Äußerungen ab, die vom Kontext dieser Äußerung abhängen. Kommunikative Funktionen sollen analysiert und interpretiert werden.
Wie bereits von Staffeldt kritisiert, beschäftigte sich die Linguistik auffallend wenig mit dem Handlungsfeld Liebe, beziehungsweise den „berühmten drei Worten“. In der Forschungsliteratur ist es nur schwierig, einen Konsens darüber zu finden, ob und – wenn ja – welchen Mustern Liebeskommunikation folgt. Liebesbriefe bieten dabei eine realistische Konservierung der Sprache, da er als private Übermittlung von Nachrichten an geliebte Personen keinen speziellen formalen Regeln folgt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Korpus
- 3. „Denn ich muss dir gestehen, dass dies der erste Liebesbrief den erdacht“ Analyse der Liebeserklärungen
- 3.1 Annäherung an eine Definition
- 3.2 Die Liebeserklärung als sprachliche Handlung
- 3.3 Verwirklichung, Funktion und Form der Liebeserklärung in den Briefen
- 3.3.1 Einflechtung und Kennzeichnung
- 3.3.2 Funktion & Intention
- 4. Der Wandel der Liebeserklärungen im Zusammenhang mit Gesellschaftlichem Wandel
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Realisierung von Liebeserklärungen in Briefen zwischen 1900 und 1990. Die Hauptzielsetzung besteht darin, den Wandel der Liebeserklärungen im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen zu analysieren und zu erforschen, ob sich hinter diesen Veränderungen Muster erkennen lassen. Die Analyse basiert auf einem Korpus von Liebesbriefen aus dem Koblenzer Liebesbriefarchiv.
- Definition und Klassifizierung von Liebeserklärungen (direkte vs. indirekte)
- Analyse der sprachlichen Mittel zur Ausdruck von Liebe und Zuneigung
- Untersuchung des Wandels der Liebeserklärungen über die Zeit
- Zusammenhang zwischen sprachlichem Wandel und gesellschaftlichen Veränderungen im Verständnis von Liebe
- Identifizierung von Mustern und Sprechakten in der Liebeskommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der historischen Pragmatik und der Analyse von Liebeserklärungen ein. Sie skizziert die Forschungslücke bezüglich der linguistischen Untersuchung von Liebeskommunikation und benennt die zentrale Forschungsfrage: Wie verwirklicht sich der Sprechakt der Liebeserklärung in Briefen über einen Zeitraum von 100 Jahren? Das methodische Vorgehen, basierend auf einem Korpus von 30 Briefen aus dem Koblenzer Liebesbriefarchiv (10 aus 1900-1910, 10 aus 1940-1950, 10 aus 1980-1990), wird erläutert. Die These der Arbeit besagt, dass die Liebeskommunikation sich an ein wandelndes Konzept der Liebe anpasst und somit die Sprache Rückschlüsse auf das gesellschaftliche Bild von Liebe zulässt.
2. Das Korpus: Dieses Kapitel beschreibt detailliert das verwendete Korpus von 30 Liebesbriefen aus dem Koblenzer Liebesbriefarchiv. Es werden die drei Zeitabschnitte (1900-1910, 1940-1950, 1980-1990) mit ihren jeweiligen Besonderheiten hinsichtlich Brieflänge, Absender und Inhalt (z.B. Soldatenbriefe im zweiten Abschnitt) beschrieben. Die Auswahl der Briefe zielte auf eine breite Varietät an Verfasser*innen ab, um generalisierbarere Aussagen treffen zu können. Die Vorteile des Korpus, bestehend aus authentischen Briefen aus privaten Haushalten, werden hervorgehoben, im Gegensatz zu oftmals öffentlichkeitsbewussten Briefen prominenter Personen.
3. „Denn ich muss dir gestehen, dass dies der erste Liebesbrief den erdacht“: Analyse der Liebeserklärungen: Dieses Kapitel beginnt mit der Definition des zentralen Forschungsgegenstandes: der Liebeserklärung. Verschiedene Definitionen aus der Literatur werden diskutiert und es wird eine eigene Arbeitsdefinition entwickelt, die direkte und indirekte Liebeserklärungen umfasst und auch den Ausdruck körperlichen Verlangens mit einbezieht. Der Begriff wird anhand von Beispielen aus dem Korpus erläutert und die Grenzen der Definition werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Liebeserklärung, historische Pragmatik, Liebesbriefe, Sprachhandlung, Kommunikationswandel, gesellschaftlicher Wandel, Briefkorpus, Soziolinguistik, direkte Liebeserklärung, indirekte Liebeserklärung, Sprechakt, semantisches Feld.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse von Liebeserklärungen in Briefen (1900-1990)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die sprachliche Realisierung von Liebeserklärungen in Briefen aus dem Zeitraum zwischen 1900 und 1990. Der Fokus liegt auf dem Wandel der Liebeserklärungen im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen und der Identifizierung möglicher Muster.
Welches Korpus wurde verwendet?
Die Analyse basiert auf einem Korpus von 30 Liebesbriefen aus dem Koblenzer Liebesbriefarchiv. Die Briefe sind in drei Zeitabschnitte unterteilt (1900-1910, 1940-1950, 1980-1990), um den Wandel über die Zeit zu untersuchen. Die Auswahl der Briefe zielte auf eine breite Varietät an Verfasser*innen ab, um generalisierbarere Aussagen treffen zu können. Die Vorteile des Korpus, bestehend aus authentischen Briefen aus privaten Haushalten, werden gegenüber öffentlichkeitsbewussten Briefen prominenter Personen hervorgehoben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Beschreibung des Korpus, Analyse der Liebeserklärungen (inkl. Definition und Klassifizierung), Untersuchung des Wandels im Zusammenhang mit gesellschaftlichem Wandel und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein, beschreibt die Forschungslücke und das methodische Vorgehen. Kapitel 3 analysiert detailliert die Liebeserklärungen, während Kapitel 4 den Wandel im Kontext gesellschaftlicher Veränderungen untersucht. Die Arbeit schließt mit einem zusammenfassenden Fazit.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie verwirklicht sich der Sprechakt der Liebeserklärung in Briefen über einen Zeitraum von 100 Jahren? Weitere Fragen betreffen die Definition und Klassifizierung von Liebeserklärungen (direkte vs. indirekte), die Analyse der sprachlichen Mittel, die Untersuchung des Wandels über die Zeit und den Zusammenhang zwischen sprachlichem und gesellschaftlichem Wandel im Verständnis von Liebe.
Welche Definition von „Liebeserklärung“ wird verwendet?
Die Arbeit entwickelt eine eigene Arbeitsdefinition von „Liebeserklärung“, die sowohl direkte als auch indirekte Liebeserklärungen umfasst und den Ausdruck körperlichen Verlangens mit einbezieht. Verschiedene Definitionen aus der Literatur werden diskutiert, um die gewählte Definition zu begründen und ihre Grenzen zu diskutieren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Liebeserklärung, historische Pragmatik, Liebesbriefe, Sprachhandlung, Kommunikationswandel, gesellschaftlicher Wandel, Briefkorpus, Soziolinguistik, direkte Liebeserklärung, indirekte Liebeserklärung, Sprechakt, semantisches Feld.
Welche These wird vertreten?
Die These der Arbeit besagt, dass die Liebeskommunikation sich an ein wandelndes Konzept der Liebe anpasst und somit die Sprache Rückschlüsse auf das gesellschaftliche Bild von Liebe zulässt.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Analyse der Liebesbriefe aus dem Korpus. Die Methode der historischen Pragmatik ermöglicht die Untersuchung der sprachlichen Handlungen und des Kontextes der Liebeserklärungen. Die Analyse konzentriert sich auf die sprachlichen Mittel, die zur Ausdrucks von Liebe und Zuneigung verwendet werden.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2015, Liebeserklärungen im Wandel. Der schriftliche Gefühlsausdruck als Sprachhandlung in Briefen zwischen 1900 und 1990, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/315558