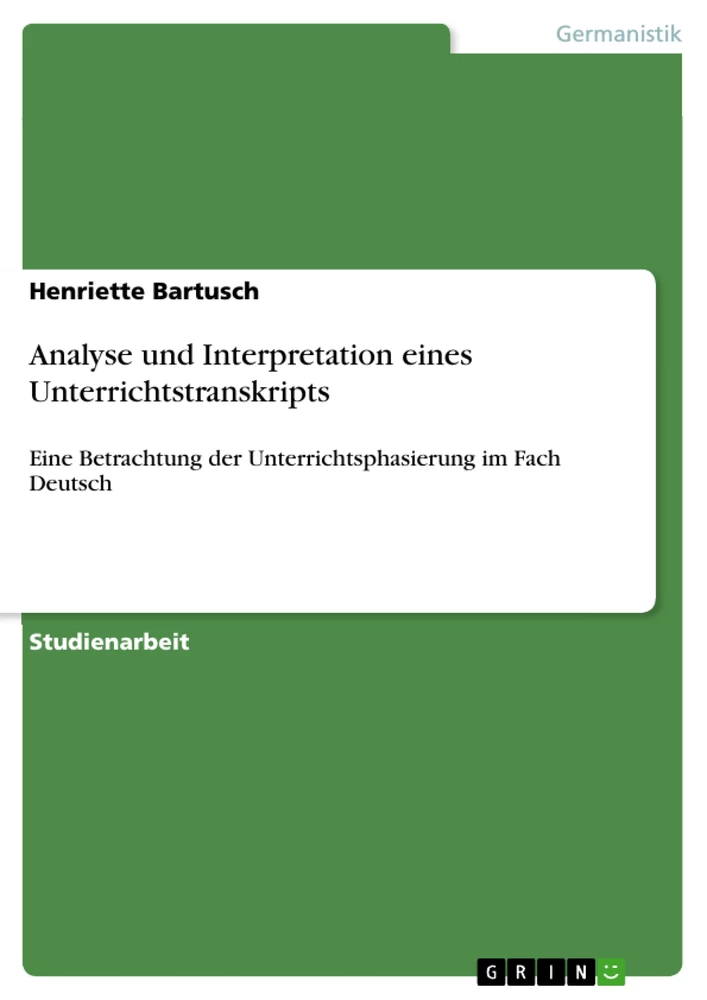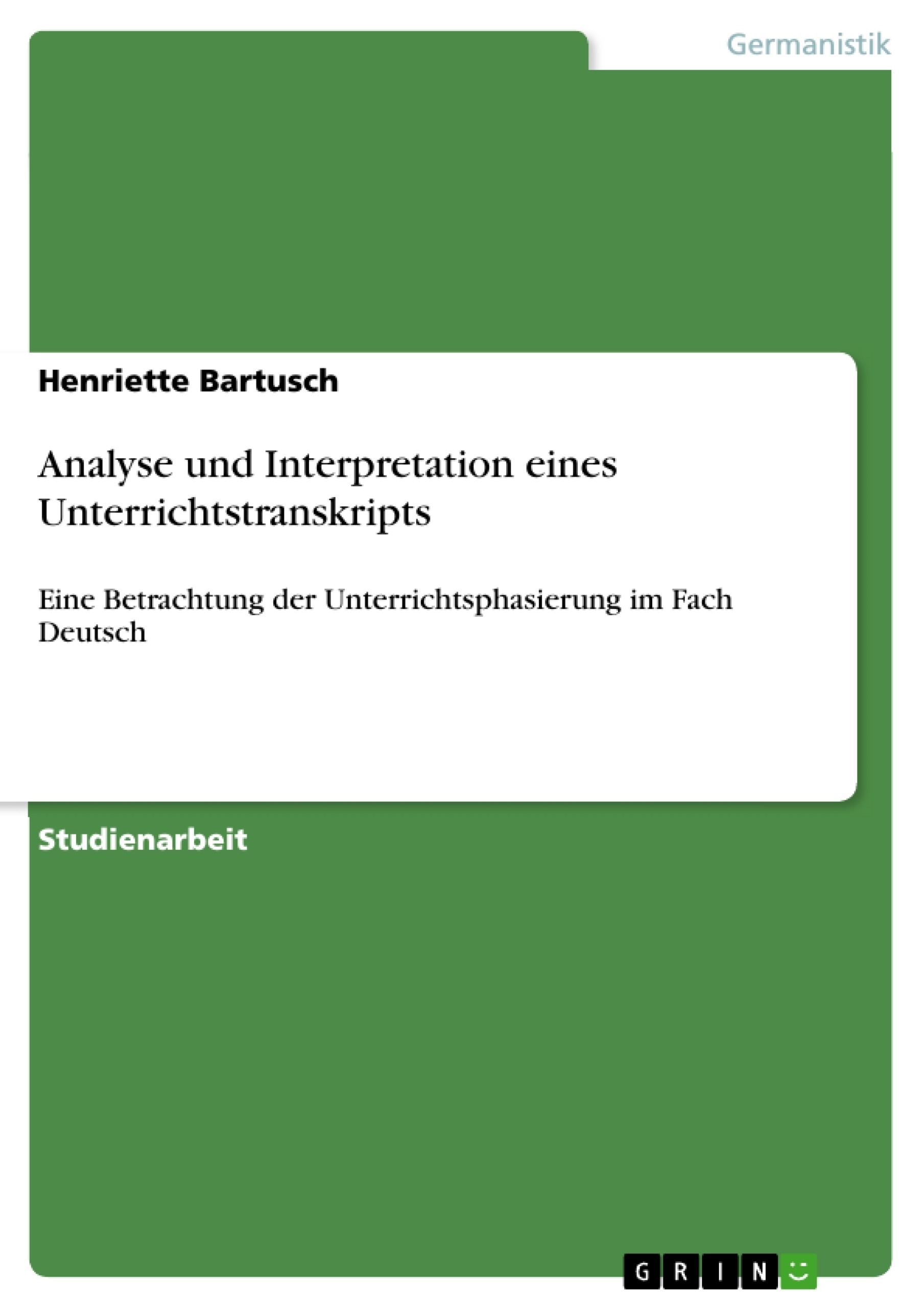Durch die „Schrittung einer Unterrichtsstunde“ wird das didaktisch-methodische Vorgehen festgelegt, wodurch sowohl „Ziel-, Inhalts-, Sozial- und Handlungsstruktur des Unterrichts zusammengeführt (werden) als auch dessen Prozessstruktur in Hinblick auf eine gewünschte Lernprogression beschrieben“ wird.
Kurz gesprochen wird eine Unterrichtsstunde in eine zweckmäßige Reihenfolge von Phasen untergliedert, welche der Erreichung eines übergeordneten Stundenziels dienen sollen. Diesbezüglich nennt Brand als allgemeingültiges „Grundmuster einer Deutschstunde“ eine Aufeinanderfolge der Schritte Einstieg, Erarbeitung und Ergebnissicherung, welchen er wiederum verschiedene Elemente zuordnet. Dementsprechend definiert sich der Einstieg über Möglichkeiten der Begrüßung, der Stundeneröffnung, der Zielbestimmung, der Einstimmung und viele mehr und die Erarbeitung über die Übung, die Vertiefung, den Transfer, die Anwendung, die Verallgemeinerung und andere. Die letzte Phase, die Ergebnissicherung, kann durch eine Zusammenfassung, Präsentationen, Vergleiche oder auch Dokumentationen geprägt sein. Dabei lassen sich die Schritte unterschiedlich variieren. Allerdings lassen sich weitere Bausteine einer Stunde wie die Pause, die Metakognition und der Ausstiegs nur schwer in das oben genannte Grundmuster einordnen.
Entsprechend der oben erläuterten hohen Relevanz der klaren Strukturierung des Unterrichts mit dem wichtigsten Strukturierungsmittel der Phasierung des Unterrichts, soll im Folgenden das Transkript von Lohe mit dem Titel „Lyrik: Goethe in der 10 Klasse“ untersucht werden. Dabei soll das Transkript im Besonderen hinsichtlich der folgenden drei Fragen analysiert und interpretiert werden. Welche Phasen sind erkennbar und wie werden diese Phasen durch die Lehrperson markiert? Welche Funktion schreibt die Lehrperson den Phasen zu und wie nehmen die Lernenden sie auf? Sind Phasenübergänge ersichtlich und wenn ja, wie sind diese gestaltet?
Um diese Fragen näher zu betrachten, soll sich die Analyse und Interpretation des Transkripts fragengeleitet gestalten und sich ebenso -zumindest in groben Zügen- an die Forschungsmethode des sequenziellen Interpretierens anlehnen. Daraufhin sollen die Ergebnisse der Analyse und Interpretation im 3. Kapitel vor dem Hintergrund fachdidaktischer Positionen reflektiert werden. Das letzte Kapitel soll zum Abschluss die Methode der Transkriptanalyse in Hinsicht auf ihre Chancen und Grenzen reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Transkriptanalyse und -interpretation
- 3. Ergebnisreflexion vor dem Hintergrund fachdidaktischer Positionen
- 4. Reflexion der Transkriptanalyse als Methode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert ein Transkript einer Deutschstunde zum Thema Lyrik (Goethe: Gesang der Geister über dem Wasser) in der 10. Klasse. Ziel ist es, die Unterrichtsphasen im Hinblick auf ihre Gestaltung, Funktion und Wahrnehmung durch Lehrende und Lernende zu untersuchen und diese vor dem Hintergrund fachdidaktischer Positionen zu reflektieren. Die Methode der Transkriptanalyse wird kritisch betrachtet.
- Phasierung des Unterrichts
- Analyse von Unterrichtsphasen (Einstieg, Erarbeitung, Ergebnissicherung)
- Funktion und Markierung von Phasenübergängen
- Rezeption der Phasen durch Lehrende und Lernende
- Reflexion der Methode der Transkriptanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der klaren Strukturierung im Unterricht ein, wobei die Phasierung als zentrales Strukturierungselement hervorgehoben wird. Sie benennt die zu untersuchende Forschungsfrage: die Analyse eines Transkripts einer Deutschstunde hinsichtlich der erkennbaren Phasen, ihrer Markierung durch die Lehrperson, ihrer Funktion und der Rezeption durch die Lernenden. Die methodische Vorgehensweise, angelehnt an das sequenzielle Interpretieren, wird skizziert, und die Quellen der Arbeit werden genannt.
2. Transkriptanalyse und –interpretation: Dieses Kapitel analysiert das Transkript einer Deutschstunde zum Gedicht „Gesang der Geister über dem Wasser“ von Goethe. Das Transkript wird in fünf Sinnabschnitte unterteilt, die den Phasen des Unterrichts (Einstieg, Erarbeitung, Ergebnissicherung, Ausstieg) zugeordnet werden. Die Analyse untersucht, wie die Lehrkraft diese Phasen durch verbale und sächliche Mittel markiert und wie die Lernenden auf diese Phasen reagieren. Es wird detailliert beschrieben, wie der Einstieg durch Bilder und Fragen gestaltet wird, die Erarbeitungsphase durch schrittweise Aufgaben und Diskussionen charakterisiert ist und die Ergebnissicherung durch die Zusammenfassung der Schülerergebnisse erfolgt. Die Analyse beleuchtet die kleinschrittige Gestaltung der Erarbeitungsphase und die verschiedenen Methoden der Ergebnisdarstellung.
Schlüsselwörter
Transkriptanalyse, Unterrichtsphasen, Phasierung, Deutschunterricht, Lyrik, Goethe, Sequenzielles Interpretieren, Fachdidaktik, Ergebnissicherung, Lernerfolg, Methodenreflexion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Transkriptanalyse einer Deutschstunde
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert ein Transkript einer Deutschstunde in der 10. Klasse zum Thema Lyrik (Goethes "Gesang der Geister über dem Wasser"). Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der Unterrichtsphasen hinsichtlich ihrer Gestaltung, Funktion und Wahrnehmung durch Lehrende und Lernende, sowie eine Reflexion im Kontext fachdidaktischer Positionen.
Welche Ziele werden verfolgt?
Ziel der Arbeit ist es, die Unterrichtsphasen (Einstieg, Erarbeitung, Ergebnissicherung) hinsichtlich ihrer Gestaltung und Markierung durch die Lehrkraft zu analysieren. Weiterhin wird untersucht, wie die Lernenden auf diese Phasen reagieren und wie die Phasenübergänge markiert werden. Abschließend wird die Methode der Transkriptanalyse kritisch reflektiert.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Phasierung des Unterrichts, der Analyse einzelner Unterrichtsphasen, der Funktion und Markierung von Phasenübergängen, der Rezeption der Phasen durch Lehrende und Lernende und der Reflexion der Methode der Transkriptanalyse.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die Transkriptanalyse und -interpretation, eine Ergebnisreflexion vor dem Hintergrund fachdidaktischer Positionen und eine Reflexion der Transkriptanalyse als Methode. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise vor. Kapitel 2 analysiert das Transkript detailliert, während die Kapitel 3 und 4 die Ergebnisse reflektieren und die Methode kritisch bewerten.
Wie wird das Transkript analysiert?
Das Transkript wird in fünf Sinnabschnitte unterteilt, die den Unterrichtsphasen zugeordnet werden. Die Analyse untersucht die verbale und sächliche Markierung der Phasen durch die Lehrkraft und die Reaktion der Lernenden. Die Gestaltung des Einstiegs, der Erarbeitung und der Ergebnissicherung wird detailliert beschrieben. Die Analyse konzentriert sich auf die kleinschrittige Gestaltung der Erarbeitungsphase und die verschiedenen Methoden der Ergebnisdarstellung.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Methode der Transkriptanalyse und das sequenzielle Interpretieren. Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund fachdidaktischer Positionen reflektiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Transkriptanalyse, Unterrichtsphasen, Phasierung, Deutschunterricht, Lyrik, Goethe, Sequenzielles Interpretieren, Fachdidaktik, Ergebnissicherung, Lernerfolg, Methodenreflexion.
Was ist das Ergebnis der Transkriptanalyse?
Das Ergebnis der Transkriptanalyse beschreibt detailliert die Gestaltung und den Ablauf der Unterrichtsphasen, die Markierung der Phasen durch die Lehrkraft und die Reaktionen der Schüler. Es zeigt, wie die kleinschrittige Gestaltung der Erarbeitungsphase und die verschiedenen Methoden der Ergebnisdarstellung zum Lernerfolg beitragen. Die Reflexion bewertet die Wirksamkeit der gewählten Unterrichtsmethoden.
- Quote paper
- M.Ed. Henriette Bartusch (Author), 2014, Analyse und Interpretation eines Unterrichtstranskripts, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/315249