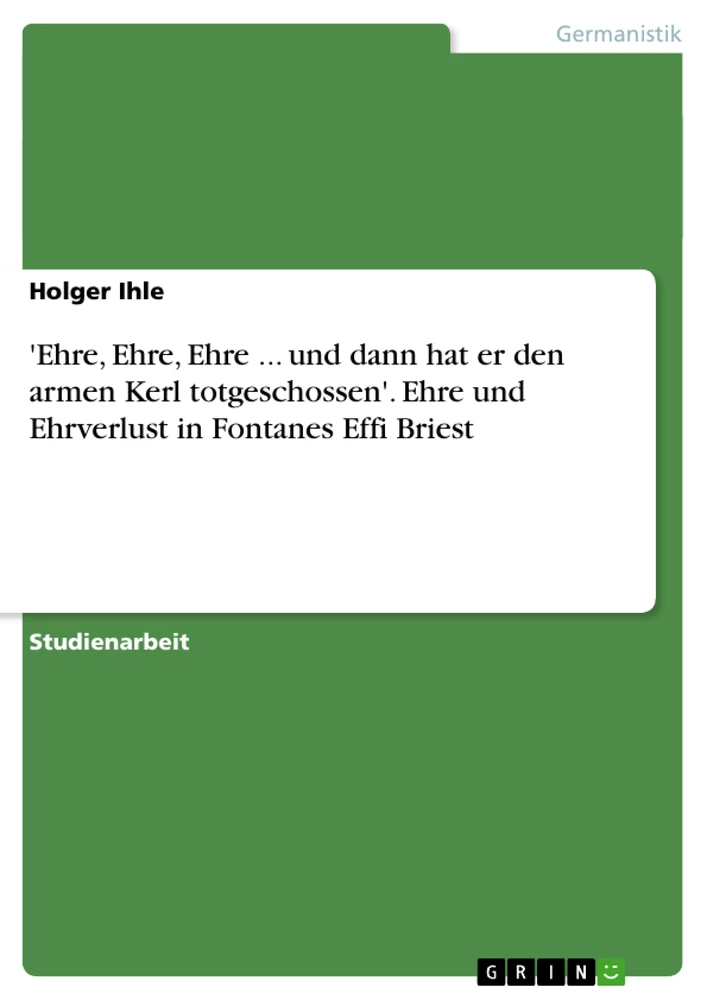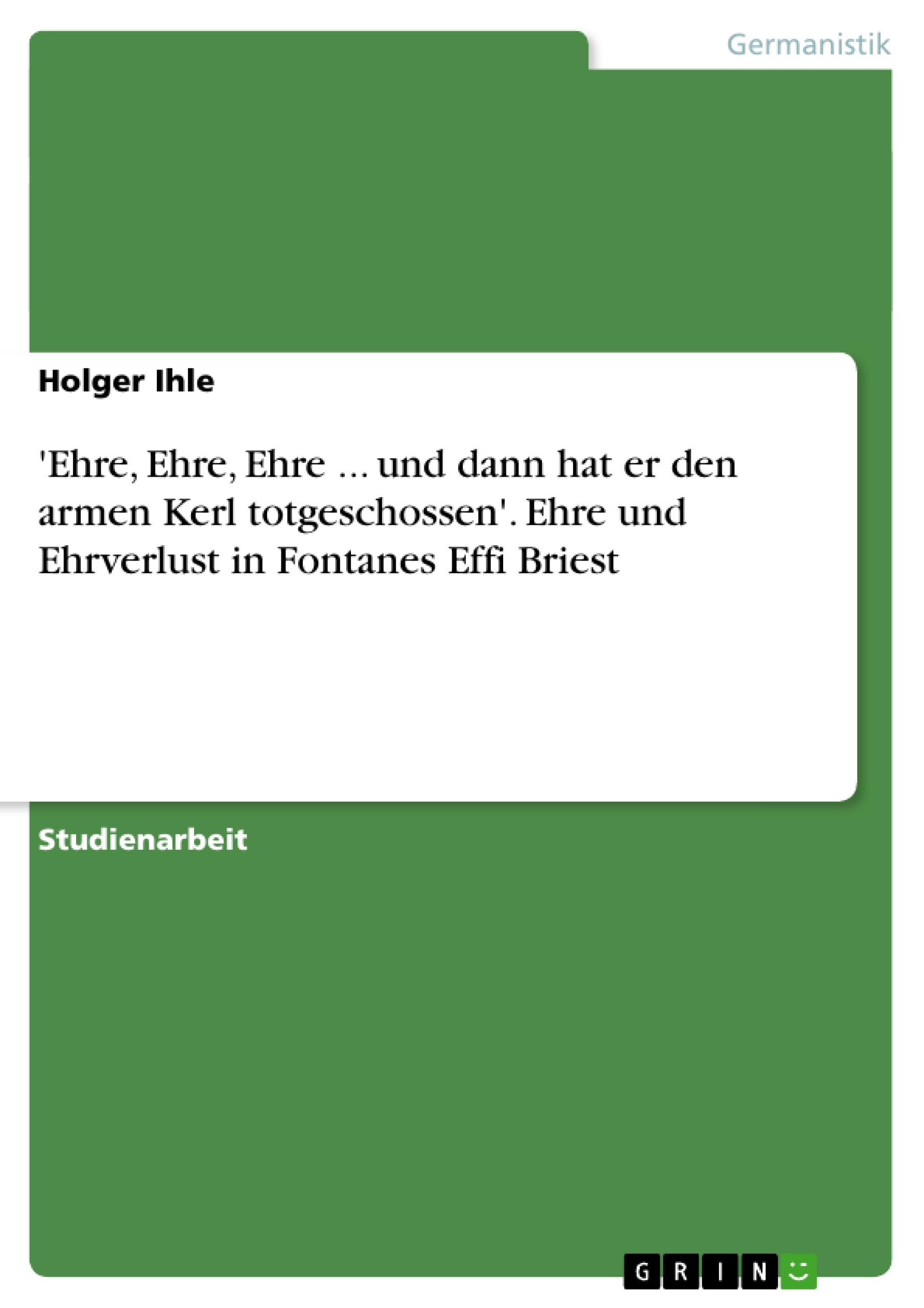»Er hat den Mann niedergeschossen, der ihm die Frau vom engen Pflichtenpfad abgelockt hatte. Das war sein gutes Recht, war eine Nothwendigkeit, an der ein Mann seines Standes im Ernst nicht zweifeln durfte; auf einer gewissen Stufe der Bildung und des Besitzes ziemt es sich für den christlichen Ehemann, den Verführer seines Weibes zum Zweikampf zu fordern, und es macht einen üblen Eindruck, wenn von den Kämpfern dann nicht Einer tot auf dem Platze bleibt. [...] Herr Geert von Innstetten wurde die seltsam fremden Gedanken nicht los, während der Eisenbahnzug ihn [...] ins alte, entheimelte Haus zurücktrug. [...] Es war gut, daß die Reise rasch zu Ende ging [...] sonst hätte er dem Dogma noch länger nachgegrübelt und schließlich gemerkt, daß, sind nur erst ein paar Stiche aufgetrennt, das Ganze wie Maschinennäherei reißt. [...]«1
Die Geschichte der Effi Briest ist, zumindest auf der zuoberst wahrnehmbaren Ebene, auch die Geschichte eines Verlustes von Ehre. Die gezeigte Gesellschaft ist durch einen aristokratischen und militärischen Ehrenkodex mitbestimmt und indem dessen Normen im Ehebruch übertreten werden, kommen Mechanismen einerseits zu dessen Verdeckung, andererseits zu dessen Ahndung nach der Entdeckung zum tragen. Diese Mechanismen in ihrer Funktion, wie sie der Text darstellt, sollen in dieser Arbeit nachvollzogen und freigelegt werden. Dabei sollen die durch den Text mit dem Konzept der Ehre verbundenen verschiedenen Diskursfäden zusammengeführt werden um ein möglichst weites Feld von Bedeutungszusammenhängen überblicken zu können. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Konzeptionen von Gesellschaft, Macht und Geschlecht, die der Text präsentiert. Wegen des unmittelbaren Zusammenhangs von Ehe, Verführung und Ehebruch soll auch dieses Feld im Licht der Mechanismen der kodifizierten Ehre betrachtet werden. Dabei kann hinsichtlich der Interpretation des Textes, wegen der Beschränkung auf erwähnte Teilaspekte, im Rahmen dieser Arbeit kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden. Zusammenhänge des Textes, die in den Tiefen der variantenreichen Symbolik liegen können dabei nur am Rande behandelt werden, sollen an geeigneter Stelle aber dennoch nicht unerwähnt bleiben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Ehre - Begriff und Problemfelder
- A. Grundbedeutung
- B. Öffentlichkeit und gesellschaftliche Funktionszusammenhänge
- C. Geschlechtsehre
- D. Körperliche Aspekte
- 1. Krankheit und Schwäche
- 2. Duell und Stärke
- III. Verführung
- IV. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Ehrenbegriff und dessen Verlust in Fontanes „Effi Briest“. Ziel ist die Analyse der gesellschaftlichen Mechanismen der Ehrenvorstellungen im Kontext von Ehebruch, sowie die Betrachtung der mit dem Konzept der Ehre verbundenen Diskursfäden. Besonderes Augenmerk liegt auf den im Text präsentierten Konzeptionen von Gesellschaft, Macht und Geschlecht.
- Der Ehrenkodex in der aristokratischen Gesellschaft
- Die Rolle von Öffentlichkeit und gesellschaftlichen Normen
- Ehe, Verführung und Ehebruch im Kontext des Ehrenkodexes
- Die Bedeutung von Machtstrukturen und Geschlechterrollen
- Interpretation der individuellen und gesellschaftlichen Reaktionen auf den Ehrenverlust
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale These auf, dass Fontanes „Effi Briest“ auf einer oberflächlichen Ebene die Geschichte eines Ehrenverlustes darstellt. Die Arbeit untersucht die gesellschaftlichen Mechanismen zur Verdeckung und Ahndung von Normbrüchen im Kontext des aristokratischen und militärischen Ehrenkodexes. Der Fokus liegt auf der Analyse der im Roman dargestellten Funktionsweisen dieser Mechanismen, sowie der Zusammenführung verschiedener Diskursfäden, die mit dem Ehrenbegriff verbunden sind. Dabei werden die Konzepte von Gesellschaft, Macht und Geschlecht besondere Beachtung finden, insbesondere im Zusammenhang von Ehe, Verführung und Ehebruch.
II. Ehre - Begriff und Problemfelder: Dieses Kapitel beleuchtet den vielschichtigen Ehrenbegriff in Fontanes Roman. Es differenziert zwischen rechtlicher, philosophischer und psychologischer Bedeutung und betont die Bedeutung des rechtlichen Begriffs für die Handlungszusammenhänge im Roman, ohne den philosophischen Hintergrund zu vernachlässigen. Die Grundbedeutung der Ehre wird als Achtung und Ansehen definiert, verbunden mit der Erfüllung sittlicher Mindestanforderungen. Das Kapitel analysiert die Abhängigkeit der Ehre von der öffentlichen Meinung und deren gesellschaftlichen Funktionszusammenhängen, mit Bezugnahme auf Schopenhauer's Unterscheidung zwischen subjektivem und objektivem Moment der Ehre und Tocquevilles These, dass Ehre die fundamentale Ungleichheit aristokratischer Gesellschaften voraussetzt. Der aristokratische Ehrenkodex in Fontanes Roman wird im Kontext der gesellschaftlichen Stellung der Figuren (Innstetten und Effi Briest) erläutert und die Bedeutung der Ehe als gesellschaftliche Konvention wird hervorgehoben. Die Notwendigkeit des Duells nach der Vertrauensenttäuschung Innstettens wird als Konsequenz der gesellschaftlichen Normen interpretiert, wobei eine einseitige Interpretation als reine Gesellschaftskritik vermieden wird.
Schlüsselwörter
Ehre, Ehrverlust, Fontane, Effi Briest, Ehebruch, Gesellschaft, Adel, Macht, Geschlecht, Öffentlichkeit, Duell, Konventionen, Normen, Diskurs
Häufig gestellte Fragen zu Fontanes "Effi Briest" - Ehrenbegriff und gesellschaftliche Mechanismen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den Ehrenbegriff und dessen Verlust in Theodor Fontanes Roman "Effi Briest". Im Mittelpunkt steht die Untersuchung der gesellschaftlichen Mechanismen, die mit den Ehrenvorstellungen im Kontext von Ehebruch verbunden sind, sowie die Betrachtung der damit verbundenen Diskurse. Besonderes Augenmerk liegt auf den im Text präsentierten Konzeptionen von Gesellschaft, Macht und Geschlecht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Ehrenkodex in der aristokratischen Gesellschaft, die Rolle von Öffentlichkeit und gesellschaftlichen Normen, Ehe, Verführung und Ehebruch im Kontext des Ehrenkodexes, die Bedeutung von Machtstrukturen und Geschlechterrollen sowie die Interpretation der individuellen und gesellschaftlichen Reaktionen auf den Ehrenverlust.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Ehrenbegriff und dessen Problemfelder, ein Kapitel zur Verführung und einen Schluss. Das Kapitel zum Ehrenbegriff untersucht die vielschichtige Bedeutung des Begriffs (rechtlich, philosophisch, psychologisch), die Abhängigkeit der Ehre von der öffentlichen Meinung, den aristokratischen Ehrenkodex im Kontext der gesellschaftlichen Stellung der Figuren und die Bedeutung der Ehe als gesellschaftliche Konvention.
Welche Kapitelzusammenfassung wird gegeben?
Die Einleitung stellt die zentrale These auf, dass Fontanes "Effi Briest" auf oberflächlicher Ebene die Geschichte eines Ehrenverlustes darstellt und untersucht die gesellschaftlichen Mechanismen zur Verdeckung und Ahndung von Normbrüchen. Das Kapitel "Ehre - Begriff und Problemfelder" beleuchtet den vielschichtigen Ehrenbegriff, differenziert zwischen rechtlicher, philosophischer und psychologischer Bedeutung und analysiert die Abhängigkeit der Ehre von der öffentlichen Meinung und deren gesellschaftlichen Funktionszusammenhängen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter umfassen Ehre, Ehrverlust, Fontane, Effi Briest, Ehebruch, Gesellschaft, Adel, Macht, Geschlecht, Öffentlichkeit, Duell, Konventionen und Normen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist die Analyse der gesellschaftlichen Mechanismen der Ehrenvorstellungen im Kontext von Ehebruch und die Betrachtung der mit dem Konzept der Ehre verbundenen Diskursfäden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den im Text präsentierten Konzeptionen von Gesellschaft, Macht und Geschlecht.
- Quote paper
- M.A. Holger Ihle (Author), 2004, 'Ehre, Ehre, Ehre ... und dann hat er den armen Kerl totgeschossen'. Ehre und Ehrverlust in Fontanes Effi Briest, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/31507