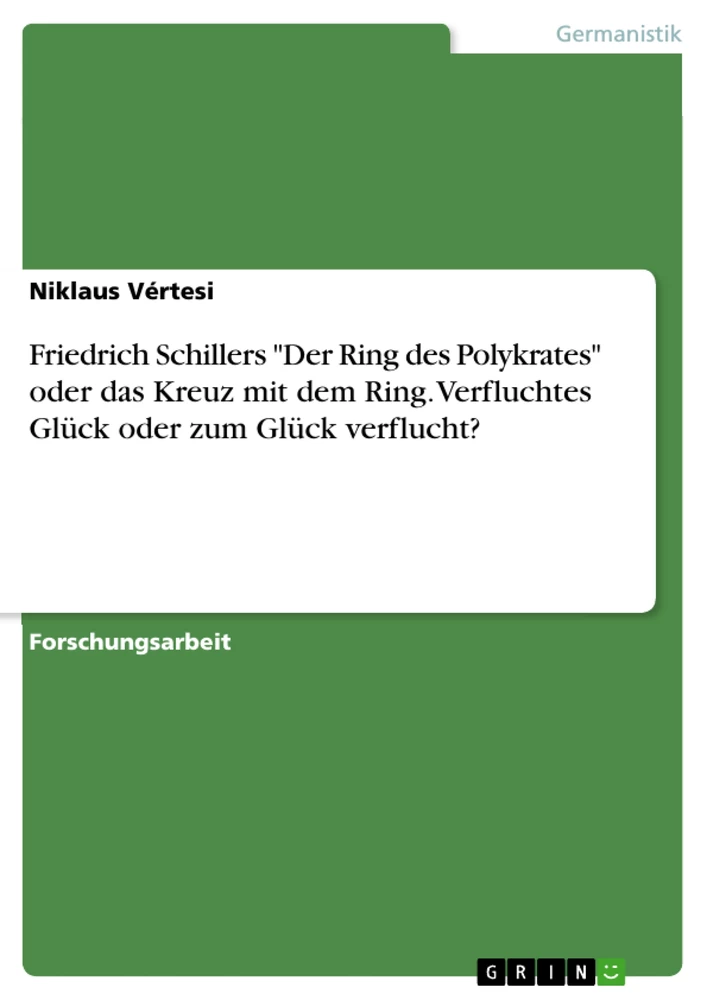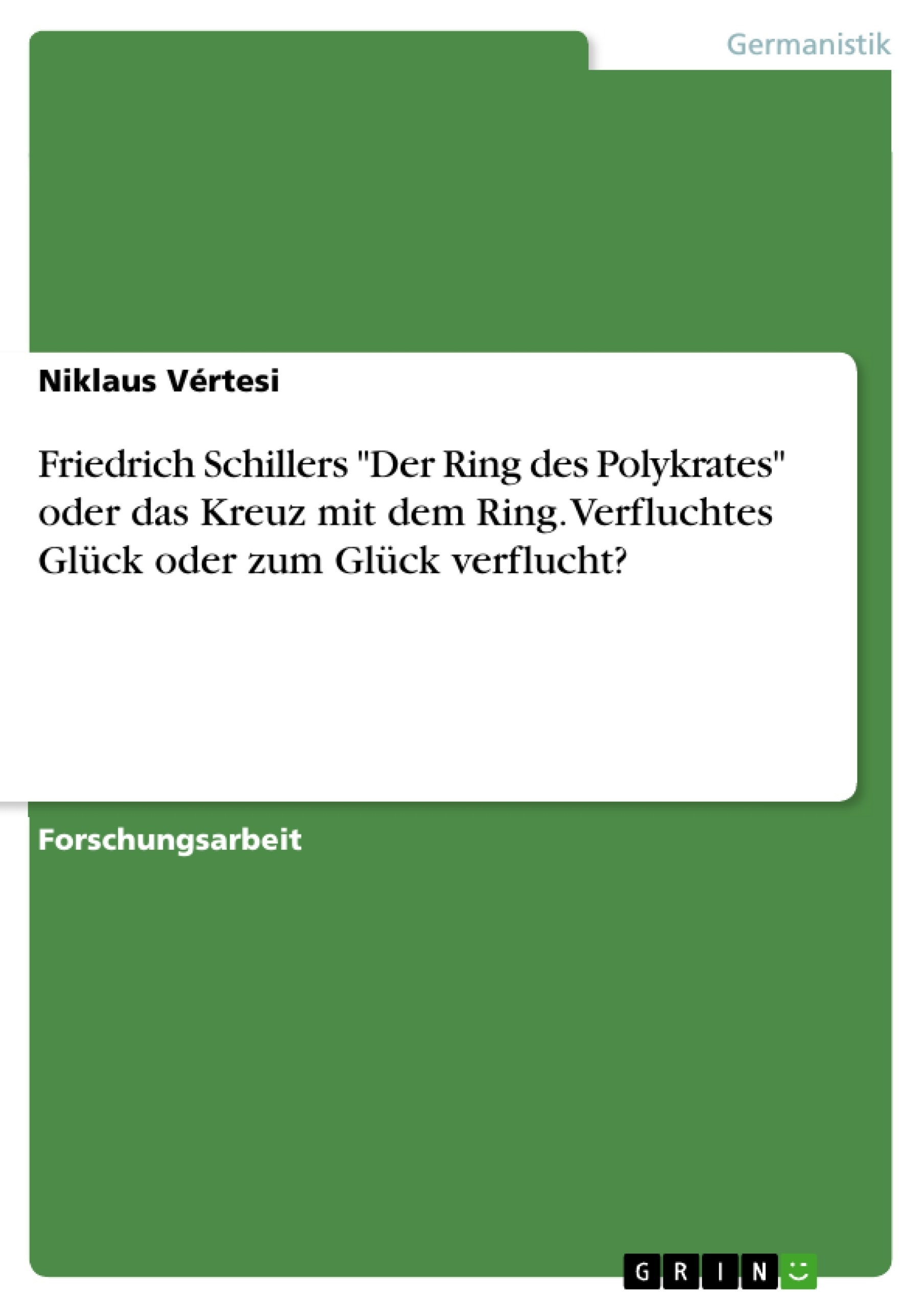Der Ring des Polykrates wurde bis anhin stets falsch gedeutet. Man sah in ihm die Antwort auf die Frage nach dem rechten Masse oder eine Abrechnung mit Napoleon - aber das ist wohl kaum Schillers Intention mit dieser Ballade gewesen. Es ging ihm um viel mehr. Schiller beschäftigt sich mit der menschlichen Existenz schlechthin.
Wie tief seine Gedanken gründen, wird deutlich, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass er stets von den Erinnen statt Erinnyen spricht; dabei gebraucht er in den Kranichen des Ibikus durchaus die übliche orthografische Variante. Warum also spricht er im Polykrates von den Erinnen? Beachten Sie die ersten zwei Verszeilen der Ballade und Sie werden sich die Antwort selbst geben können! Immanent sind die Erinnen von Anfang an anwesend. Und das soll sich ein Dichter wie Schiller nicht überlegt haben?
Lesen Sie, wie Schiller mit dem Polykrates in die Pardoxien des menschlichen Seins eindringt und welche persönliche Botschaft er dem Leser mit seinem Text mitgibt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Aufbau und Inhalt
- Formales
- Reim und Versmass
- Rhetorische Auffälligkeiten
- Gattungsspezifische Überlegungen
- Historische Informationen
- Historische Fakten zu Polykrates
- Schillers Quellen
- Christian Garve
- Herodot
- Schillers Änderungen
- Polydor
- Rezeption
- Interpretationsversuch
- Vom Wesen des Glücks
- Moment und Ewigkeit ‐ Gründe für Schillers Änderungen
- Wallenstein oder das Zufallen des Fälligen
- Polykrates oder das Zufallen des Zufälligen
- Das Ringen mit dem Ring – Der Kampf um die Autonomie
- Die Erinnen – eine gewollte Paronomasie
- Vom Paradoxon über die Selbstreferenz zum Peridoxon
- Die Erfüllung in Suspenso
- Narrative Selbstreferenzialität
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
- Quellen
- Darstellungen
- Anhang
- Christian Garve
- Herodot
- Der Ring des Polykrates in der Nationalausgabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit analysiert Schillers Ballade „Der Ring des Polykrates“ und untersucht die literarischen und historischen Aspekte des Werks. Der Fokus liegt auf der Interpretation der Ballade im Kontext des antiken Schicksalsglaubens und der christlichen Vorstellung von Erlösung.
- Schillers Bearbeitung des historischen Stoffes und seine Abweichungen von der Quelle
- Die Rolle des Glücks und des Schicksals in der Ballade
- Die symbolische Bedeutung des Rings als ikonisches Zeichen für die Verbundenheit mit dem Göttlichen
- Die Herausforderungen des Menschseins angesichts von Paradoxien und scheinbar undurchsichtigen Schicksalsfügungen
- Die Bedeutung der christlichen Vorstellung von Erlösung für die Interpretation der Ballade
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt die Ballade „Der Ring des Polykrates“ vor und zeigt die Vielzahl der existierenden Interpretationen auf. Die Arbeit beleuchtet die Struktur und den Inhalt des Werks, indem sie die einzelnen Kapitel anhand der wichtigsten Themen und Motive zusammenfasst. Die Kapitel 3, 4 und 5 gehen auf die formalen Besonderheiten der Ballade, die historischen Informationen zu Polykrates sowie die Quellen und die vorgenommenen Änderungen Schillers ein. Dabei werden verschiedene Interpretationsansätze beleuchtet und der Fokus auf die Rolle des Glücks, des Schicksals und der Paradoxien im Werk gelegt. Schliesslich wird die Ballade als ein Peridoxon interpretiert, das die antike Vorstellung von Schicksal mit christlichen Elementen der Erlösung verknüpft. Das Schlusswort fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und stellt die Bedeutsamkeit des Werks für die Auseinandersetzung mit dem Menschsein und den Paradoxien des Lebens heraus.
Schlüsselwörter (Keywords)
Schillers Ballade „Der Ring des Polykrates“, griechische Mythologie, Schicksal, Glück, Unglück, Paradoxon, Peridoxon, Selbstreferenz, Autonomie, christliche Vorstellung von Erlösung, Fleischwerdung, Symbolsprache.
- Quote paper
- Niklaus Vértesi (Author), 2011, Friedrich Schillers "Der Ring des Polykrates" oder das Kreuz mit dem Ring. Verfluchtes Glück oder zum Glück verflucht?, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/314074