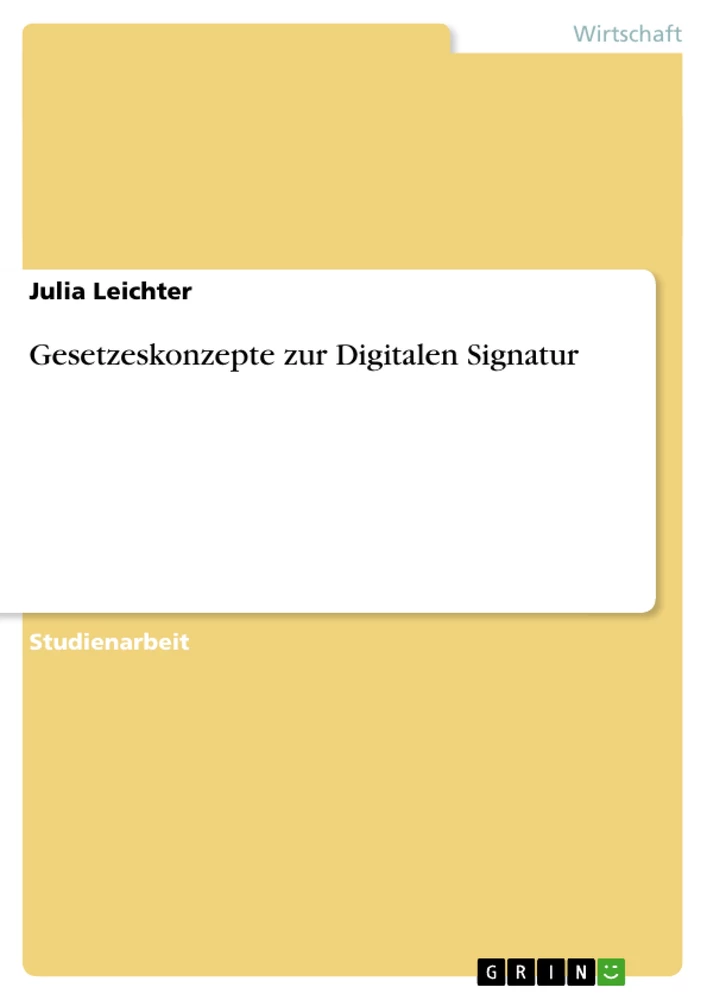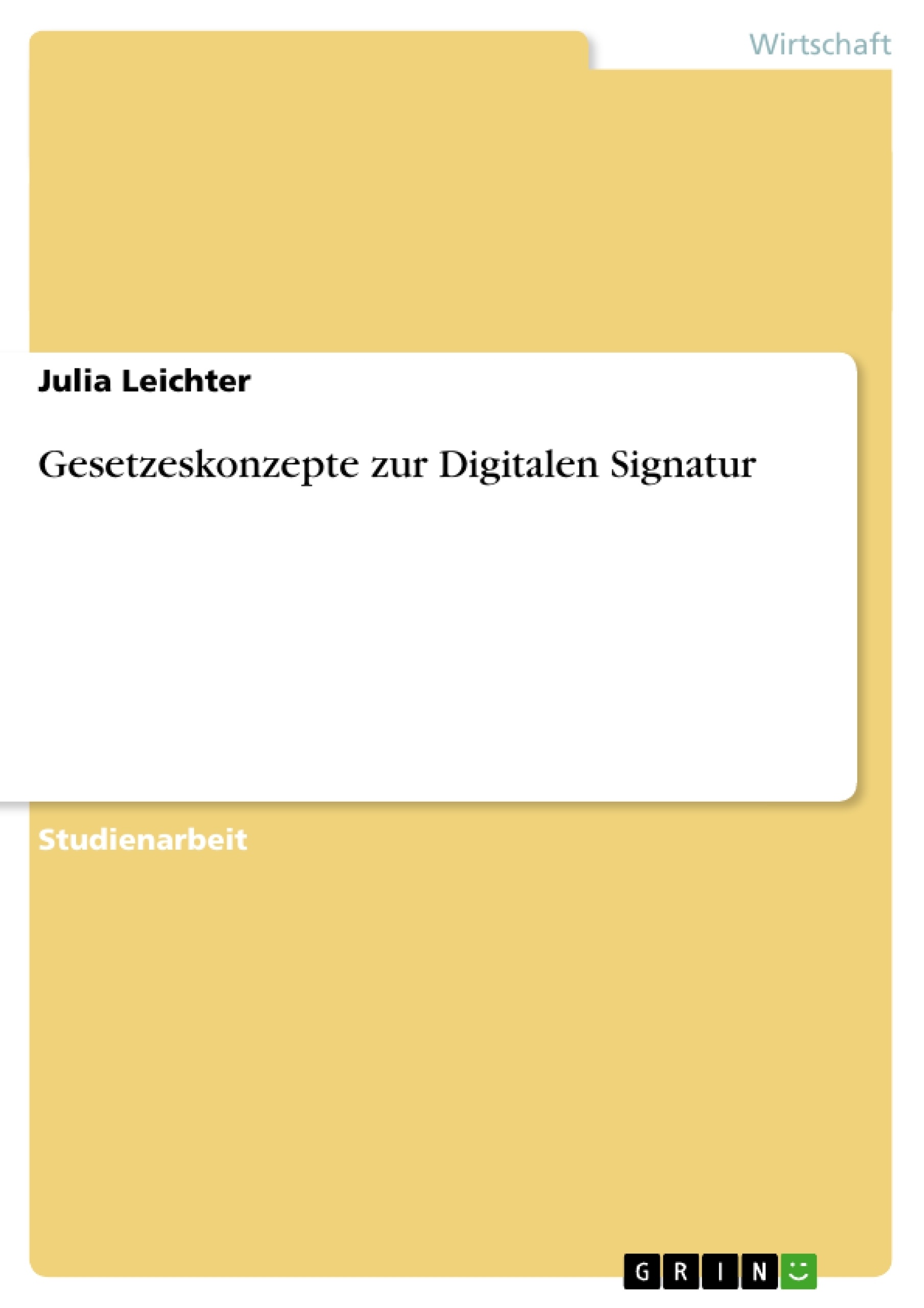Im laufe der letzten Jahre haben sich die Wege des Geschäftsverkehr immer mehr verändert. Bisher erreichten zu übermittelnde Dokumente über die bekannten Wege (Postweg, direkte Übergabe, per Boten, …) ihren Empfänger. Damit dieser sicherstellen kann, dass das Dokument die Echtheit besitzt von dem tatsächlichen Urheber verfasst und versendet worden zu sein oder um Veränderungen (Verfälschungen) feststellen zu können, werden wichtige Schriftstücke oder Verträge mit der eigenhändigen Unterschrift des Verfassers oder mit einem Sigel versehen.
Die Entstehung des elektronischen Geschäftverkehrs (Electronic Commerce), des Handelns mit Waren und Dienstleistungen mit Hilfe digitaler Datennetze, insbesondere über das Internet, brachten eine neue Form des Datentransphers mit sich.
Die Aufgabe der Gesetzgebung, Rechtswissenschaft und Praxis ist es, verlässliche Bedingungen für diesen Typus des Rechtsverkehrs zu schaffen. Denn Geschäfte über elektronische Kommunikationswege müssen auf Dauer einen vergleichbaren Sicherheitsstandart erreichen, um ihnen allgemeine Akzeptanz und damit die von der Wirtschaft erhoffte Impulswirkung zu verleihen.
Zur Sicherheit der Datenübermittlung gehört es, dass die Nachricht während der Übermittlung nicht verfälscht wird und dass die Nachricht tatsächlich von der angeblichen Quelle stammt und nicht von einem Dritten, der über die Identität des Absenders der Nachricht täuscht.
Dem elektronischen Medium inhärent ist jedoch seine grundsätzliche Flüchtigkeit und daraus resultierend eine große Unsicherheit, was die Verlässlichkeit, Verbindlichkeit und damit in der Konsequenz die Tauglichkeit elektronischer Daten für die Verwendung im Rechtsverkehr betrifft. Bekannte Beispiele sind in diesem Zusammenhang die Verfälschungsmöglichkeiten bei Faxversand, die Manipulation von elektronischer Post (E-Mail), sowohl im Hinblick auf die Absenderdaten als auch ihren Inhalt sowie die mittlerweile fast alltäglichen Hacker-Angriffe auf Datenbestände im Internet.
Inhaltsverzeichnis
- Grundprinzipien der Signaturtechnologie und Kryptographie
- Technische Funktionsweise und Anwendung
- Einleitung
- Anforderungen an die asymmetrische Verschlüsselung
- Anforderungen an Hash Funktion
- Trust-Center - Zertifizierungsstellen (neutrale Instanz)
- Die Zertifikate
- Erweiterungen
- Unterscheidung zwischen „,einfacher-\", ,,fortgeschrittener-❝ und ,,qualifizierter elektronischer Signatur“
- Gesetzeskonzepte
- Technologieneutraler Ansatz
- Technologiespezifischer Ansatz
- Vermittelnder Ansatz
- Gültige Gesetze und Verordnungen in der Bundesrepublik Deutschland und in der EU
- Signaturgesetz (SigG) und Signaturverordnung (SigV) als technikrechtlicher Ansatz
- EU Signaturrichtlinien (SigR)
- Das UNCITRAL Modellgesetz für elektronische Signatur
- Die Gesetzgebung der digitalen Signatur in den USA
- Vergleich der Regelkonzepte
- Einleitung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Konzepte der digitalen Signaturgesetzgebung im internationalen Vergleich. Ziel ist es, die technischen Grundlagen, rechtlichen Rahmenbedingungen und verschiedenen Ansätze der Gesetzgebung für elektronische Signaturen in verschiedenen Ländern zu analysieren und zu vergleichen.
- Technische Funktionsweise und Anwendung der digitalen Signatur
- Rechtliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen
- Internationale Unterschiede in der Gesetzgebung
- Vergleich verschiedener Konzepte der digitalen Signaturgesetzgebung
- Aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich der digitalen Signatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Grundprinzipien der Signaturtechnologie und Kryptographie. Es werden die technischen Funktionsweisen und Anwendungen der digitalen Signatur erklärt, einschließlich der Anforderungen an die asymmetrische Verschlüsselung, Hash-Funktionen und Zertifizierungsstellen. Des Weiteren werden die verschiedenen Arten von elektronischen Signaturen, wie z.B. einfache, fortgeschrittene und qualifizierte Signaturen, vorgestellt.
Im zweiten Kapitel wird die Gesetzgebung für digitale Signaturen im Detail betrachtet. Es werden verschiedene Konzepte, wie technologieneutrale, technologiespezifische und vermittelnde Ansätze, diskutiert.
Anschließend werden die geltenden Gesetze und Verordnungen in Deutschland und der EU behandelt, insbesondere das Signaturgesetz (SigG) und die Signaturverordnung (SigV) sowie die EU-Signaturrichtlinien (SigR).
Danach wird das UNCITRAL Modellgesetz für elektronische Signaturen vorgestellt, welches als internationaler Standard für die Gesetzgebung in diesem Bereich dient. Das Kapitel über die Gesetzgebung in den USA beschreibt die rechtlichen Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen in den Vereinigten Staaten.
Schließlich werden die verschiedenen Regelkonzepte der digitalen Signaturgesetzgebung verglichen und die wichtigsten Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgestellt.
Schlüsselwörter
Digitale Signatur, elektronische Signatur, Kryptographie, asymmetrische Verschlüsselung, Hash-Funktion, Zertifizierungsstelle, Signaturgesetz, Signaturverordnung, EU-Signaturrichtlinien, UNCITRAL Modellgesetz, USA, internationaler Vergleich.
- Quote paper
- Julia Leichter (Author), 2004, Gesetzeskonzepte zur Digitalen Signatur, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/31403